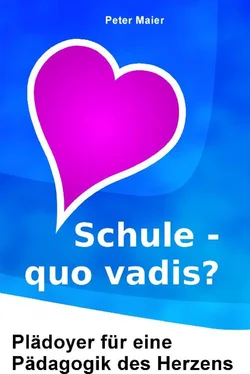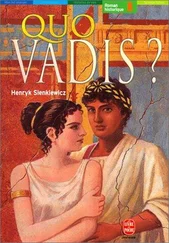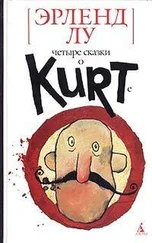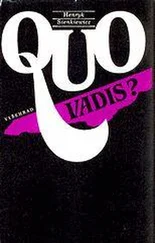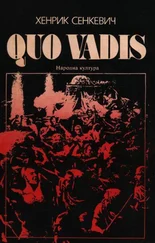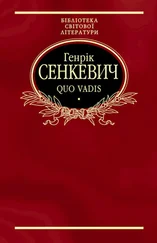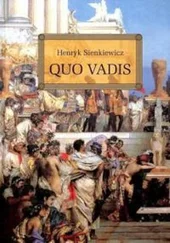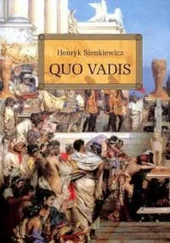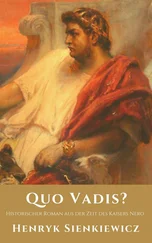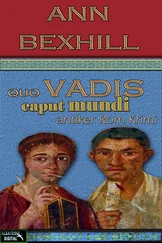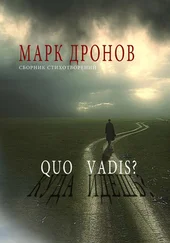9.
Für einen guten Unterricht sind Mitgefühl und Empathiefähigkeit des Lehrers ebenso wichtig wie seine Fach- und Methodenkenntnisse. Diese „weichen“ Qualitäten können aber schwerlich in Pisa-Statistiken erfasst oder in externen Evaluationen gemessen werden. Wie denn auch? Daher verbreitet sich in der ganzen Hysterie von Bildungsreformen heute immer mehr die irrige Meinung, dass nur noch Wissensbildung und Kompetenzvermittlung die vorherrschenden und entscheidenden Aufgaben des Lehrers seien.
10.
Zum Schluss ein persönliches Bekenntnis: Ich habe es mir – je länger ich unterrichte, desto mehr – auf die Fahnen geschrieben, mein Herz für die Bedürfnisse und die emotionale Situation der Schüler zu öffnen, deren Entwicklung bisweilen von schweren Umbrüchen geprägt ist und die davon hin- und hergeworfen werden können. Immer mehr Schüler kommen aus zerrissenen Familien und sind davon bisweilen schwer belastet. Das kann mir als Lehrer nicht gleichgültig sein.
Ich habe festgestellt, dass die Schüler zu fachlicher Höchstleistung bereit sind, wenn sie vom Lehrer wahr- und ernstgenommen und in ihrer Entwicklung auf dem Weg zu jungen Persönlichkeiten bestätigt und gewürdigt werden. Neugierde am Fach und Beziehung zum Lehrer gehören für die meisten Schüler untrennbar zusammen, zumindest in Unter- und Mittelstufenklassen.
Darum möchte sich dieses Buch genau mit diesem fundamental wichtigen emotionalen Aspekt des Unterrichts – mit der Beziehungsebene zwischen Schülern und Lehrer – beschäftigen, der heute völlig in den Hintergrund zu geraten droht. Das wäre aber fatal und Schüler wie Lehrer haben dies nicht verdient.
Der Mehrwert der schulischen Bildung
Bevor ich mich der veränderten Rolle des Lehrers in der heutigen Bildungsdiskussion zuwende, soll zunächst noch kurz der Politikwissenschaftler Christian Grünwald zu Wort kommen. In seinem Beitrag mit dem Titel „Total vermessen“ in der Süddeutschen Zeitung weist er auf die Grenzen einer völligen Ökonomisierung von immer mehr Bereichen unseres Lebens hin, die auch vor dem Bildungssektors nicht Halt macht: „... der Trend zur Ökonomisierung scheint unaufhaltsam zu sein. Märkte sind effizienzgeprägt, ihre Mittel sind Standardisierung und Normierung. Was bei Produktion und Handel zu Kostenreduktion und vergleichbarer Qualität führt, ist auch im Bildungssektor präsent: G-8-Gymnasien, Pisa, Bologna, vom Schulkind bis zum Postgraduate wird verglichen, harmonisiert, effizienter gemacht.“ 8
Im gesellschaftlichen Mainstream wird heute alles wirtschaftlichem Denken und ökonomischer Effizienz unterworfen, also auch die Bildung, wovon ja dieses erste Kapitel handeln soll. Der Glaube an ein permanentes Wirtschaftswachstum ist zu einer neuen weltumspannenden „kapitalistischen Religion“ geworden, an die viele blind und naiv glauben. Ihre Transportmittel sind die Globalisierung und die Digitalisierung.
Herrn Grünwald geht es bei seinen Überlegungen in erster Linie ganz grundsätzlich um den Wirtschaftsstandort Deutschland, der sich immer mehr von einem Industriestaat zu einem wissensbasierten Dienstleistungsland entwickelt hat, wenn er überraschend folgende Kernfrage stellt: „Ist Ökonomisierung noch gut für die Wirtschaft?“ 9Denn Wissensgesellschaften sind vor allem auf den „Schlüsselrohstoff“ für Innovationen angewiesen: auf immer neue Ideen. Ideen aber verlangen Kreativität – in Forschung, Verwaltung, im Management und vor allem in der Bildung. Daher fordert er: „Statt kürzerer Bildungswege mit verschulten Abschlüssen sollte das freie Denken, das Sich-Ausprobieren an Schulen und Hochschulen wieder gefördert werden – anstelle eines Systems, das aller Individualisierung zum Trotz vermehrt Gleichförmigkeit produziert. Standardisierung fördert eindimensionales, lineares Denken und tötet Kreativität.“ 10
Es tut gut, im ganzen Orchester von aufgeregten Stimmen zur Bildungspolitik auch solch eine wie die von Herrn Grünwald zu hören, der weiterdenkt und aufzeigt, wohin eine Dominanz ökonomischen Denkens führen kann, vor allem wenn es auf externe Gebiete wie den Bildungsbereich ausgedehnt wird: auf eine geistige Verarmung. Doch nun zur Situation des Lehrers in der heutigen Bildungsdiskussion: Was hat sich geändert, was aber müssen auch in Zukunft bleibende und essentielle Aufgaben des Lehrers sein?
(2) Methodenreformen und Digitalisierung: Lehrer – quo vadis?
Der „Pisa-Schock“ von 2001 hat eine umfangreiche Reformtätigkeit im Bildungsbereich ausgelöst, deren Ende nicht abzusehen ist. Mir kommt es manchmal so vor, als ob damals der „Bildungs-Unbildungs-Geist“ aus der Flasche gelassen wurde. Dadurch kam auch das herkömmliche traditionelle Bild des Lehrers in Bewegung – besonders an den weiterführenden Schulen.
Kritik an den Lehrern
Es wurde vor allem der lehrerzentrierte Unterricht, plakativ bisweilen als „Frontalunterricht“ bezeichnet, heftig kritisiert. Hier glaubten einflussreiche gesellschaftliche Gruppen – Wirtschaftskreise, Bildungsforscher, selbsternannte oder tatsächliche Reformer – eine der Hauptursachen zu finden, warum Deutschland im Pisa-Vergleich 2001 der OECD nur mittelmäßig abgeschnitten hatte.
Was dann folgte, wurde von manchen Lehrern, die viele Jahre eine engagierte und verantwortliche pädagogische Arbeit geleistet hatten, als wahrer „Tsunami in der Bildungspolitik“ erlebt und als Methoden-, Digitalisierungs- und Strukturveränderungs-Wahn empfunden. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass dabei das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wurde. Da sich Bildung seit Pisa als Mega-Thema entwickelt hat, vergeht keine Woche mehr, in der nicht neue Vorschläge zur Verbesserung der Schule medial wirksam propagiert werden, die den Anspruch erheben, „die“ Lösung aller Schulprobleme zu beinhalten. Kein Wunder, dass gerade ältere Lehrer, die viel Erfahrung mit dem Unterrichten von Kindern und Jugendlichen in der Pubertät haben, zunehmend verunsichert werden.
Manche Pädagogen fühlen sich und ihre Arbeit auch herabgewürdigt. Sollte denn alles falsch gewesen sein, was sie bisher im Unterricht gemacht haben? Sollte ihr ehrliches Engagement umsonst gewesen sein? Das bisherige Lehrerbild und der Lehrerberuf insgesamt wurden durch diesen öffentlichen „Hype“ in der Bildungsdiskussion in den letzten Jahren immer mehr in die Defensive gedrängt. Gleichzeitig wurden in zunehmendem Maße ungelöste gesellschaftliche Fragen auf die Schulen abgeschoben und dann zu „Schulproblemen“ erklärt.
Den Lehrern an weiterführenden Schulen wie etwa an den Gymnasien wurde vermittelt, wie altmodisch, „hinterwäldrerisch“ und konservativ sie doch seien, weil sie noch immer einem längst vergangenen, altertümlichen Lehrerbild anhingen; daher hätten sie eine gehörige Portion Mitschuld am schlechten Abschneiden in der Pisa-Studie. Von tatsächlichen oder selbsternannten Bildungsexperten wurde den Gymnasialpädagogen vorgeworfen, dass sie methodisch und informationstechnisch nicht mehr auf der Höhe der Zeit seien und dass der Bildungsstandort Deutschland mit solch einer Einstellung zu Schule, Unterricht und Bildung im entfesselten Bildungswettkampf einer globalisierten Welt schnell den Anschluss verlieren würde. Diese Warnung darf natürlich nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Die gleichen Leute sparten dann nicht mit Verbesserungsvorschlägen, mit deren Hilfe schnell und einfach alle Schulprobleme zu bewältigen seien. Hier einige dieser Forderungen, die meist von außen an die Schulen herangetragen wurden:
vollkommene Auflösung des Frontalunterrichts;
Verzicht auf möglichst jeden lehrerzentrierten Unterricht;
dafür nur noch neue Unterrichtsformen: Gruppenarbeit, Partnerarbeit, selbständiger Unterricht der Schüler;
ein Computer an jedem Schülertisch;
Читать дальше