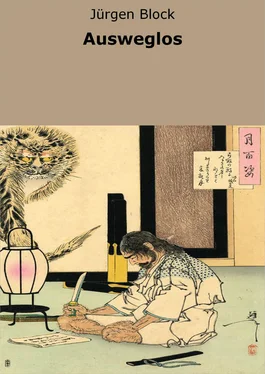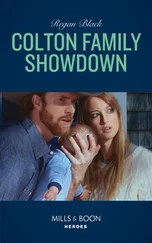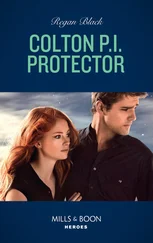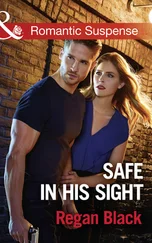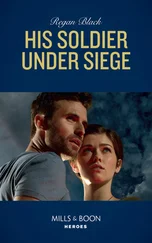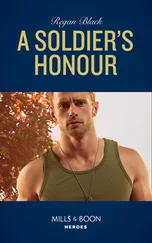Zeitschriftenartikel erschienen nun nicht nur im Druck, sondern wurden online übers Internet im Volltext angeboten und unterschieden sich nicht von den gedruckten Exemplaren. Er war unter den ersten, die für seine Bibliothek Lizenzen zur Nutzung dieser Angebote erwarben.
Jetzt war die Online-Versorgung mit wissenschaftlicher Literatur zu einem millionenschweren Geschäft geworden, die Öffentlichkeit, Politik und Justiz hatten sich intensiv mit den damit verbundnen Fragen beschäftigt. Die Paracelsus-Gesellschaft hatte eine Dachorganisation eingerichtet, die sich mit Mitteln aus jedem Institutshaushalt finanzierte, mit den großen wissenschaftlichen Verlagen verhandelte und Lizenzen für mittlerweile über zwanzigtausend Zeitschriften verwaltete.
Weil jeder Institutsangehörige, vom Bachelor-Studenten bis hin zum Professor, an seinem Arbeitsplatz-PC auf diese Inhalte zugreifen konnte, wurde bald von etlichen Seiten geäußert, dass man nun Bibliothekarinnen und Bibliothekare nicht mehr brauche, es sei ja alles online. Und tatsächlich ging der Trend in einigen Bibliotheken der biowissenschaftlichen Institute der Paracelsus-Gesellschaft dahin, OPL (One Person Libraries) zu NPL (No Person Libraries) zu machen.
Es wurde aber auch deutlich, dass Bibliothekare ihr Handwerk nicht nur mit penibler Professionalität ausübten, sondern darüber hinaus auch die Kunstfertigkeit entwickelten, sich schlichtweg unentbehrlich zu machen. Kolbe hatte diese Kunst bis zur Perfektion entwickelt: es gab nach wie vor wissenschaftliche Literatur, die nicht im Buch- und Zeitschriftenbestand der Bibliothek vorhanden war und für die es keinen Online-Zugriff gab. Moderne Bestellsysteme erlaubten es dem pfiffigen Bibliothekar, dem Nutzer diese Informationen in wenigen Stunden zur Verfügung zu stellen, und wenn er Fragen wie „Wie macht ihr das nur so schnell?“ mit hintergründigem Lächeln beantwortete „Na ja, wir haben halt so unsere speziellen Quellen!“, dann hatte er seinen großen Auftritt als Merlin der Informationstechnik.
Zu Sternstunden des Recherchierens und Bibliographierens kam es, wenn der ehemalige Geschäftsführer des Instituts vorbeischaute und neue Literaturwünsche hatte. Dr. Robert Fahlmann war Physiker und mutierte nach seiner Pensionierung zum Haushistoriker des Instituts. Das jetzige Paracelsus-Institut hatte mehrere Vorläufer gehabt, von denen die während der Nazi-Diktatur existierenden historisch die interessantesten waren. Fahlmann hatte dazu mehrere Beiträge in populären Zeitschriften geschrieben und arbeitete nun zusammen mit anderen Historikern an einer umfassenden Darstellung der Institutsgeschichte. Er war ständig agil und auf dem Sprung, brachte kaum einen Satz vernünftig zu Ende, nahm sich aber die Zeit, die neuesten Geschichten zu erzählen, die er dem Dunkel der Vergangenheit entrissen hatte.
Ohne sich angekündigt zu haben, stand Fahlmann heute um zehn Uhr in Kolbes Büro. Er scherte sich nicht darum, dass Kolbe gerade mit anderer Arbeit beschäftigt war, erzählte sofort Geschichten von Leuten, die Kolbe vollkommen unbekannt waren und kam dann zum Kern seines Besuches, was er wie immer mit den Worten einleitete:
„Sagen Sie, Herr Kolbe, kommen Sie an so was ran?“.
Er reichte Kolbe einen Zettel herüber, auf dem Folgendes zu lesen war: „Jendrassek, Das Le Chateliersche Prinzip ..., Studia Biologica Hungarica“.
Kolbe, der ein hervorragendes visuelles Gedächtnis besaß und jedes Buch in der Bibliothek nicht nur einmal in der Hand gehabt hatte, schaute enttäuscht auf seinen Besucher. Dessen Wunsch brachte ihn leider um den Genuss, nach Herzenslust bibliographieren zu können, denn das gesuchte Heft befand sich in der Gleitregalanlage des Magazins im Keller des Instituts, das war so sicher wie das Amen in der Kirche.
„Herr Fahlmann, das Heft ist bei uns vorhanden, ich muss es nur aus dem Magazin holen.“, sagte er. „Haben Sie noch etwas anderes im Haus zu tun? Es dauert nur ein paar Minuten.“
„Einverstanden“, freute sich Fahlmann, „ich habe noch eine Besprechung mit einem der Direktoren. In einer Stunde bin ich wieder da.“ Damit verschwand er auf leisen Sohlen wie er gekommen war.
Kolbe schaute noch kurz auf seine aktuellen Emails, dann machte er sich auf den Weg ins Magazin. Vom Schreibtisch loszukommen, das konnte seinen alten Knochen nur gut tun.
Das Magazin einer Bibliothek ist so etwas wie seine Schatzkammer und liegt wie bei der Krypta einer Kirche zumeist tief unter der Erde als Teil des Gebäudefundaments. Auch das Magazin des Paracelsus-Instituts lag zwei Etagen unter dem Lesesaal und beherbergte ebenfalls einige Schätze, so Zeitschriftenbände aus dem neunzehnten Jahrhundert, die in Deutschland kein zweites Mal vorhanden waren. Aber sie waren für die Forscher im Institut noch nicht einmal von bibliophilem Interesse. Wer beschäftigte sich schon mit physiologischer Literatur aus der Anfangszeit dieser Wissenschaft, in einer Zeit, in der sich die Biowissenschaften alle 10 Jahre selbst revolutionierten? Gegen massiven Widerstand, vor allem der Direktoren des Instituts, war es Kolbe trotzdem gelungen, den Bestand im Magazin zu wahren. In dieser Hinsicht war er ein Konservativer, dem es in der Seele wehtat, wenn Bücher vernichtet wurden.
Als Kolbe die Stahltür zum Gang in das Magazin öffnete, fiel ihm ein Geruch auf, den er vorher noch nie wahrgenommen hatte. Er hatte nichts mit den Gerüchen zu tun, die üblicherweise in diesem Kellergeschoss vorhanden waren. Die Handwerker rauchten hier, obwohl das Rauchen im ganzen Institut verboten war, es roch nach aufgewärmtem Essen, und wenn Löt- oder Schweißarbeiten ausgeführt wurden, lag dieser typische metallische Geruch in der Luft. Aber diesen stechenden, jedoch auch süßlich-sauren Geruch kannte Kolbe, der als Nichtraucher eine empfindliche Nase hatte, überhaupt nicht. An diesem Montagmorgen wurde hier nicht gearbeitet, niemand war zu sehen, doch der Geruch wurde intensiver, als er sich der Tür zum Magazin näherte.
„Verdammt!“, dachte Kolbe, „bestimmt haben sich wieder Mäuse oder Ratten im Magazin eingenistet, von denen einige gestorben sind und jetzt in den Ecken vergammeln. Es wird allerhöchste Zeit, Fallen aufzustellen.“
Das Magazin war nämlich beheizt und er hatte den Gebäudetechniker gebeten, die Temperatur etwas zu drosseln, da die Bücher unter der trockenen Wärme litten, aber der sture selbstherrliche Kerl hatte nur mit den Schultern gezuckt und gemeint, die Temperatur sei so vorgeschrieben.
Als er die Tür zum Magazin geöffnet hatte, trat er unwillkürlich einen Schritt zurück, denn der Geruch nahm ihm sofort den Atem. Er hielt sich die Nase zu, schaltete die Beleuchtung im Gang und über den Regalen ein und begann, die Kurbel am Regal Sieben zu drehen. Gleitregalanlagen, auch Compactus genannt, waren schon eine tolle Sache, da hatten Ingenieure und Techniker ganze Arbeit geleistet. Das gesuchte Heft befand sich im Regal Achtzehn links, aber zuerst musste er die kleinen Lücken zwischen den Regalen davor schließen. Die Regale glitten lautlos auf ihren kugelgelagerten Rollen dahin, doch plötzlich gab es einen Ruck, die Kurbel schlug zurück auf seine Hand: die Lücke zwischen den Regalen Dreizehn und Vierzehn ließ sich nicht schließen.
‚Ja, ja, es sind wieder einige Bände aus den Regalen gefallen’, dachte Kolbe und bewegte sich auf die Lücke zwischen den Regalen Dreizehn und Vierzehn zu. Seine Augen weiteten sich, die Luft blieb ihm weg und starr blieb er stehen, als er in den Gang schaute.
Auf einer Isomatte lag in grotesk verkrümmter Haltung ein Mann mit einer großen Wunde in der Bauchregion, aus der sich große Mengen Blut auf den Boden des Magazins ergossen hatten.
Mit der rechten Hand umklammerte er ein langes gebogenes Messer, die Waffe, die augenscheinlich zu seinem Tod geführt hatte. Kolbe wurde es kurz schwarz vor Augen, doch er zwang sich, ein zweites Mal hinzusehen. „Mein Gott, das war ja Tanaka, der japanische Elite-Student von der Universität Kyoto!“, schoss es ihm durch den Kopf, Als er ein weiteres Mal genauer schauen wollte, revoltierte sein Magen, geistesgegenwärtig trat er in den Gang zurück und erbrach sich unter Tränen vor den Regalen.
Читать дальше