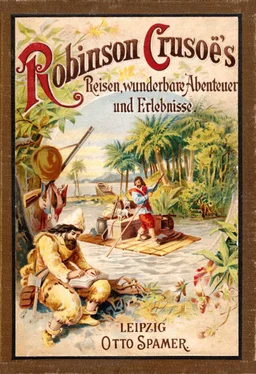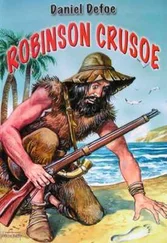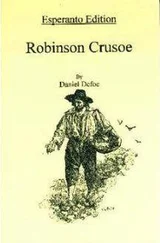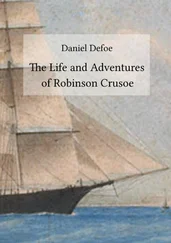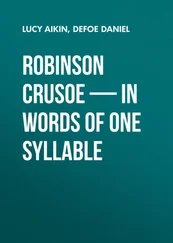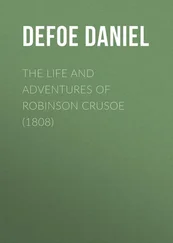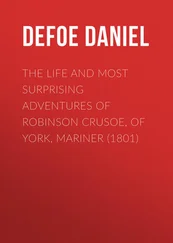Wäre ich in den Verhältnissen geblieben, in welchen ich mich jetzt befand, so hätte ich bis an mein Lebensende ein ruhiges und beschauliches Glück genießen können. Allein in meinem Kopfe tummelten sich tausend hochfahrende Unternehmungen. Dergleichen Pläne sind ja oft das Verderben selbst erfahrener Männer, und ich sollte das auch empfinden.
Als Pflanzer in Brasilien hatte ich zum Nachbar einen Portugiesen aus Lissabon von englischer Herkunft, Namens Wells, dessen Umstände den meinigen ähnlich waren. Zwei Jahre lang hatten wir alle Hände voll zu thun, um nur unsern Lebensunterhalt zu verdienen, aber schon im dritten Jahre ernteten wir Tabak, und im vierten Jahre gedachten wir Zuckerrohr zu bauen. Ich hatte 50 große Rollen Tabak, von denen jede 100 Pfund wog, auf meinem eignen Grund und Boden erbaut und sie für die Rückkehr der Flotte von Lissabon wohl aufbewahrt. Indes fühlten wir recht drückend den Mangel an mithelfenden Armen, und ich wünschte mehr als je meinen flinken Xury zurück, der mir recht gute Dienste hätte leisten können.
Da wir die sämtlichen Arbeiten nicht selbst ausführen konnten, blieben wir mit vielem im Rückstande. Es währte nicht lange, da fühlte ich mich in meiner Lebensweise unbehaglich. Natürlich! Ich hatte mich einer Beschäftigung hingegeben, die meiner Wanderlust gerade entgegenlief. Jetzt sah ich ein, daß mein Vater recht hatte, als er mir den Mittelstand als den glücklichsten angepriesen. »Und dies alles«, sagte ich häufig zu mir selbst, »hättest du leichter in deinem Vaterlande haben können; manche Leiden hättest du dir erspart, wenn du daheim geblieben wärst! Jetzt mußt du nun hier leben, wo kein Freund an deinem Schicksal teilnimmt.«
Während der vier Jahre meines Aufenthalts in Brasilien hatte ich die Landessprache erlernt und ebenso die Bekanntschaft mehrerer Kaufleute in San Salvador gemacht, mit denen ich mich manchmal über meine Jugendschicksale und besonders über die Reisen an der Guineaküste unterhielt. Dabei ließ ich nicht unerwähnt, mit welcher Leichtigkeit man dort durch Austausch von Kleinigkeiten, wie Glasperlen, Spiegeln, Messern, Spielzeug und dergleichen, gegen Goldstaub ein gutes Geschäft machen könne. Besonders aufmerksame Zuhörer hatte ich an jenen Kaufleuten, wenn ich von dem Negerhandel sprach, der damals noch ausschließlich von Spanien und Portugal aus getrieben wurde.
Eines Tages kamen drei jener Kaufleute zu mir, um mir einen Vorschlag zu machen; sie teilten mir mit, sie hätten alle drei gleich mir Pflanzungen, denen es zum besseren Betriebe nur an geeigneten Arbeitskräften fehle. Deshalb wollten sie ein Schiff nach Guinea ausrüsten, nicht etwa um Sklavenhandel zu treiben, sondern um Schwarze aus Afrika zu holen und sie gleichmäßig unter sich zu verteilen. Es sei nur noch die Frage, ob ich als Aufseher des Schiffes mitgehen und den Handel an der Guineaküste leiten wolle. Für die Einwilligung würden sie mich durch einen gleichen Anteil an den Negern entschädigen sowie durch den Vorteil, keine Kosten zu dem Unternehmen beisteuern zu müssen.
Obgleich dieser Vorschlag unrecht war, wie aller Negerhandel, war ich doch so thöricht, darauf einzugehen. Ich stellte nur die Bedingung, daß meine Pflanzung bis zu meiner Rückkehr gut überwacht würde und, falls mir ein Unglück widerführe, demjenigen übergeben werden sollte, den ich als Nachfolger bezeichnete. Zu meinem Universalerben setzte ich den portugiesischen Kapitän ein, unter der Bedingung, daß er die Hälfte meines Vermögens nach England gelangen lassen solle.
Die Ausrüstung des Schiffes ging rasch vor sich; am 1. September 1659, demselben Tage, an welchem ich vor acht Jahren das elterliche Haus verlassen hatte, um mich in Hull einzuschiffen, stachen wir in See. Unser Schiff hatte gegen 120 Tonnen, führte sechs Kanonen und 14 Mann, den Kapitän samt seinem Schiffsjungen und mich eingerechnet. Die Ladung des Schiffes bestand nur aus solchem Tand, der sich am besten zum Handel mit Negern eignet.
Wir steuerten anfangs längs der Küste von Brasilien nordwärts, weil wir beabsichtigten, den 12. Grad nördlicher Breite zu erreichen und dann, wie damals üblich, nach Afrika hinüberzusegeln. Solange wir an der Küste hinfuhren, wurden wir von dem prächtigsten Wetter begünstigt; bei dem Kap St. Augustin verloren wir das Land aus dem Gesicht und steuerten, als wollten wir die Insel Fernando de Naronha erreichen, Nordost bei Nord. Die eben genannte Insel ließen wir aber östlich liegen und passierten nach einer Fahrt von zwölf Tagen die Linie. Bisher hatten wir uns des schönsten Wetters zu erfreuen gehabt, jetzt aber brach ein heftiger Wirbelwind los.
Zwölf Tage hindurch blieben wir ein Spiel der Winde. Dann ließ der Sturm endlich etwas nach; der Steuermann fand, daß wir uns in der Richtung nach der Küste von Guinea oberhalb des Amazonenstromes und nicht weit vom Orinoko befanden. Wir überlegten, was unter diesen Umständen zu thun sei, zumal das Schiff ein Leck bekommen hatte; endlich entschlossen wir uns, nach Barbados zu segeln, indem wir uns weit genug auf offener See hielten, um die Einfahrt in den Mexikanischen Meerbusen zu vermeiden. In vierzehn Tagen konnten wir bei den Karibischen Inseln sein und steuerten deshalb nordwestlich.
Es sollte jedoch anders kommen, als wir dachten. Unter dem 14. Breitengrade erhob sich von neuem ein gewaltiger Sturm und trieb uns weit fort, als plötzlich inmitten aller Schrecknisse der Ruf: »Land! Land!« ertönte. Schon wollten wir sehen, welchem Teile der Welt wir entgegengingen, als ein erneuter heftiger Windstoß unser Fahrzeug auf eine Sandbank trieb.
Die Wogen stürzten schäumend über das Deck, und jeder flüchtete in sein Quartier, um sich vor der Wut des Elementes zu schützen. Der Wind tobte fortwährend heftig, und das Fahrzeug konnte in wenig Minuten zertrümmert sein, wenn es nicht plötzlich umschlug. Am Hinterteil des Schiffes hing unser Boot, sein Steuerruder war zertrümmert und die zerschmetterten Teile tanzten auf den empörten Wellen. Zwar lag noch die Schaluppe an Bord, doch schien es uns unmöglich, dieselbe ins Wasser zu setzen. Die Todesangst zwang uns endlich doch, einen verzweifelten Versuch zu machen, und den vereinten Anstrengungen gelang es, die Schaluppe über Bord zu bringen. Wir sprangen alle hinein und ließen uns – im ganzen elf Personen – von Wind und Wogen treiben, wohin es Gott gefiel.
Wir sahen wohl ein, daß unser Boot bei der hochgehenden See nicht lange aushalten würde. Mit allen Kräften ruderten wir dem Lande zu, aber so schweren Herzens, als ginge es zum Hochgericht; denn wir konnten voraussetzen, daß das Boot, wenn es sich der Küste näherte, von der Macht der Wogen zertrümmert werden würde. So schien es, als ob wir selbst unsern Untergang beschleunigten.
Von welcher Beschaffenheit die Küste vor uns war, ob felsig oder sandig, hoch oder flach – wir wußten es nicht. Der einzige Hoffnungsschimmer, der uns noch winkte, blieb die Möglichkeit, in die Mündung eines Flusses oder eines Meerbusens einzulaufen, wo wir das Wasser ruhiger finden konnten. Allein nichts von alledem, ja, das Land erschien uns, je näher wir kamen, grauenhafter als die See, denn es starrten uns fürchterliche Felsenriffe entgegen. So mochten wir etwa anderthalb Meilen fortgetrieben sein, als eine berghohe Welle hinter unsrer Schaluppe einherrollte, uns mit sicherem Untergang bedrohend; sie stürzte mit solcher Heftigkeit auf unser Boot, daß es augenblicklich umschlug. Wir wurden getrennt und versanken in den Abgrund, Gott um Beistand anflehend.
Obgleich ich gut schwimmen konnte, so vermochte ich mich doch nicht zur Oberfläche emporzuarbeiten, um Atem zu holen, bis endlich die Woge, die mich gegen das Ufer hingerissen hatte, sich zurückzog und mich auf dem Trockenen zurückließ, freilich zum Tode ermattet und außer Atem durch das Wasser, welches ich verschluckt hatte. Ich fühlte noch so viel Geistesgegenwart und Kraft des Körpers, daß ich mich aufraffte und, da ich die Küste nahe vor mir sah, einen Versuch machte, sie zu erreichen, ehe eine andre Welle mich wieder zurückriß. Meine Widerstandskraft erwies sich jedoch dem Elemente gegenüber als zu schwach. Ich sah die See riesengroß, wie einen erbitterten Feind, von neuem gegen mich heranrauschen und ich hatte keine Kraft mehr, ihr zu widerstehen. Das Wasser drang an, ich suchte den Kopf oberhalb zu behalten und schwimmend landeinwärts zu kommen. Doch die Wassermenge begrub mich viele Meter tief, und ich fühlte, wie ich von ihr nach dem Ufer gerissen wurde.
Читать дальше