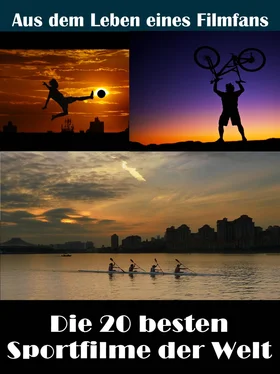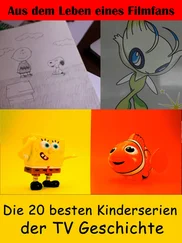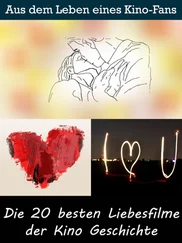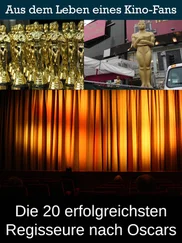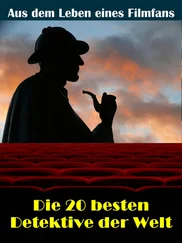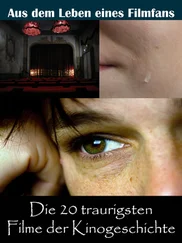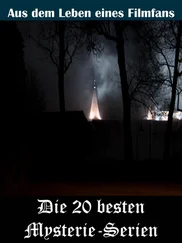Teil 4 ist der einzige Teil, in dem das Lied Take you back von Stallones Bruder Frank nicht vorkommt. Ansonsten taucht es in jedem Teil auf, mitunter in abgewandelter Form (in Teil 3 als Soul, Teil 5 in Rapversion).
Der Name des Trainers Mickey Goldmill ist angelehnt an den des Trainers von Rocky Marciano, Charley Goldman.
Die Stufen, die Rocky während des Trainings emporrennt, und der Platz, auf dem er dann jubelnd die Arme in die Höhe streckt, gehören zum Philadelphia Museum of Art.
Für viele Besucher Philadelphias und Fans der Rocky-Filme gilt es inzwischen als Ritual, ebenso wie Rocky die Stufen des Museums hochzurennen und zu jubeln.
Eine für den dritten Teil angefertigte Bronzestatue von Rocky befindet sich nun vor dem Museum auf einem Parkweg und zeigt den Boxer in Jubel-Pose.
In der deutschen Synchronisation duzt Rocky seinen Trainer Mickey zunächst, um ihn bei einem späteren Besuch bei sich daheim zu siezen.
Rocky bezeichnet sich selbst als Linkshänder (Rechtsausleger), schreibt jedoch mit rechts.
Stallone spielt mit seiner Körpergröße von 1,77 m einen Schwergewichtler, obwohl es bis heute keinen Schwergewichts-Weltmeister von unter 1,80 m Körpergröße gibt und so gut wie keine ranghohen Schwergewichtler.
Stallones deutsche Synchronstimme stammt von Jürgen Prochnow.
Reale Boxer gleichen Namens
„Rocky“ war auch der Name der beliebten italienischstämmigen Boxer Rocky Marciano (1923–1969) und Rocky Graziano (1921–1990). Auch die deutschen, beide 1963 geborenen Boxbrüder Ralf Rocchigiani (als Profi aktiv 1983–1999) und Graciano Rocchigiani (aktiver Boxprofi 1983–2003) erhielten von Presse und Publikum jeweils den Spitznamen „Rocky“.
Der Film basiert hauptsächlich auf dem Boxer Chuck Wepner, teils auch auf George Chuvalo, beides Ex-Herausforderer von Muhammad Ali, die Vorlage für die Figur „Apollo Creed“; der Hintergrund des Protagonisten als Mafia-Geldeintreiber stammt von Rocky Marciano.
„Mit kleinem Etat gedrehte Boxerstory, die zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten wurde. […] Geschickte Mischung aus Action, Realismus und Romantik über den alten amerikanischen Traum, dass einer, der nichts ist, was werden kann.“
– Adolf Heinzlmeier und Berndt Schulz im Lexikon ‚Filme im Fernsehen‘
„Eine typisch amerikanische Geschichte vom ‚Underdog‘, der durch Zähigkeit, Mut und Naivität die soziale Hierarchie auf den Kopf stellt. Nach dem phänomenalen Erfolg des Films blieben Fortsetzungen nicht aus, die allerdings die stimmige Figurenpsychologie und die authentische Milieuzeichnung dieses ersten Films nie mehr erreichten.“
– Lexikon des internationalen Films
Rocky I–V MGM Home Entertainment 1998 (Einzel-DVDs)
Rocky Special Edition. MGM Home Entertainment 2001
Rocky 25th Anniversary Collection. MGM Home Entertainment 2001 (5-DVD-Box mit Rocky I Special Edition und II–V)
Rocky. Gold Edition. MGM Home Entertainment 2004 (Umverpackung der Special Edition)
Rocky Special Edition. Sony Pictures 2006 (2DVDs in Metallkassette mit stark überarbeiteter Bildqualitiät und 3h Specials)
Rocky Anthology (30th Anniversary). Sony Pictures 2006 (6DVD-Box mit der neuen Rocky I Special Edition und Rocky II–V)
Rocky – The Complete Saga. Sony Pictures 2007 (6-DVD-Box mit allen Rocky-Filmen, wobei es sich bei Rocky I um die 2006er Version ohne Bonus-DVD handelt)
Blu-Ray-Disc-Veröffentlichungen
Rocky Sony Pictures 2007
Rocky Balboa Sony Pictures 2007
Bill Conti: Rocky. Original Motion Picture Score. Liberty/MGM-UA Records s.l. s.n., Tonträger-Nr. CDP 7 46081 2/DIDX 300 – Originalaufnahme der Filmmusik unter der Leitung des Komponisten
An jedem verdammten Sonntag
An jedem verdammten Sonntag ist ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1999. Regie führte Oliver Stone, dieser war außerdem am Drehbuch und als Produzent beteiligt.
Deutscher Titel: An jedem verdammten Sonntag
Originaltitel: Any Given Sunday
Produktionsland: USA
Originalsprache: Englisch
Erscheinungsjahr: 1999
Länge: 157 (Director’s Cut) Minuten
Altersfreigabe: FSK 12
Regie: Oliver Stone
Drehbuch: Oliver Stone
Daniel Pyne
John Logan
Produktion: Dan Halsted
Clayton Townsend
Lauren Shuler Donner
Musik: Richard Horowitz
Paul Kelly
Kamera: Salvatore Totino
Schnitt: Stuart Levy
Stuart Waks
Keith Salmon
Thomas J. Nordberg
Das Football-Team der Miami Sharks steckt in der Krise und hat zu Beginn der Story bereits dreimal in Folge verloren – die Play-off-Teilnahme ist in Gefahr. Als dann auch noch Star-Quarterback Jack Rooney sowie sein ohnehin erfolgloser Ersatzmann verletzungsbedingt ausfallen, muss der dritte Quarterback Willie Beamen ran. Er kann die vierte Niederlage in Folge nicht verhindern, steigert sich aber nach anfänglichen Schwierigkeiten und zeigt ungeahnte Qualitäten. Durch seine überhebliche Art bekommt er jedoch schnell Probleme mit den Gesetzmäßigkeiten des Sports.
Sein Auftreten ist geprägt von seiner Herkunft und Problemen mit früheren Coaches, die sein Talent stets verkannten. Beamen ist nicht in der Lage, Demut zu zeigen oder sich für seine Mitspieler zu opfern. Schnell bekommt er auch Probleme mit seiner Freundin Vanessa, die ihn verlässt, und Chefcoach Tony D’Amato, da er dessen Anweisungen missachtet, eigenmächtig Spielzüge ändert und stets die Kollegen verprellt.
D’Amato selbst steht ebenfalls unter starkem Druck, da die neue Teameignerin Christina Pagniacci, die Tochter des verstorbenen Präsidenten und treuen Freundes von D’Amato, lediglich darauf aus ist, den Wert des Teams zu steigern und ihre persönlichen Chancen zu verbessern. Letztendlich liebäugelt sie sogar mit dem Verkauf des Vermächtnisses ihres Vaters, D’Amato weiß, dass er in diesem Spiel keine Rolle mehr spielt, und will sich inmitten seiner Midlife-Crisis beweisen, dass er noch Biss hat.
Derweil hat die Mannschaft ganz andere Probleme, sie verliert ihr letztes Spiel, den Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde und Linebacker Luther „Shark“ Lavay wegen einer Verletzung und die Mannschaft versagt Beamen endgültig die Gefolgschaft. Zudem dopt der betriebsblinde Mannschaftsarzt Harvey Mandrake, der mitunter mehr damit zu tun hat, seine Liebschaften vor seiner Freundin zu verheimlichen, als die Mannschaft umfassend zu betreuen, unter dem Druck des sportlichen Erfolgs seine Schützlinge mit oder ohne deren Einwilligung. So verschweigt er auch aus wirtschaftlichen Interessen „Shark“ und dem Trainer dessen schwere Verletzung und das damit verbundene Risiko. Pagniacci bietet ihm eine Gehaltserhöhung, sollte man „Shark“ im nächsten Jahr zu niedrigeren Konditionen weiterverpflichten können. Als D’Amato das erfährt, entlässt er Mandrake und schlägt, einmal in Rage, gleich noch den Sportreporter Jack Rose nieder, der keine Chance ungenutzt lässt, D’Amatos Niedergang zu dokumentieren.
Vor dem Spiel gegen die Dallas Knights, obendrein das Team mit der besten Verteidigung der Liga, muss sich D’Amato zunächst für seinen Ausrutscher gegenüber Rose rechtfertigen. Seine gelangweilt abgelesene Entschuldigungshymne ist ebenso ein feiner Seitenhieb auf die Gesetze der „sauberen“ Sportwelt, wie die Einstellung, die den neuen Mannschaftsarzt Ollie Powers beim Verteilen von (medizinisch) überflüssigen Kortisonspritzen zeigt. In einer verzweifelten Ansprache versucht D’Amato das zerstrittene Team zu einen und lässt sie von Jack Rooney aufs Feld führen. Dieser hält das Team mit einem Touchdown-Pass und einem – für seine Verhältnisse sehr ungewöhnlich – selbst erzielten Touchdown im Spiel. In der zweiten Halbzeit wechselt D’Amato Beamen ein, der offenbar endlich die Tragweite seiner Führungsrolle erkannt hat. Mit vereinten Kräften können die Sharks das Spiel in letzter Sekunde gewinnen, nachdem ihnen bereits zuvor der entscheidende Touchdown aberkannt wurde.
Читать дальше