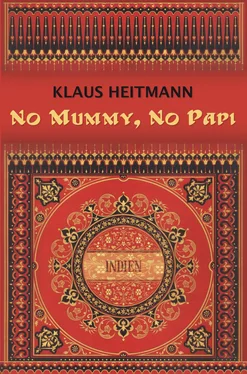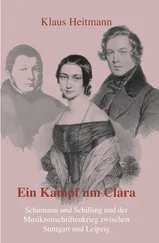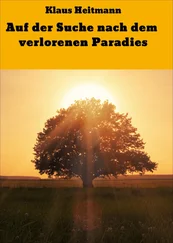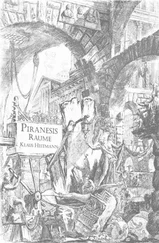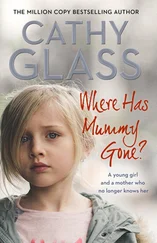In Madras erfuhren unsere Verhältnisse eine unerwartete Wende. Mr. D., der Anwalt, in dessen ich hospitierte, bot uns einen bequemen Bungalow im Garten seines Hauses an, was für uns, die wir bislang nur in Studentenbuden gelebt hatten, eine neue Lebensqualität bedeutete. Das Anwesen lag in einer gutbürgerlichen und ziemlich ordentlichen Vorstadt, deren Straßen nur mit Nummern benannt waren. Mr. D. rief seine wichtigsten Klienten zusammen und stellte mich ihnen feierlich vor. Wir waren Ehrengäste bei herausragenden Feierlichkeiten, etwa der Einweihung einer neuen College-Bibliothek. Wohlhabende indische Familien luden uns in ihre Häuser ein und ließen uns an ihren prachtvollen Festen teilnehmen. Von der Position eines Rechtsreferendars, der in Deutschland mehr oder weniger als Student angesehen wurde und keine Beachtung fand, war ich plötzlich in den Status eines repräsentativen Gastes aus einem fernen Land geraten, mit dem man sich gerne sehen ließ.
Wir konnten die Rolle, die wir in der indischen Gesellschaft zugewiesen bekamen, nicht zuletzt deswegen mitspielen, weil uns das Gehalt eines deutschen Rechtsreferendars den entsprechenden Lebensstil erlaubte. Unser monatliches Budget betrug ein Vielfaches dessen, was die angestellten Anwälte im Büro von Mr. D. verdienten. Es entsprach nach Schwarzmarktpreisen etwa dem Gehalt des obersten Richters des Staates Tamil Nadu. Wir kauften auf der Mount Road ein, wo sich alles traf, was in Madras Rang und Namen hatte, insbesondere bei „Spencers“, einem Kaufhaus im Kolonialstil, in dem schon die Gattinnen der englischen Offiziere und Verwaltungsbeamten eingekauft hatten. Dort trafen sich nachmittags die Damen der indischen Gesellschaft und tranken Tee, während die Bediensteten des Kaufhauses an Hand von Einkaufslisten die gewünschten Waren zusammentrugen und von Trägern zu den schwarzen Ambassador-Limousinen bringen ließen, in denen die Chauffeure warteten.
Auch als Besitzer eines Autos gehörten wir zu den Privilegierten in der Stadt, schon deswegen, weil sich nur die Reichsten überhaupt einen Wagen leisten konnten. Da der Import von Fahrzeugen in Indien grundsätzlich verboten war, mussten zudem auch die Inder, welche sich ein teures Importfahrzeug hätten leisten können, in der Regel einheimische Produkte fahren. Das höchste der automobilistischen Gefühle war dabei jener „Ambassador“, ein auf der Basis eines englischen Nachkriegsmodells gebauter Mittelklassewagen, der technisch ziemlich veraltet war. Unser VW-Bus, der auch nicht gerade das neueste Baujahr hatte, wirkte dagegen wie ein technisches Wunderwerk. Hinzu kam, dass so etwas wie ein Wohnmobil in Indien völlig unbekannt war und in Übrigen alles, was aus dem Westen kam, bewundert wurde. Auf diese Weise trug ein Gefährt, mit dem man in Europa in der sozialen Hierarchie allenfalls auf der mittleren Ebene der Camping-Urlauber rangieren konnte, dazu bei, uns ein besonderes Ansehen zu verleihen. Nach wenigen Wochen war der Wagen auf der Mount Road allgemein bekannt.
Schließlich bekamen wir auch noch eine Dienerin. Sie wurde uns von Mr. D. vermittelt, der auch die Arbeitsbedingen festlegte - umgerechnet zwei Dollar pro Monat für die Erledigung aller anfallenden Arbeiten im Haus, wofür fünf Stunden am Morgen und weitere ein bis zwei Stunden am Abend veranschlagt wurden. Die junge Frau hieß Liz und lebte einige Straßen weiter in einer wilden Siedlung mit niedrigen Hütten, die aus Palmblättern gebaut waren. Da uns der Lohn absurd vorkam, wollten wir Liz das Doppelte zahlen. Mr. D. bat uns aber dringend, davon abzusehen, weil wir damit Unruhe unter den Dienern der Nachbarschaft erzeugen würden. Wir einigten uns schließlich darauf, dass wir Liz gelegentlich einen Sari schenken. Als wir ihr den ersten Sari gaben, zeigte sie das Geschenk allerdings sofort den Dienern in der Umgebung, mit der Folge, dass Mr. D. seinen zwei Dienerinnen ebenfalls Saris und seinem Diener sowie dem Chauffeur das entsprechende männliche Kleidungsstück, einen Lunghi, kaufen musste, was auch schon eine kleine Revolution war.
Im Laufe der Zeit nahmen wir immer mehr am Leben der indischen Oberschicht teil, ein Bevölkerungsteil, der sich von der Mehrheit schon durch ihre helle Hautfarbe unterschied. Vieles drehte sich in diesen Kreisen um Geld, Konsum und Familie. Man sprach vor allem darüber, wer westliche Waren besaß und was sie gekostet hatten, wie die neuesten amerikanischen Filme waren und wer wen mit welcher Mitgift geheiratet hatte oder demnächst heiraten werde. Uns gegenüber war man sehr offen und weihte uns selbst in Familiendetails ein. Einmal kam ein junger Anwalt aus dem Büro freudestrahlend zu mir und berichtete, er habe gerade erfahren, dass er nach dem Beschluss seiner Familie ein bestimmtes Mädchen heiraten werde. Er wollte mir die junge Dame vorstellen. Ich hatte aber schon vor ihm erfahren, dass und wen er heiraten werde.
Häufig besuchten wir den „Moore Market“, wo man so ziemlich alles kaufen konnte, was Indien zu bieten hatte. Reichlich spontan und ohne die Folgen zu bedenken, legten wir uns hier einen jungen Affen zu. Er war so klein, dass er in zwei Hände passte. Wir hegten und pflegten ihn, so gut wir es konnten. Er war aber, was wir nicht wussten, noch viel zu klein, um von seiner Mutter getrennt zu leben. Mangels einer wärmenden Mutterbrust und wohl auch aus Verzweiflung zog er sich schon bald eine Lungenentzündung zu, gegen die der Tierarzt, den wir verzweifelt mehrfach aufsuchten, nicht ankam. Er wurde immer apathischer und verstarb nach kurzer Zeit. Wir stellten fest, dass uns das kleine Wesen in der kurzen Zeit ans Herz gewachsen war und waren sehr betroffen, es wieder verlieren zu müssen.
Von der indischen Geisteswelt, die Europa so faszinierte, war in den Kreisen der indischen Gesellschaft, in denen wir verkehrten, wenig zu spüren. Auffällig war nur, welche wichtige Rolle man den Sternen gab. Vor allen wesentlichen Handlungen und Entscheidungen prüfte man, ob und wann die Auspizien dafür gut waren. Das führte unter anderem dazu, dass eine Hochzeit, zu der wir und tausend weitere Gäste eingeladen waren, nachts um drei Uhr stattfinden musste. Als ich einmal an einem Gerichtstermin teilnahm, ließ der Richter, dessen Astrologe errechnet hatte, dass der Zeitpunkt des offiziellen Sitzungstermins „unauspiziös“ war, dutzende von Anwälten stundenlang warten, bis die Sterne in der richtigen Position waren. Überhaupt waren nach indischer Vorstellung überall merkwürdige Mächte im Spiel. Ein gestandener Anwalt aus dem Büro von Mr. D etwa kam, kurz nachdem er die Kanzlei zum Mittagessen verlassen hatte, wieder er ins Büro. Auf meine Frage, warum schon wieder zurück sei, antwortete er, dass vor ihm gerade eine Person mit einem Bündel Holz auf dem Kopf über die Strasse gegangen sei, was Unglück bedeute. Er sei zurückgekommen, um ein paar Minuten im Büro abzuwarten. Wenn er danach erneut losgehe, sei das Unglück vorbei.
Meine Tage verbrachte ich, nicht zuletzt der Klimatisierung und der guten Ordnung wegen, zu einem erheblichen Teil im deutschen Kulturinstitut. Es war in Indien nicht, wie in allen anderen Ländern, nach der deutschen Vorzeigefigur Goethe benannt, der angesichts der mangelnden Realitätsnähe ihrer Artefakte nicht nur Lobendes über die indische Kultur gesagt hatte, sondern nach einer Person mit dem schönen deutschen Allerweltsnamen Max Müller, mit dem wiederum die Deutschen wenig anfangen können. Damit versuchte man, den großen deutschen Indologen dieses Namens zu repatrisieren, der im 19. Jahrhundert in England Karriere gemacht hatte. Im Max Mueller Bhavan, wie die Institute in Indien heißen, beschäftigte ich mich stärker als je zu Hause mit der Kultur und Literatur, für die Goethe steht. Die „indische“ Perspektive, aus der ich nun auf meine Heimat sah, hatte mich vor eine Fülle von Fragen über meine eigene Kultur gestellt. Zugleich verlor meine engere Heimat aus der Ferne viel von ihrer besonderen Natur und wurde zu einem nur noch wenig unterscheidbaren Teil des Kulturraumes Europa.
Читать дальше