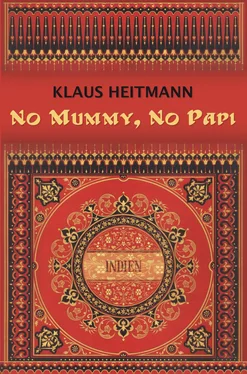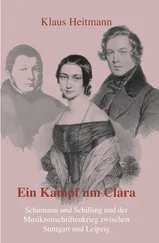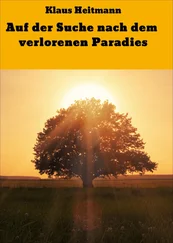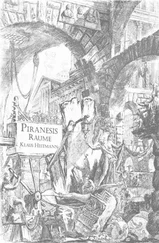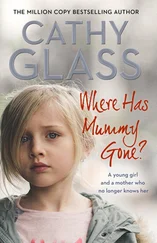Einer der Leute des mittleren Managements von Mico sollte für uns und Raju noch bedeutsam werden. Es handelte sich um Mr. Sheshadri, einen gelernten Journalisten, der die Abteilung Public Relations leitete. Als solcher gab er das Mitteilungsblatt der Firma „Mico Wheel“ heraus, in dem er kundige und gut geschriebene Aufsätze zu allen möglichen Themen veröffentlichte. Mr. Sheshadri war einer jener eloquenten Brahmanen, mit denen man sich über alles unterhalten konnte. Er war Mitte Dreißig, weit gereist, höchst belesen, an allem interessiert und über alles informiert, was in der Welt passierte oder irgendwann einmal passiert war. Als wir ihm erzählten, wir hätten zuletzt in Berlin gewohnt, verblüffte er uns mit der Kenntnis von Straßennamen und allen möglichen sonstigen Details der Stadt, obwohl er noch nie dort gewesen war. Mr. Sheshadri lud uns in sein Haus ein, das er mit seinen Eltern samt einer Reihe von Hausangestellten bewohnte. Das Haus hatte sein Vater, ein pensionierter Arzt, der offensichtlich einmal gut verdient hatte, in einem Villenviertel der Stadt gebaut. Vom Wohlstand seiner aktiven Zeit zeugte nicht nur das großzügige Anwesen, sondern auch ein alter, amerikanischer Wagen der Marke Buick, der völlig verstaubt in der Garage stand. Diese Herkunft hinderte Mr. Sheshadri aber nicht, großen Anteil an Rajus Schicksal zu nehmen, das er außerordentlich faszinierend fand. Raju wiederum spürte das Wohlwollen und Interesse, das ihm Mr. Sheshadri entgegenbrachte und zeigte sich ihm gegenüber von seiner besten Seite. Großzügig bot uns Mr. Sheshadri an, bei der Gestaltung von Rajus Zukunft behilflich zu sein, was später noch Bedeutung erlangen sollte.
Bei unserem Besuch im Hause von Mr. Sheshadri kamen wir auch auf Musik zu sprechen. Sachkundig erklärte er uns die Faktur der klassischen indischen Musik, deren Rhythmik und Harmonie so überaus komplex und für unsere Ohren so verwirrend wie die meisten Ausformungen der indischen Hochkultur ist. Seine Frau spielte uns dazu einiges auf der Veena, dem südindischen Gegenstück zur Sitar vor, was Raju mit großem Interesse verfolgte. Danach legte Mr. Sheshadri auf seiner Stereoanlage, auf die er besonders stolz war - ein Kollege hatte sie ihm aus Japan mitgebracht -, eine Schallplatte mit Musik von Mozart auf. Da man in der europaklassikfreien Zone Indien solche Musik nicht zu hören bekommt, erschien mir dies wie ein wahres Wunder. Raju hörte verwundert zu, konnte mit dieser Musik allerdings nicht viel anfangen. Spätestens nachdem ich auch noch Mr. Sheshadris überquellende Bibliothek, wo die Bücher in Doppelreihen standen, gesehen hatte, war klar, dass wir in vieler Hinsicht auf der gleichen Wellenlänge lagen.
Mr. Sheshadri machte mich im Übrigen auch darauf aufmerksam, dass es in Bangalore einen Antiquar gebe, der recht ausgefallene Bücher habe. Er begleite mich zu dem kleinen Laden in der Innenstadt, in dem in chaotischer Unordnung alle möglichen Bücher gestapelt lagen. Ich fischte aus den verstaubten Haufen unter anderem eine alte, englische Ausgabe des Hauptwerkes von Shankara, dem großen indischen Philosophen vom Anfang des 9. Jh. nach Chr., der die spezifisch indische Weltsicht auf den Punkt brachte, wonach die tatsächliche Welt nur Schein, die geistige Welt aber wirklich sei. Mit dieser Vorstellung, die dem Denken Platons ähnelt, das sich wiederum im Christentum niedergeschlagen hat, legte Shankara die theoretische Grundlage für jene Geringschätzung der Tatsachen, die es den Indern mitunter noch heute erschwert, sich den Problemen dieser Welt zuzuwenden. Die Ausgabe war Teil der monumentalen Edition der „Sacred Books of the East“, die so etwas wie die intellektuelle Ergänzung des politischen Weltmachtanspruchs der Engländer war. Sie wurde Ende des 19. Jh., als sich das Empire auf seinem Höhepunkt befand, von Max Müller herausgegeben, der seine große englische Karriere als vergleichender Religionswissenschaftler mit der Herausgabe des Rigveda, des ältesten und grundlegenden Religionstextes Indiens, begann, welche im Auftrag der East-India-Company erfolgte. Eine weitere bemerkenswerte Entdeckung war die - äußerst seltene - erste Ausgabe von H.G. Wells Erstlingsroman „Die Zeitmaschine“ aus dem Jahre 1895, die ein englischer Verwaltungsbeamter nach Indien verschleppt haben mochte. Im Mittelpunkt dieses ersten Science-Fiction Romans der Moderne steht eine Maschine, mit deren Hilfe man sich in eine andere Zeit und Welt versetzen kann. Der Held gelangt darin in eine Gesellschaft, in welcher die Klassenunterschiede auf die Spitze getrieben sind, was merkwürdig auf unsere Situation zu passen schien.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.