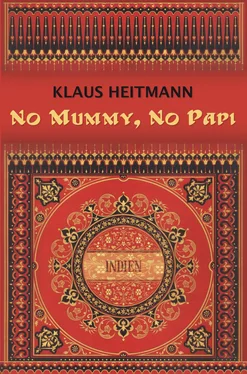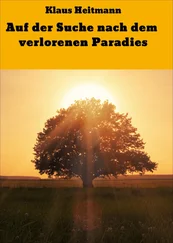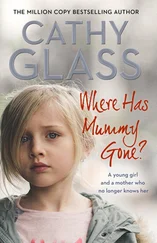Um unseren Weekend-Ausflug komplett zu machen, besuchten wir noch die prachtvollen Gärten des Maharadschas. Man hat sie geschickterweise unterhalb eines großen Dammes angelegt, mit dem man das Wasser des Kauvery-Flusses, der Lebensader von Karnataka und im Übrigen auch von Tamil Nadu, aufstaute, um damit die Stadt Mysore und die ganze Gegend zu versorgen. Als Nebenprodukt konnte man damit auch die Gärten bewässern und alle möglichen Wasserspiele betreiben einschließlich einer gewaltigen Fontäne, die, den Druck des Stausees nutzend, weit in die Höhe schoss. Wir erlaubten uns mitten in den Gärten des Maharadschas unter den großen Bäumen zu speisen. Während Judi das Mahl bereitete, kühlten sich Raju und ich in den Wasserspielen. An diesem Sonntag waren auch viele wohlhabende Inder mit ihren Ambassadors unterwegs, die meist ziemlich voll gestopft waren - aus einem der fünfsitzigen Wagen kletterten nicht weniger als zehn Personen heraus. Unser geräumiges Gefährt, das nur mit zwei und, was die Platzverdrängung betrifft, einer weiteren allenfalls halben Person besetzt war, war für sie eine Sehenswürdigkeit, zumal in Indien Fahrzeuge mit Küche, Toilette, Dusche und Betten völlig unbekannt waren. Mehrere Personen kamen, um unseren Wagen zu besichtigen und baten um die Erlaubnis, ihn fotografieren zu dürfen, was Raju natürlich mächtig stolz machte.
Anschließend ging es durch ausgetrocknete karge Landschaften wieder zurück nach Bangalore, wo uns der Koch, obwohl wir viel früher ankamen als angekündigt, schon mit einem gut bürgerlichen deutschen Mahl erwartete. Raju war sichtlich erfreut, wieder „zu Hause“ zu sein. Er plauderte mit den Dienern, denen er sich zugehörig fühlte. Gleichzeitig genoss er, dass er von diesen der Herrensphäre zugeordnet wurde. Abends waren noch einmal heimische Brettspiele angesagt. Raju entwickelte eine Vorliebe für Halma, das ein gewisses strategisches Denken verlangt.
Die zweite Woche unseres Aufenthaltes in Bangalore konnten wir nicht mehr in „unserem“ gastlichen Haus verbringen, da es anderweitig belegt war. Wir wurden im Gästehaus der Fa. Mico untergebracht, das sich in einem Viertel am Rande der Stadt befand, das mit seinen prächtigen Villen den Wohlstand der indischen Mittelschicht besonders anschaulich spiegelte. Das Gästehaus war zwar modern und zweckmäßig eingerichtet, ihm fehlte aber ein Garten und überhaupt der familiäre Charakter. Eine kleine, exotisch schöne, fröhliche Tamilin versorgte uns und das Haus. Sie bereitete auch die Mahlzeiten, wobei sie sich um europäischen Geschmack bemühte, diesen aber meist verfehlte.
Während Judi und Raju den Tag im Gästehaus oder in der Stadt verbrachten, hielt ich mich bei der Fa. Mico auf. Schon beim Betreten des Firmengeländes war man in einer anderen Welt. Statt des Durcheinanders, das sich bis unmittelbar vor die Tore der Firma ausbreitete, herrschte hier deutsche Ordnung. Sie wurde allerdings in einer Weise zelebriert, die man in Deutschland selbst kaum finden dürfte. Gepflegte Rabatten umgaben die Verwaltungsgebäude, nirgends lag ein Gegenstand, der nicht dort war, wo er hingehörte. Man war offensichtlich darum bemüht, der indischen Neigung zum Chaos einen überdeutlichen Kontrapunkt entgegenzusetzen. Ich wurde als der „Gentleman from Germany“ äußerst zuvorkommend behandelt. Für die Erfüllung meiner Wünsche und Bedürfnisse stand immer ein Angestellter bereit, der mir mit der größten Ehrfurcht begegnete. Er begleitete mich selbst noch auf dem Gang zu „Officers Toilet“. Für mich zuständig war ein Sekretär, dem wiederum allerhand Untersekretäre zur Verfügung standen, die vor ihm eine große Bandbreite von Unterwürfigkeitsgesten zeigten. Der Mann neigte angesichts der indischen Malaise zu schwermütigen Spekulationen. Irgendwann zog er einmal einen Satz von Schopenhauer hervor, dessen Pessimismus wahrscheinlich seiner Seelenlage entsprach. Der Sekretär schickte mich zu den verschiedenen Abteilungen vom Marketing über den Verkauf bis zur Fertigung. Dabei lernte ich unter den höheren Angestellten der Firma, mit denen ich ausschließlich zu tun hatte, eine Menge blitzgescheiter und sehr eloquenter Leute kennen. Sie kamen so gut wie ausschließlich aus den hellhäutigen obersten Kasten. Eine Firma wie Bosch konnte sich offensichtlich die besten Leute aus dem großen Reservoir intelligenter und gut ausgebildeter Inder aussuchen.
Die Gespräche drehten sich immer um die Probleme, welche die unternehmerische Tätigkeit in Indien so sehr erschweren. Man beklagte den notorischen Devisenmangel, der daraus resultierte, dass sich das Land in staatssozialistischer Weise vom kapitalistischen Weltmarkt abschottete und daher über keine frei konvertierbare Währung verfügte. Dies führe, wie man mir berichtete, absurderweise etwa dazu, dass Mico Komponenten, welche man von der deutschen Mutterfirma benötigte, über die kommunistische Tschechoslowakei bezog, weil man dort über ein Devisenkontingent verfügte, aus politischen Gründen aber auch indische Rupien als Zahlungsmittel annahm. Eine erhebliche Erschwernis sei die Unzuverlässigkeit der Arbeiter. Sie fehlten nicht nur an den zahlreichen offiziellen Feiertagen, die das Land den verschiedenen religiösen Gruppierungen zugestand. Sie kämen, meist ohne vorherige Ankündigung, auch dann nicht zur Arbeit, wenn ihnen lokale oder familiäre Ereignisse und Feste wichtiger schienen. Hinzu komme das wenig entwickelte Konsumdenken bei der Masse der Bevölkerung. Diese neige, einer tief verwurzelten indischen Haltung entsprechend, dazu, sich mit dem zufrieden zu geben, was man habe oder was schon immer da oder eben nicht da gewesen sei. An die Vorsorge für die Zukunft zu denken, sei einfachen Menschen ziemlich fremd. Viele Arbeiter kämen daher nur, wenn sie Geld zur Deckung des aktuellen Bedarfs brauchten. Das paradoxe Ergebnis sei, dass sie umso unzuverlässiger seien, je mehr sie verdienten. Mico habe deswegen das kostenlose Mittagessen eingeführt, da dies einen aktuellen Bedarf bediene. Danach habe sich die Anwesenheitsrate tatsächlich merklich verbessert. Der indischen Neigung zu abstrakten Spekulationen entsprechend landete man bei diesen Diskussionen meist in einer allgemeinen Erörterung der verschiedenen Sozial- und Wirtschaftsysteme, insbesondere darüber, ob der Weg zwischen kapitalistischer und sozialistischer Marktwirtschaft, den Indien praktizierte, seiner Entwicklung förderlich oder eher hinderlich war. Manch einer der intelligenten Herren glaubte dabei, die Lösung der indischen Probleme sei am ehesten von einem starken Mann zu erwarten, wobei man sich denselben, möglicherweise auch um mir zu schmeicheln, ausgerechnet nach Art des deutschen Superhelden Hitler vorstellte, der in Indien als Feind der Engländer mit ganz anderen Augen als bei uns gesehen wird. Ich fand mich bei all diesen Diskussionen merkwürdigerweise in der Rolle dessen, von dem man erwartete, dass er in der Lage sei, in diesen Fragen einen Erkenntnisgewinn zu vermitteln.
Nach den Höhenflügen in die abstrakte Welt der Sozial- und Wirtschaftsmodelle ging es nach Dienstschluss wieder hinab in die konkreten Niederungen am entgegen gesetzten Ende der sozialen Skala. Die Fragen hier waren freilich nicht weniger grundsätzlicher Natur. Da es in unserer Bleibe keine Spiele gab, war abends Unterricht angesagt. Wir stellten Raju zunächst etwas komplexere Additions- und Subtraktionsaufgaben. Losgelöst von einem konkreten Kontext tat er sich recht schwer, zumal er keine abstrakte Vorstellung vom Dezimalsystem hatte, also nicht wusste, dass sich bei einer Addition oder Subtraktion von 10-er Einheiten die Ziffer am Ende einer Zahl nicht verändert. Er arbeitete mit einem offenbar selbst gebastelten Fünfersystem, das von den Fingern einer Hand ausging. Dabei nahm er, um auf die für ihn „handhabbaren“ 5-er Einheiten zu kommen, die nötigen Subtraktionen vor und rechnete die entsprechenden Beträge nach Abschluss der 5-er Operationen wieder hinzu. Bei komplexeren Rechnungen verlor er aber leicht die Übersicht über seine Zwischenrechnungen, weswegen er Papier und Bleistift hinzuzog. Später gingen wir zum Multiplizieren und Dividieren über, wo er mit seinem System noch viel schneller hängen blieb. Anders als beim Malen, wo er sich lange in die Arbeit an einem Bild vertiefen konnte, war seine Geduld bei abstrakten Problemen dieser Art bald erschöpft. Tausendmal wiederholte er die Fragestellung, als habe er sie gleich nach dem Hören wieder vergessen, wobei sicher auch sprachliche Verständnisprobleme eine Rolle spielten. Bald konnte er kaum mehr still sitzen, machte allen möglichen Fez und zeigte seinen unbegrenzten Einfallsreichtum beim Fratzen- und Schnutenziehen. Zum Ausgleich gab es vor dem Schlafengehen dann eine große Balgerei und Kitzelei. Zum ersten Mal in seinem Leben schlief Raju hier in einem eigenen Bett, was er sichtlich genoss. Es war ein richtiges Bett mit vier Füßen und einem Moskitonetz darüber.
Читать дальше