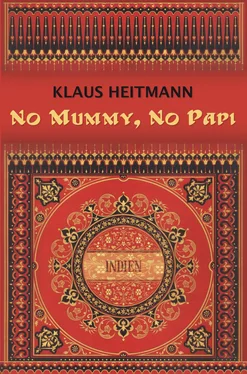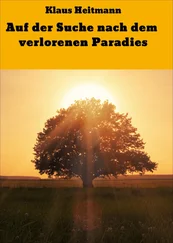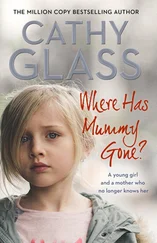Wie konnte Raju, musste man sich fragen, in einer solchen Gesellschaft ohne Familie zurechtkommen?
Wir besichtigten in Mysore, das für indische Verhältnisse einen ziemlich geordneten Eindruck machte, noch einige weitere Beispiele dynastischer Prachtarchitektur. Raju, der ähnliches aus Madras kannte, war auch davon nicht sonderlich beeindruckt. Ein Führer wies uns darauf hin, dass in der Nähe ein Naturreservat sei. Dort bekomme man bei einem Elefantenritt allerhand wilde Tiere, darunter Tiger und Büffel, zu sehen. Dies sei etwas, was Raju sicher interessieren würde. Wir beschlossen daher, das Abenteuer zu suchen und eine Landpartie nach dem Muster der Maharadschas zu machen. Vor unseren Augen standen dabei natürlich die Bilder des Filmes „African Safari“, den wir ein paar Tage zuvor gesehen hatten.
Das Reservat lag am Fuße der Nilgiri-Berge, in denen sich die Western Ghatts, die Bergkette, welche sich die ganze indische Westküste entlang zieht, mit über 2600 Metern zu ihren höchsten Höhen erheben. In das Reservat führte eine Straße, die sich endlos durch ein zerklüftetes Waldgebiet schlängelte und immer schlechter wurde. Schließlich war sie nur noch ein einfacher Weg. Abgesehen von der totalen Einsamkeit - jemand anderes als wir schien nicht auf die Idee zu kommen, das Reservat zu besuchen - ließ das Abenteuer auf sich warten. Der Wald hatte wenig von dem, was man sich unter einem saftigen tropischen Dschungel vorstellt. Er bestand im Wesentlichen aus Laubbäumen, deren Blätter in dieser Saison vertrocknet und weitgehend abgefallen waren. Dementsprechend sah er aus, als sei er von einer verheerenden Krankheit befallen. Einzig die riesigen Bambusgebüsche, welche die tiefen Flussschluchten überspannten, erinnerten daran, dass wir uns in tropischen Gefilden befanden. Wilde Tiere suchten wir vergebens. Ranger, die wir danach befragten, bedeuteten uns, dass sie wegen der Trockenheit auf die andere Seite des Parks gezogen seien, die im Staat Tamil Nadu liege. Dort würden wir sicher welche sehen. Wir drangen daher in der beginnenden Dämmerung weiter in den Wald vor, bis wir tief unten in einem Tal an die Grenze zwischen den Bundesstaaten Tamil Nadu und Karnataka kamen, wo es mit Schlagbäumen und Kontrollposten wie bei einer Staatsgrenze zuging. Irgendwann durften wir nur noch in Begleitung eines bewaffneten Soldaten weiter fahren, wofür wir einen nicht eben bescheidenen Obolus zu errichten hatten. Da der Mann kein Wort Englisch sprach, musste Raju dolmetschen. Er zeigte sich dabei, wiewohl er die Sprache beider Seiten nicht beherrschte, recht erfinderisch. Spätestens jetzt schien Abenteuer angesagt. Angestrengt hielten wir in der beginnenden Dämmerung Ausschau nach wilden Tieren, für deren Abwehr wir die bewaffnete Macht benötigen würden. Gelegentlich sahen wir ein Schild, das vor Elefantenpassagen warnte. Ansonsten sichteten wir nur ein paar Pfauen, die man im Norden überall sieht, und Affen, für deren Anblick man in Indien nicht in ein abgelegenes Reservat fahren muss. Raju, der sich mit Affen auskannte, warf Steine nach ihnen, worauf sie sich in rasendem Tempo durch die Baumwipfel schwangen. Von dort sprangen sie aus großer Höhe auf die Enden von Bambusstangen, die sich dadurch weit in die Tiefe eines Bachbettes bogen, um anschließend wieder in die Höhe zu schnellen. Das war immerhin so rasant, dass man es wild life nennen konnte. Raju und ich versuchten es den Affen nachzumachen und auch in den Bambusstangen zu schaukeln. Aber da wir nicht aus Baumwipfeln springen konnten, kamen wir nicht mal in die Nähe der Bambusrohre, die hierfür dick genug gewesen wären. Das kleinere Bambusgebüsch, das ihnen vorgelagert war, erwies sich als so stachlig, dass wir bald ziemlich verkratzt aufgaben. Raju inspirierte dies später zu einem Bild, in dem er dieses Dschungelabenteuer festhielt. Höhepunkt des wilden Tierlebens war schließlich eine Herde von spotted dear, Rehen mit hellbraunem Fell, das recht malerisch mit weißen Punkten besetzt ist. Die Tiere, wohl vierzig an der Zahl, schauten uns eine Weile verwundert an. Als wir uns auf sie zu bewegten, flüchteten sie. Richtig wilde Tiere bekamen wir nicht zu sehen. Auf dem Hintergrund von „African Safari“ konnte all das natürlich weder uns noch Raju sonderlich überzeugen.
Den Abend verbrachten wir neben einem Touristenbungalow, wo wir unter den Augen der neugierigen Dorfbevölkerung das köstliche Mahl einnahmen, das der Koch für uns eingepackt hatte. Seit langer Zeit nächtigten wir wieder einmal in unserem Wagen. Raju schlief, gegen die Kühle der Nacht gut in Decken verpackt, vorne auf der Sitzbank, was ihm offensichtlich großes Vergnügen bereitete.
Am nächsten Morgen fragten wir bei der Reservatsverwaltung, wo denn nun Wild-Tiere zu sehen seien. Ein Ranger führte uns zu einem Platz, wo wir sicher Tiger beobachten könnten. Dort angekommen war von den Raubkatzen aber weit und breit keine Spur. Der Ranger deutete auf eine Stelle am Boden und meinte, gestern habe hier ein Tiger gelegen. Unter diesen Umständen verzichteten wir auf den geplanten Wild-life-Elefantenritt, bei dem wir vermutlich nur weitere Stellen gesehen hätten, wo gestern wilde Tiere gewesen waren. Es blieb dabei, dass es bei unserer Landpartie am Angriff eines zähnefletschenden Tigers fehlte - wenn man mal von der geistigen Begegnung mit dem „Tiger of Mysore“ absieht.
Zurück in Mysore setzten wir unser Kulturprogramm fort. Wir besuchten die Chamundi hills, die sich gleich neben der Stadt auf über 1000 Meter erheben und die, wenn man nicht, wie wir, mit dem Auto hinauffährt, über 1000 Stufen zu erklimmen sind. Von den Hügeln, die zu den heiligsten Bergen Südindiens gehören, hat man einen umwerfenden Blick auf die Stadt, ihre Paläste und allerhand sonstige Prachtgebäude. Hier besiegte nach der Sage eine Göttin mit dem Namen Chamundi in einer wilden Schlacht einen jener zahlreichen Dämonen, welche die Hindumythologie bevölkern. Diese Kreaturen erscheinen den Menschen in Indien noch heute gefährlich und können nach ihrer Vorstellung selbst den Göttern ziemlich lästig werden. Da die Göttin mit ihrer Tat das Gebiet um die heutige Stadt Mysore, das der Dämon einmal beherrscht und tyrannisiert hatte, befreite, baute man ihr hier oben einen schönen Tempel mit einer prachtvollen Eingangspyramide. Als wir uns demselben näherten, fand dort gerade eine Zeremonie statt. Die gedrungene schwarze Statue der Göttin, die von bunter Kleidung und Blumenbändern fast ganz zugedeckt war, wurde, begleitet von greller Musik, in feierlicher Prozession um den Tempel getragen und durch eines seiner prachtvollen silbernen Portale wieder zurück in das Allerheiligste gebracht. Raju, der solche Zeremonien sicher schon oft erlebt hatte, beobachte alles mit großem Ernst.
Von Chamundis Tat profitierte nicht zuletzt das Geschlecht der Maharadschas von Mysore, da erst so die Voraussetzungen dafür geschaffen wurden, dass sie ihre Herrschaft über das Territorium etablieren konnten. Chamundis Tempel ist daher auch das Hausheiligtum der Herrscherfamilie. Krishnaraja Wodeyar IV. wusste die Hügel aber nicht nur unter dynastisch-spirituellen Gesichtspunkten zu schätzen. Er hatte sich hier nach all den anderen Palästen noch Ende der 30-er Jahre in schönster Aussichtslage einen dringend benötigten ansehnlichen Sommerpalast gebaut, ebenfalls im indo-sarazenischen Stil. Ehrfurchtsvoll berichtete man, dass der Mann, der als Philosoph auf dem Thron galt, seine hochgeistigen Studien hier auf der Höhe über seiner prächtigen Hauptstadt betrieben habe.
Auf dem Weg zurück in die Stadt gab es noch tierische Höhepunkte. Zunächst passierten wir einen außerordentlichen Nandi-Bull, das Reittier Shivas, dem in den Tempeln für diesen großen Gott regelmäßig ein Pavillon gegenüber dem Allerheiligsten gewidmet ist. Mit fünf Metern Höhe und acht Metern Länge ist der Bulle von den Cahmundi hills der drittgrößte in ganz Indien. Der Auftrag für die Erstellung des Kolosses, der vor dreihundert Jahren in einem Stück direkt aus dem Felsen geschlagen worden war, kam von einem Maharadscha der Familie Wodeyar, in der man schon damals groß dachte. Derselbe veranlasste auch den Bau der tausend Stufen, die auf den Berg hinauf führen. Schließlich gab es auch noch wild life. Zwei Mungos huschten über die Straße. Da die kleinen Raubtiere nicht einmal vor Giftschlangen Angst haben, kann man sie als wilde Tiere bezeichnen.
Читать дальше