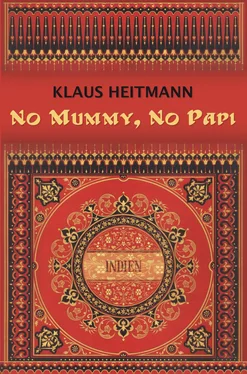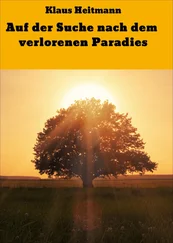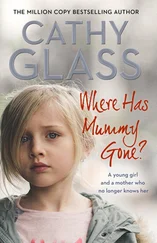Schließlich gab es noch diejenigen, die das Abenteuer einer Reise in ein Land suchten, das unendlich weit entfernt schien. Die Fahrt nach Indien war nicht nur die längste Landreise, die man vom Westen Europas seinerzeit auf eigene Faust unternehmen konnte. Es war auch die Reise, mit der man sich am weitesten von den gewohnten Lebensverhältnissen zu entfernen schien. Diese Menschen faszinierte der Gedanke, die Welt aus einer fernen, völlig anderen Perspektive betrachten zu können. Zu dieser Sorte von Indienreisenden gehörten wir. Die Reise nach Indien sollte im Übrigen am Anfang unseres Familielebens stehen.
Wir hatten im Sommer 1970 in Berlin geheiratet. Mitte August begaben wir uns mit einem älteren VW-Bus, den der Vorbesitzer in liebevoller Eigenarbeit zu einem mobilen Heim ausgebaut hatte, auf die lange Fahrt nach Osten. Wir reisten durch den Balkan, durchschifften den Bosporus und das Schwarze Meer bis Trabzon, erkletterten von dort auf verschlungenen Wegen die Höhen Anatoliens und fuhren durch die endlosen, sommergelben Hochsteppen Vorderasiens. Im Osten der Türkei passierten wir den majestätisch aus der Hochebene aufragenden Berg Ararat, wo nach der Sage Noa's Arche gelandet sein soll, was nach christlich-jüdischer Vorstellung so etwas wie eine zweite Chance für das junge Menschengeschlecht nach einem misslungenen Anfang war. Es folgten die weiten, leeren Hochebenen des Iran und die Wüsten Afghanistans, wo sich die Berggirlanden kulissenartig endlos in die Tiefe staffelten, um schließlich in die gigantischen Ausläufer des Hindukusch überzugehen.
Mit uns zog eine Karawane westlicher Indiensucher, meist abgerissene junge Leute und Aussteiger, die dem Traum von einem Leben ohne westliche zivilisatorische Vorgaben und Zwänge nachhingen. Da es praktisch nur eine Route in das Land der gemeinsamen Sehnsucht gab, traf man sich unterwegs immer wieder und tauschte mit Anreisenden und Rückkehrern Erfahrungen aus. Schon in Westpersien erfuhr man so, in welchem Lokal man in Nepal den besten Kuchen bekam. Abends bildete man Wagenburgen, zündete ein Lagerfeuer an und philosophierte unter einem Himmel, der in einer Weise von Sternen übersät war, welche man in unseren Breiten nicht kennt, über die Probleme der Welt und des Lebens. In Indien verliefen sich die Orientabenteurer dann in alle Richtungen. Den einen oder anderen traf man an den Stationen wieder, an denen sich Reisende zusammenzufinden pflegen, an Bahnhöfen, in bestimmten Hotels oder an den großen Sehenswürdigkeiten. Dann berichtete man darüber, was man inzwischen erlebt und was man über das Schicksal anderer Mitreisender erfahren hatte.
Der Weg nach Osten war eine Reise in die Ferne und zugleich zu sich selbst. Mit jedem Kilometer entfernte man sich innerlich von der Welt des Westens. Schritt für Schritt verschoben sich die Lebenskoordinaten. Das Leistungs- und Sicherheitsdenken, welches das westliche Empfinden in so hohem Maße prägt, verblasste angesichts von Lebensumständen, die wesentlich fundamentalere Probleme aufwarfen. Beim Anblick von Menschen, die in Lehmhöhlen ohne Strom und eigenen Wasseranschluss lebten, stellte sich unweigerlich die Frage, ob man wirklich alles braucht, was in Europa als unverzichtbar gilt. Nie werde ich den Abend vergessen, den wir in einer afghanischen Karawanserei verbrachten. In düsteren Ziegelgewölben drängten sich im Kerzenlicht verwegen dreinblickende bärtige Gestalten mit weißen Turbanen und vergnügten sich bei Tee mit einem Brettspiel. Kaum einer von ihnen dürfte jemals die Schulbank gedrückt haben.
Wir betraten den indischen Subkontinent über den legendären Kaiberpass, der einzigen gut gangbaren Pforte in den gewaltigen Gebirgsriegeln, welche Indien nach Norden beinahe vollkommen abschirmen. Im Laufe der Jahrtausende waren über diesen Pass die Völker der kargen Steppengebiete Innerasiens immer wieder in die fruchtbaren Flussebenen Indiens vorgedrungen. Dort hatten sie sich als jeweils neue Oberschicht über die vorhandenen Schichten der Bevölkerung gelegt und so zur Bildung jener einzigartigen vertikalen Struktur der indischen Gesellschaft beigetragen, die sich bis heute im System der Kasten und nicht zuletzt in der Hautfarbe der verschiedenen gesellschaftlichen Einheiten spiegelt. Wir konnten den Drang der innerasiatischen Völker auf den Subkontinent nur zu gut verstehen. Nach tausenden Kilometern staubiger Trockenheit löste der Anblick seiner saftig-grünen, von Leben brodelnden Landschaften auch bei uns euphorische Gefühle aus.
Die Fahrt durch Indien war mühsam. Die Regenzeit war in vollem Gange. Das Land war weitgehend überschwemmt. Durch die Flusstäler wälzten sich wild braun-gelbe Fluten. Manche Flussüberquerung mit nicht selten hölzernen Fähren wurde zum Balanceakt, dessen Ausgang schwer zu kalkulieren war. Unpassierbare Brücken zwangen zu Umwegen, die mehrere hundert Kilometer lang sein konnten. Das Asphaltband der Strassen war in der Regel so schmal, dass darauf nur ein Fahrzeug Platz fand. Es wurde von den meist völlig überladenen Lastwagen in Anspruch genommen. Jedes Mal, wenn uns ein Fahrzeug entgegenkam, kam es zur Machtprobe. In der Regel mussten wir als die Besitzer des weniger robusten Gefährts unter schwersten Erschütterungen unserer mobilen Wohnung und des darin befindlichen Hausrates in die tief aufgewühlten schlammigen Bankette ausweichen. Morgens und abends waren riesige Viehherden auf den Strassen unterwegs und verwandelten dieselben mit ihren Exkrementen in Rutschbahnen. Die trägen Tiere, allen voran die urtümlichen Wasserbüffel, waren weder von unserem braven Boschhorn noch von den Stockschlägen sonderlich beeindruckt, die wir aus dem Auto verteilten, um sie zur Räumung der Fahrbahn zu veranlassen. Ohnehin diente die Straße allen möglichen anderen Zwecken. Man trocknete auf ihr Getreide, Chilischoten oder Wäsche und lagerte an ihren Rändern alle möglichen Gegenstände.
Unser Weg schien durch jedes der achthunderttausend indischen Dörfer zu führen. Das bunt gekleidete Volk lebte hier so, als habe die Zeit seit den Tagen Alexanders des Großen still gestanden. Die Strassen waren verstopft von Ochsenkarren, Lastrikshaws und Fahrrädern. Jederzeit musste man mit wiederkäuenden Kühen und Wasserbüffeln, spielenden Hunden und schlafenden Menschen rechnen. Auf diese Weise legten wir an einem Tag, an dem wir von Sonnenaufgang bis -untergang am Steuer saßen, kaum mehr als dreihundert Kilometer zurück.
In den überfüllten und schmutzigen Städten wurde man mit unsäglichem Elend aber auch ungeheurem Reichtum konfrontiert. Wo immer wir erschienen, verfolgten uns Bettler mit abenteuerlich verkrüppelten Gliedmaßen, toten Augen oder leprazerfressenen Gesichtern. Unzählige Menschen schliefen in schmutzige Tücher gehüllt am Straßenrand, der zugleich Küche und Wohn- und Schlafzimmer war. Nicht weit davon sah man gut gekleidete Reiche wohlgenährt und umringt von Dienern auf den Veranden klassizistischer Villen sitzen.
Auf dem Weg nach Süden kamen wir an manchen großen Zeugnissen aus der wechselvollen indischen Vergangenheit vorbei. Wir staunten über die weitläufigen, marmorhellen und figurlosen Bauten der Moghulen, allen voran das Taj Mahal, dessen überirdische Schönheit einen vergessen machen kann, dass es auch von der Ausbeutung des indischen Volkes durch Fremdherrscher zeugt, die aus trockenen und leeren Weltgegenden auf den feucht-heißen und wimmelnden Subkontinent gekommen waren. Dem gegenüber standen die verwinkelten, mystisch-düsteren und figurenüberladenen Heiligtümer der ursprünglichen indischen Religionen, in denen sich das pralle Leben des Subkontinentes aber auch die indische Neigung zur Verneinung des Irdischen spiegelt.
Eine Woche nachdem wir den indischen Subkontinent betreten hatten und vier Wochen nach unserer Abreise von Berlin kamen wir in Madras an, der Stadt, die der Ausgangspunkt für eine der erstaunlichsten Karrieren der Weltgeschichte war. Im Jahre 1743 begann hier der junge Robert Clive mit einer Tätigkeit als Schreiber bei der damals noch kleinen englischen East India Company. Er machte sie unter Ausnutzung der Rivalitäten, welche unter den indischen Potentaten bestanden, zu einem staatsähnlichen Gebilde, welches nach den Grundsätzen einer Handelsgesellschaft schließlich über den ganzen riesigen Subkontinent herrschen sollte. Er ist damit einer der Gründungsväter des „British Raj“, wie die Inder die Zeit der englischen Kolonialherrschaft nennen.
Читать дальше