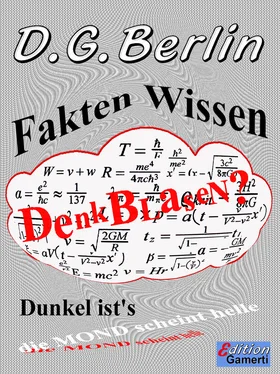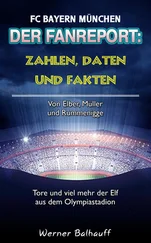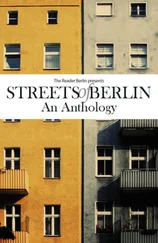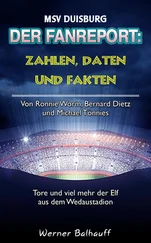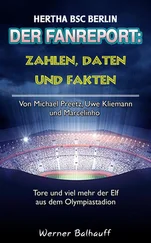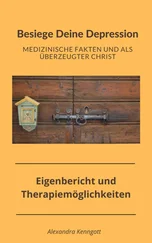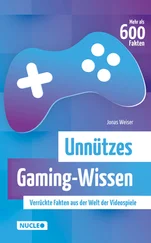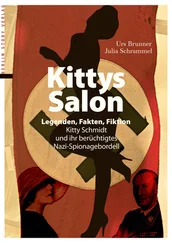Es wird wohl so sein, dass naturwissenschaftlich intern, also in den Instituten, auf den Symposien und Fachkonferenzen, noch mehr in den Kantinen und Uni-Cafeterias anders geredet wird; mitunter schon Ansichten in Frage gestellt, vielleicht sogar eigene Interpretationen bezweifelt und Verwirrungen zugegeben werden. Das wollen wir doch hoffen, obwohl ich nicht recht daran glaube. In der allgemeinen Öffentlichkeit stellt sich das nämlich regelmäßig anders dar.
Die Oberflächlichkeit der Medien und unsere Ehrfurcht vor Professoren und Doktoren, besonders wenn ihre Namen englisch klingen, werden wohl auch dazu beitragen, dass in der öffentlichen Wahrnehmung ein hauptsächlich problemloses Bild von der Naturwissenschaft der Gegenwart dominiert. Daran mag auch die Unmöglichkeit ihren Anteil haben, die Summe aller Veröffentlichungen und die Vielzahl der Theorien und Modelle zur Kenntnis nehmen oder gar erfassen zu können.
Wir „Touristen“ sind zudem zeitlich überwiegend mit ganz anderen Fragen beschäftigt und die Naturwissenschaft ist für uns tatsächlich nur eine gelegentliche touristische Attraktion.
Wissenschaftler, die mehr oder weniger zufällig in die Nähe dieses Textes geraten, sollten nicht gleich in Aufregung über die Anmaßungen eines Außenstehenden geraten. Der Text kann ihnen durchaus gewissen Aufschluss darüber bieten, was von ihrem Schaffen bei uns „Touristen“ so ankommt und wie wir es bewerten. Das ist für sie auch nicht gerade unwichtig.
Hauptsächlich habe ich den Text aber für alle „Mit-Touristen“ verfasst, um sie in ihren Zweifeln zu bestärken und anzuregen, nicht einfach zu glauben, wo Wissen und Verstehen notwendig sind.
Wir leben im 21. Jahrhundert. Seit den Babyloniern, Phöniziern, Ägyptern und den naturphilosophischen Vermutungen der alten Griechen ist also schon viel Wasser durch die Flüsse geflossen.
Große Entdeckungen wurden gemacht, Namen wie Thales und Pythagoras, Archimedes und Galilei, Kopernikus und Kepler, Descartes und Newton, Faraday und Maxwell, Planck und Einstein, Heisenberg und Bohr, Weinberg und Hawking stehen eingemeißelt in den Annalen der Physik. Chemie und Optik, Mechanik und Metallurgie, Astronomie, Kosmologie, Biologie und die anderen Wissenschaftsgebiete haben die Palette der Erkenntnisse und des Wissens um Zehnerpotenzen erweitert. Nun haben wir es – das moderne wissenschaftliche Bild von der Welt außer uns; das Weltbild, das uns die Naturwissenschaft, unter maßgeblicher Prägung durch die Physik, in prächtigen Farben und klaren Konturen, in logischen Strukturen und als beeindruckende mathematische Kompositionen gezeichnet hat.
Eine kurze Geschichte der Zeit, Die kürzeste Geschichte der Zeit, Eine kurze Geschichte von fast allem und sogar Die kürzeste Geschichte allen Lebens (Stephen W. Hawking; St. W. Hawking/L. Mlodinow; Bill Bryson; H.Lesch/H.Zau) – Naturwissenschaftler versuchten in den letzten Jahren, sich gegenseitig mit ihren Kurzgeschichten zu übertreffen, um uns das naturwissenschaftliche Weltbild so nahe wie nur irgend möglich zu bringen. Das waren, so hörte man, recht erfolgreiche Publikationen – die Autoren dieser Bücher sind ja auch namhafte Wissenschaftsexperten.
Wollten sie uns mit der Titelwahl suggerieren, im Gegensatz zum langen Weg der Naturerkenntnis sei es mit dem Verstehen der Natur eine ganz einfache Sache, so schnell geklärt wie schnell erzählt?
Sind es denn so kurze Geschichten? Sind sie schon erzählt? Sind wir am Ziel unserer Suche nach Wissen und Begreifen? Ist alles Wichtige geklärt? Haben wir alles verstanden, was es zu verstehen galt? Hat die Naturwissenschaft alle unsere Fragen an die Natur beantwortet? Oder ist die moderne Erklärung der Natur tatsächlich eine Kurzgeschichte – einfach zu kurz geraten?
Gibt es nicht noch viel Unklares und Unbewiesenes in allen Fragen nach dem Wie? Sind nicht ganz wesentliche Fragen nach dem Warum weitestgehend unbeantwortet und nicht einmal Ansätze in Sicht, wie die Naturwissenschaft sie beantworten will – wenn sie das überhaupt will?
Zur Enttäuschung der Naturwissenschaftler müssen wir es zugeben: Unser Denken und unsere Vorstellungen von der Welt außer uns sind noch immer vor allem auf das Alltägliche gerichtet, denn wir müssen uns zunächst nicht im Universum, sondern im Leben zurecht finden, unseren individuellen Platz bestimmen, mit unseren Mitmenschen auskommen, etwas aus unserem Leben machen, oder schlicht nur ‚überleben’. Wir wollen auch viel erleben, Spaß haben, alles genießen, was Leben und Welt für uns an Genussvollem bereithalten.
Ob wir als Individuen mehr Genuss und Spaß haben oder mehr ums Überleben kämpfen müssen, wird nicht von unserem Verständnis für die Natur der Natur bestimmt, sondern von Ort und Zeit unseres Da- oder Hierseins, von der Gnade unserer Herkunft, der Brutalität der Mächtigen, der Gier der Reichen und anderen Umständen, auf die wir häufig wenig Einfluss haben.
Die Welt außer uns kann bedrohlich, Angst einflößend, grau und kalt, voller Gefahren, Krankheit und unbarmherziger Härte sein. Manchem scheint dagegen jeden Tag die Sonne, bietet die Welt ein farbenprächtiges Bild der Harmonie und Schönheit, der Eleganz und des Überflusses. Wie die Welt dem Menschen begegnet, hängt nicht von der Welt ab, sondern von den Daseinsumständen des Menschen.
Jeder einzelne Mensch, unabhängig seines Alters und seiner Herkunft, seiner Möglichkeiten und seiner Ambitionen, macht sich seine Vorstellungen über die Welt, malt sich selbst sein individuelles Weltbild. Es ist mitunter in erschreckender oder auch nachvollziehbarer Ausschließlichkeit auf Bankkonto und Karriere, den Fußballverein oder das TV-Programm, die Eckkneipe oder das andere Geschlecht fixiert, manchmal schon auf einen ferneren Horizont des Daseins und der Verantwortung dafür gerichtet oder erhebt sich sogar in die unermesslichen Regionen des Wissenschaftlichen und Philosophischen – oder es ist von allem etwas und in nichts wirklich viel.
Es kann von der Naturwissenschaft beeinflusst sein, aber auch von Religion, Philosophie oder Kunst, von den Erfahrungen des alltäglichen Erlebens oder von der Suche nach dem Unüblichen. Es kann orientiert sein an den maßstabsetzenden Werken der großen Denker und den von ihnen propagierten Werten und Verhaltensprämissen oder an den Nachrichten- und Argumentationsschnipseln der Medien. Es kann geprägt sein von der unbändigen Lust auf Neues wie von der Bequemlichkeit der Aneignung des gerade nur Nötigsten.
So oder so oder noch anders: Wir müssen uns ein Bild von der Welt machen, denn wir wollen uns schließlich in ihr zurechtfinden und uns gut mit ihr stellen, damit sie gut zu uns ist.
Wir müssen wissen, wie wir zu Nahrung, Kleidung, Bildung, natürlich auch zu Getränken kommen, wo wir wohnen können – und das Auto parken –, ob unsere Arbeitsplätze noch sicher sind, wie wir überhaupt unsere Lebensbedingungen sichern, möglichst sogar verbessern; wer und was uns dabei hilft, wer und was uns daran hindert, wer unsere Freunde sind, wer nicht; was unser Dasein gefährdet; wie wir gesellschaftliche Entwicklungen und Vorgänge be- oder verurteilen sollen, wie wir das einzuordnen haben, was Politik genannt wird; ob die CDU christlich ist oder diabolisch, die CSU sozial oder bayrisch, die Grünen grün oder farblos und die Linkspartei links oder nur linkisch; was wir von dem zu halten haben, was uns die Medien tagtäglich einhämmern, seit einiger Zeit sogar, ob und wie wir den Unsinn im Internet von dem trennen können, was uns nützliche Information sein kann.
Es ist auch hilfreich zu wissen, wie wir aktuelle und potentielle Sexualpartner beeindrucken und womit wir lästige Konkurrenten ausschalten können, was eine Steuererklärung ist und wie man sie möglichst vorteilhaft – für sich – ausfüllen kann und sich trotzdem so fühlen darf, als wäre man den Kindern noch ein einsam leuchtendes Vorbild.
Читать дальше