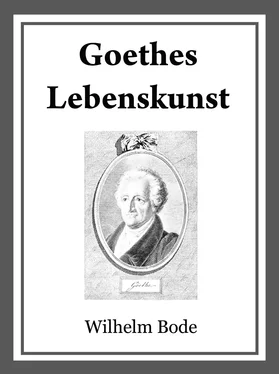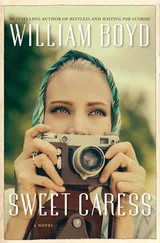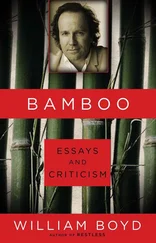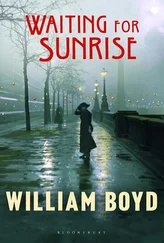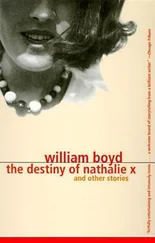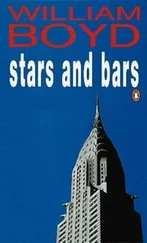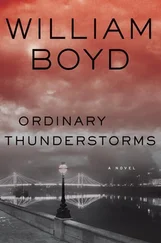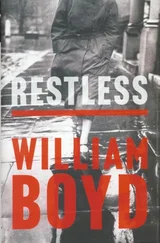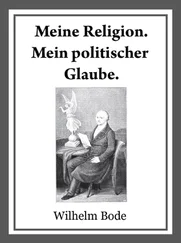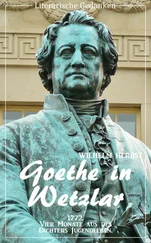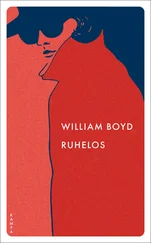An Schärfe fehlte es Goethen gegen seine Diener freilich auch nicht, wenn er mit der Geduld schließlich nicht zum Ziele kam. Und wenn er jemand entließ, so nahm er es ernst mit der Polizei-Verordnung, die es den Herrschaften zur Pflicht macht, die Dienstboten „nicht bloß mit allgemeinen und unbedeutenden Attesten zu entlassen, sondern darin gewissenhaft ihr Gutes und ihre Mängel auseinanderzusetzen.“ Als er im März 1811 eine Köchin wegschickte, die er als „eine der boshaftesten und inkorrigibelsten Personen“ befunden hatte, schrieb er ihr folgendes aufrichtiges Zeugnis:
„Charlotte Hoyer hat zwei Jahre in meinem Hause gedient. Für eine Köchin kann sie gelten, und ist zu Zeiten folgsam, höflich, sogar einschmeichelnd. Allein durch die Ungleichheit ihres Betragens hat sie sich zuletzt ganz unerträglich gemacht. Gewöhnlich beliebt es ihr nur nach eigenem Willen zu handeln und zu kochen; sie zeigt sich widerspenstig, zudringlich, grob, und sucht diejenigen, die ihr zu befehlen haben, auf alle Weise zu ermüden. Unruhig und tückisch verhetzt sie ihre Mitdienenden und macht ihnen, wenn sie nicht mit ihr halten, das Leben sauer. Außer andern verwandten Untugenden hat sie noch die, daß sie an den Türen horcht.“
Charlotte Hoyer hatte keine Ahnung, welchen Preis ihr von Goethe gezeichnetes Charakterbild als Autogramm später haben würde, und riß es auf der Treppe in hundert Stücke. Goethe schickte die Beweise dieser neuen Frechheit der Polizei zu, deren „einsichtsvollem Ermessen“ er „die Ahndung einer solchen Verwegenheit“ anheimgab. 41
Aber auch von einer wackeren Köchin wissen wir, wie sie zu Goethe als ihrem zeitweiligen Herrn stand. Henriette Hunger war seit 1817 bei dem Verleger Frommann in Jena in Stellung, ihre Erinnerungen erzählt sie am besten in eigener Sprech- und Schreibweise 42:
„Göhte war ein treuer Freund zu Frommanns. Alle Morgen 11 Uhr fuhr Göhte vor und machten Seinen Morgenbesuch. Wobei ich auch das Unglück hatte, Göhte mit Eine Butte Wasser zu überschitten. Göhte wollte mich die Thür halten aus Bescheidenheit und ich ebenfalls, ich versah das Tembo und war in fallen und Göhte wolte mich halten und bekam die Wasserbutte auf den Halz, ich zum Tode Erschrocken. Madam und Fräulein Frommann Kamen mit Tüchern und beseitigten das nasse Element. Göhte fuhr nach Haus um sich umzukleiden. Deßhalb gab es keine Feindschaft. Den andern Morgen war Göhte wieder da und lachte. Göhte war nachdem in den botanischen Garten gezogen wolte aber nicht lange mehr in Jena bleiben, weil Ihn das Essen aus den Speisehäusern nicht Schmeckte. Frommanns wollen Göhte gerne für sich und Jena Erhalten, der Grund war das Essen wie anfangen, die Madam Fromman Eine sehr kluge Dame sann hin und hehr. Endlich kam sie auf Ihre Köchin, das war ich. Sie ließ mich in Ihr Zimmer kommen und sagte, ich habe ein großes anliegen an Dich was G. betrift und Du die Hauptperson bist (Du die Hauptperson? dachte ich) willst Du für G. Kochen den Mittagstisch übernehmen Meine Speisekammer Steht Dir Ofen, thue Es, ich werde Dirs niemals vergessen, nach langes Zureden gab ich mein Wort. An Göhte geschriben das Ihre Köchin für Ihn den Mittags Tisch übernehmen wolte, mit Freuden Nehme ich dis An — war die Rückantwort. So kochte ich ein halbes Jahr für den Großen Mann zu danke. Göhte nahm sich gegen mich nicht als wäre ich Köchin sondern als wäre ich mehr, wenn ich mit meinen Zettel kam, lag Schon was Schönes da, anzusehn für mich, Kurz ich kam mich vor als gehörte ich der gelehrten Welt mit an.“ — —
Als Eckermann noch neu in Weimar war, traf er einmal beim Spazierengehen einen bejahrten, wohlhabenden Bürger. Sie hatten nicht viel Worte gewechselt, als das Gespräch auf Goethe kam und Eckermann den Bürger fragte, ob er Goethen auch persönlich kenne. „Ob ich ihn kenne!“ antwortete er mit einigem Behagen, „ich bin gegen zwanzig Jahre sein Kammerdiener gewesen“. Und nun ergoß er sich in Lobsprüchen über seinen frühern Herrn. Dieser selbe Philipp Seidel, der es später zum Rentamtmann brachte, hatte sich seines verehrten Herrn Gewohnheiten und Aussprüche so angeeignet, daß man ihn allgemein „Goethes vidimierte Kopie“ nannte. Wir wissen aber auch, 43daß Goethe allein mit diesem Diener in seinem Gartenhause den Abend verbrachte und mit ihm in der gleichen engen Kammer schlief. „Mit meinem Philipp von seiner und meiner Welt geschwätzt,“ heißt es in einem Briefe Goethes, Philipp aber berichtete an einen Frankfurter Freund, 44wie weit diese Gespräche gingen. „Stell dir die erschreckliche Wendung vor: von Liebesgeschichten auf die Insel Korsika, und auf dieser blieben wir in dem größten und hitzigsten Handgemenge bis morgens gegen viere. Die Frage, über die mit so viel Heftigkeit als Gelehrsamkeit gestritten wurde, war diese: ob ein Volk nicht glücklicher sei, wenn's frei ist, als wenn's unter dem Befehl eines souveränen Herrn steht. Denn ich sagte: die Korsen sind wirklich unglücklich. Er sagte: nein, es ist ein Glück für sie und ihre Nachkommen; sie werden nur verfeinert, entwildert, lernen Künste und Wissenschaften, statt sie zuvor roh und wild waren. Herr! — sagte ich — ich hätt' den Teufel von seinen Verfeinerungen und Veredelungen auf Kosten meiner Freiheit, die eigentlich unser Glück macht.“
Dieser Diener war zugleich auch Schreiber, und so kannte er Goethes Werke, die damals entstanden, gut, glaubte wohl auch, das Seine dazu getan zu haben. Als Goethe nun in Italien war, besorgte er daheim seine Aufträge, und so bekam er auch die letzte Redaktion der „Iphigenie“. Sie gefiel ihm gar nicht, und er schrieb das seinem Herrn. Dieser mag wohl über die scharfe Kritik seines um sechs Jahre jüngeren Dieners gelächelt haben, aber er antwortete menschlich-bescheiden: „Was du von meiner Iphigenie sagst, ist im gewissen Sinne leider wahr. Als ich mich um der Kunst und des Handwerkes willen entschließen mußte, das Stück umzuschreiben, sah ich voraus, daß die besten Stellen verlieren mußten, wenn die schlechten und mittleren gewannen. Du hast zwei Scenen genannt, die offenbar verloren haben. Aber wenn es gedruckt ist, dann lies es noch einmal ganz gelassen und du wirst fühlen, was es als Ganzes gewonnen hat.“ Seidel blieb dabei, daß die alte, prosaische Form die bessere gewesen sei, wie auch die „Claudine von Villabella“ durch die Jamben nicht gewonnen habe. Goethe antwortete wieder geduldig: „Du sollst auch eine Iphigenie in Prosa haben, wenn sie dir Freude macht. Der Künstler kann nur arbeiten. Beifall läßt sich, wie Gegenliebe, nur wünschen, nicht erzwingen.“ 45
Noch in der Nacht vor seinem Tode zeigte sich Goethes gutes Herz gegen seine Diener. Er sah, daß der Mann, der immer in seiner Nähe sein mußte, sehr müde war. Da ließ er ihn in seinem eigenen Bette schlafen, während er im Lehnstuhl, wo er leichter Atem bekommen konnte, daneben saß; der Kopist mußte aufpassen, daß er nicht beim Einschlafen vornüber fiel. — —
* *
*
Zu den ihm Unterstellten gehörten auch die Schauspieler, und dieses Völkchen war zu allen Zeiten schwer zu regieren. „Ich will mit dem Schauspielervolk nichts mehr zu schaffen haben,“ schrieb ihm Schiller einmal, 46„denn durch Vernunft und Gefälligkeit ist nichts auszurichten, es gibt nur ein einziges Verhältnis zu ihnen, den kurzen Imperativ, den ich nicht auszuüben habe.“
Goethes Grundsatz im Theater war: keine Günstlinge haben, die Gunst verteilen, damit niemand allzu nahe tritt. Und weiter: genau auf die Paragraphen der Hausgesetze halten. „Bei Schauspielern muß man in der Ordnung streng am Buchstaben halten, sie sind Meister in Ausflüchten,“ schrieb er 1798 an Kirms. Aber als jemand einmal bemerkte, es möge wohl schwer sein, ein Theater in gehöriger Ordnung zu halten, sprach er die Worte, die sich jeder Regierende ins Album schreiben sollte: „Sehr viel ist zu erreichen durch Strenge, mehr durch Liebe, das meiste aber durch Einsicht und eine unparteiische Gerechtigkeit, bei der kein Ansehn der Person gilt.“ 47Gegen ältere Schauspieler gab er seiner Unzufriedenheit nie strenge Worte, sein Tadel war nicht verletzend. Z. B.: „Nun, das ist ja gar nicht übel, obgleich ich mir den Moment so gedacht habe; überlegen wir uns das bis zur nächsten Probe, vielleicht stimmen dann unsere Ansichten überein“. 48
Читать дальше