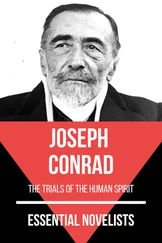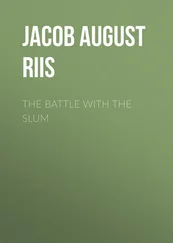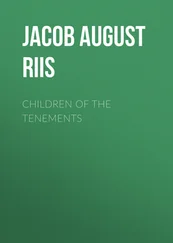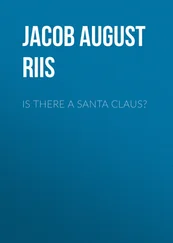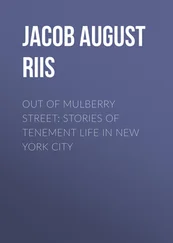Joseph August Lux - Beethovens unsterbliche Geliebte
Здесь есть возможность читать онлайн «Joseph August Lux - Beethovens unsterbliche Geliebte» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Beethovens unsterbliche Geliebte
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Beethovens unsterbliche Geliebte: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Beethovens unsterbliche Geliebte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Wien um 1800: Der junge Ludwig van Beethoven spaltet mit seiner neuen, exzentrischen Musik die Gemüter. Von den einen als Ketzer verschrien, preisen, die anderen sein Genie. Eine seiner Bewunderinnen ist Theresa, eine junge ungarische Gräfin. Sie wird dem Komponisten Muse, Engel, Heilige, und über alle Stürme des Lebens hinweg bleibt seine große Liebe zu dieser Frau unverbrüchlich.
Beethovens unsterbliche Geliebte — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Beethovens unsterbliche Geliebte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Amenda wunderte sich ein wenig über das harte Urteil, das der Meister über seine Wiener Freunde fällte; doch er wußte, daß er die Übertreibung liebe und daß ihm jene doch mehr waren als bloße »Instrumente«; es war eben Seelenbekümmernis über das Scheiden des Freundes, die aus ihm sprach: sein Gemüt war verfinstert. Ihn auf freundlichere Gedanken zu lenken, brachte Amenda das Gespräch nochmals auf die Frauen; Wegeler wollte wissen, daß der Meister »immer in Liebesverhältnissen« war und mitunter Eroberungen machte, die manchem Adonis, wo nicht unmöglich, so doch sehr erschwert gewesen wären.
Er erinnerte ihn jetzt daran.
Der Meister lächelte wehmütig. »Du weißt, wie ich über diese Dinge denke: die längste Liebe hat nicht sieben Monate gedauert, und betrachtet man's genau, so war's nicht einmal eine Liebe. Die müßte kommen im Sturm, wie eine Katastrophe, die den ganzen Menschen um und um stürzt, das Innerste nach außen – aber ich fürchte, ich bin zu vernünftig dazu, vielleicht auch zu bedenklich und zu sehr an die eine Frau Kunst verschworen, als daß ich den Kopf an eine andere verlieren könnte. Es müßte denn sein, daß sie mich inspiriert und selbst so eine Art Muse wird – aber das gibt es wohl nicht!«
Er sann eine Weile nach und fügte in Erinnerungen verloren hinzu: »Einmal allerdings habe ich eine geliebt, die mir Herzensfreundin und Muse zugleich war: mit ihr wäre ich vielleicht glücklich geworden – vielleicht bilde ich mir das nur ein – genug an dem, sie gehört einem andern, du weißt ja: Leonore ... Wegeler irrt sich; seitdem ist mir Frau Venus beharrlich aus dem Wege gegangen; ist auch besser so – – –«
Eine Pause entstand.
»Kennst du die Komtessen Brunszvik?« fragte er plötzlich und ganz unvermittelt. »Ich glaube Theresa heißt die eine, Josephine die andere, die mit den Teufelsaugen.«
Amenda verneinte; er kannte wohl den Bruder Franz Brunszvik und erzählte, daß er bei Lobkowitz viel geschwärmt habe von Meister Ludwig; übrigens sei er selten in Wien, meistens in Ungarn auf seinem Gut und in dem kleinen Palais in Ofen-Pest – –
»Das hat mich neulich gepackt bei Lichnowsky, als ich sie zum erstenmal sah«, gestand Ludwig. »Ich dachte unwillkürlich an Leonore – ich bin immer ein wenig unglücklich, wenn ich an sie denke –, diesmal aber war ich wie verzaubert, ganz getröstet: ich hatte das Gefühl, die könnte mir ersetzen, was die Jugendliebe war, vielleicht mehr als das; zum erstenmal, daß Leonore in meinem Gefühl ausgelöscht war; aber dann war ich erst recht unglücklich: ich sah die ganze Hoffnungslosigkeit; diese stolzen Gräfinnen, auch wenn sie liebe Augen machen und gar süß und vertraulich tun –, es gibt eine Schranke, du kommst nicht hinüber, man braucht nur die hochgeborene Gräfin-Mutter anzusehen, liebenswürdig und eiskalt! Und wenn ich mich jetzt genau erinnern will, weiß ich gar nicht mehr recht, welche mich mehr bezaubert hat, die Theresa oder die Josephine; beide fließen mir jetzt in eine zusammen: die mit der Haarkrone und dem wunderbar schönen, fast traurigen Gesicht und die andere mit den brennenden Augen, die wie dunkles Feuer lodern: nein, Amenda, ich bin froh, daß ich sie nicht kenne und wahrscheinlich nicht mehr sehe, es wäre geschehen um meinen Frieden: freudvoll und leidvoll, das wäre jetzt mein Los; besonders aber leidvoll – es war schon das richtige Thema, das du mir aufgegeben hast.«
Der Meister trat ans Klavier, er war aufs neue angeregt, immer wenn er im Herzen Sturm fühlte, und begann zu phantasieren. Der Schmerz, der Freund, die Liebe, sie waren vergessen, oder sie traten in anderer Gestalt hervor, als Klangerscheinung, eine geisthafte Existenz, in der etwas wie Schicksal lag, eine Ankündigung.
Unheimliche, düstere Klopfmotive melden sich, ein dämonischer Anfang, dem bald ein Ausbruch von Leidenschaft folgt, ein tönendes Gewoge, wie wenn die See heult. Dann ein traumhaftes, gebetartiges Thema, wie eine himmlische Erscheinung, engelmild. Und wieder der Aufschrei der Leidenschaft, verzweifeltes Ringen nach dem Licht und dem Frieden, nach der Engelgleichen, im Kampf mit Dämonen, wahre Seelenstürme bis zur grausigen Wildheit gesteigert.
Es waren Ahnungen von Dingen, die möglich sind oder gar unvermeidlich.
Ab und zu machte der Meister Notizen, um diesen oder jenen Gedanken der Improvisation festzuhalten. »Das könnte ich brauchen,« sagte er wie zu sich selbst, »das könnte was werden!« Und dann fiel das Wort: »Appassionata müßte man's nennen – –«
Zum endgültigen Abschied Amendas sollte ein Festschmaus veranstaltet werden, den Meister Ludwig in seiner Wohnung gab. Es war damit kein Ohrenschmaus gemeint, der die Gäste entzückt hätte, sondern ein richtiger Küchenschmaus; der Künstler liebte es, sich auch als Kochkünstler zu zeigen, was freilich weniger Entzücken weckte. Der ewigen Gasthausküche – beim »Schwanen«, oder im »Fischtrüherl«, oder im »Jägerhorn«, oder beim »Römischen Kaiser«, beim »Schwarzen Kamel«, im »Blumenstöckl«, in der »Eiche« auf der Brandstatt und wie sie alle hießen, die bevorzugten Altwiener Lokale, wo gerne Musiker verkehrten – überdrüssig geworden, kam er auf die barocke Idee, zu der ihn sein Unabhängigkeitssinn trieb, gelegentlich sein eigener Küchenchef zu sein. Der Diener verstand nichts von der Kocherei, also hieß es eigenhändig zupacken; der Meister wollte den Freunden beweisen, daß er auch auf diesem Gebiete seinen Mann stellen könne. Um nicht betrogen zu werden, was seine ewige Furcht war, begab er sich schon am frühen Morgen in eigener Person auf den Markt, wählte mit großer Umsicht und Kennermiene, schimpfte über die Preise, feilschte – und kaufte schließlich schlecht und teuer.
Die Freunde wußten schon, was ihrer bei Meister »Mehlschöberl« – das war sein Spitzname als Koch – harrte. Es waren nur die Intimsten geladen: außer Amenda als dem Gefeierten das »Falstafferl«, »Baron Dreckfahrer«, nämlich Zmeskall, der Kapellmeister Hummel, kurz »Natzl« genannt, und Steffen Breuning, der Bonner Jugendfreund, der in der Hofkriegskanzlei tätig war. Die Freunde hatten verabredet, vorher insgesamt in einer Gastwirtschaft ein tüchtiges Frühstück zu nehmen und von dort aus zum Diner in des Meisters Wohnung zu ziehen, wo man die Speisen als bloße »Schaugerichte« unbehelligt vorüberspazieren zu lassen entschlossen war. Man war gewitzigt. Nur durfte man es »Mehlschöberl« ja nicht merken lassen.
Alles kam, wie man es bei solchen Anlässen schon gewohnt war: der Hausherr empfing seine Gäste als Koch im Nachtjäckchen, eine stattliche Schlafmütze auf dem struppigen Kopf, eine blaue Schürze um die Lenden gebunden, das braune Gesicht brandrot erhitzt wie Meister Vulkan von der emsigen Tätigkeit am Feuerherde.
Die Vorbereitungen zogen sich wie gewöhnlich in die Länge; schon anderthalb Stunden harrten die Gäste der Dinge, die da kommen sollten, geduldig zwar, aber doch mit dem bangen Wunsche, daß die Prüfung gnädig vorübergehen sollte.
Endlich schlug die große Stunde; der Diener begann zu servieren. Man wußte es schon von früher und hatte sich auch diesmal nicht getäuscht: die Suppe war mager wie die Bettelsuppe der Gasthöfe; das Rindfleisch halb gar und zäh, etwa für einen Straußenmagen berechnet; das Gemüse ein Gemengsel von Zellstoff, Fett und Wasser, unvermengt, der Braten halb verkohlt.
Am besten schmeckte es dem Festgeber; der höfliche Beifall der Gäste würzte das Mahl und versetzte ihn in rosigste Laune; aufgemuntert, selbst tüchtig zuzugreifen, würgte jeder ein paar Bissen hinunter und beteuerte, schon übersatt zu sein; im übrigen hielten sie sich wacker an das frische Brot, Obst und Backwerk und besonders an den süffigen Ofener Wein, der Hausmarke des Meisters, und ließen »Mehlschöberl«, die komische Person in der Burleske »Das lustige Beilager«, hochleben. Meister Ludwig war kein Kostverächter, er verschmähte keineswegs einen guten Tropfen; in der Regel aber hielt er sich an klares Brunnenwasser, das er freilich übermäßig und in Strömen trank. Der tüchtige Zug lag schon in der Familie; der Großvater, Hofmusikkapellmeister in Bonn, aus Belgien eingewandert, führte nebenher einen Weinhandel, seine Frau, die Großmutter, erlag der Trunksucht, und leider auch der Vater war ein Trinker und hatte dadurch sich und die Familie ruiniert. Der göttlichen Natur des Meisters lag der Mißbrauch fern; Wassertrinken war kein Laster.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Beethovens unsterbliche Geliebte»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Beethovens unsterbliche Geliebte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Beethovens unsterbliche Geliebte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.