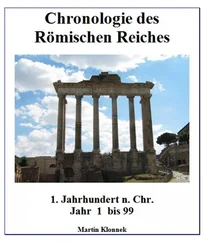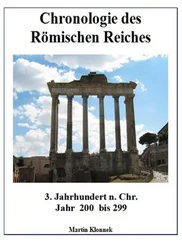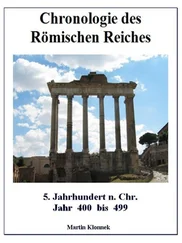Hatte Wilhelm III. nicht die strahlende Kraft, die von manchen heroischen Naturen ausgeht, so wirkte doch auch seine verhaltene Leidenschaft fesselnd. Die sich ihm einmal angeschlossen hatten, wie Waldeck und der Ratspensionär Heinsius, der Nachfolger des unglücklichen de Witt, blieben in seinem Bann. Leider besaß er nicht die Feldherrngaben, die seine Vorfahren Moritz und Friedrich Heinrich ausgezeichnet hatten. Er war ebenso wie Waldeck im Feld meist unglücklich. Immerhin gab Ludwig, nachdem der erste siegreiche Angriff zurückgeworfen war und das verbündete kaiserlich-brandenburgische Heer herannahte, den Krieg gegen Holland auf. Die Republik war für den Augenblick gerettet.
Zu den großen Gegnern Ludwigs XIV. darf man auch Leibniz zählen, obwohl er im Dienst des Kurfürsten von Mainz seine Laufbahn als Anhänger Frankreichs begonnen hatte und nie aufhörte, die französische Kultur zu schätzen. Den Reichsfeind Ludwig bekämpfte seine Feder, seine eindringlichen, schneidenden Äußerungen begleiteten alle die kriegerischen Aktionen, die sein Leben erfüllten, bald aufreizend, bald trauervoll und zornig.
* * *
Ungarn und Türken
Zur Methode Ludwigs gehörte es, denen, die er angreifen oder die er verhindern wollte ihn anzugreifen, Feinde zu erwecken. Deshalb reizte er Portugal zum Krieg gegen Spanien, deshalb suchte er einen französischen Prinzen oder von ihm abhängigen Mann auf den polnischen Thron zu bringen, der sich etwa gegen Österreich gebrauchen ließ. Österreich gegenüber war er in der günstigen Lage, sich zweier immer zum Sprung bereiter Feinde dieser Macht bedienen zu können: der Ungarn und der Türken. Man muss die stets von Osten drohende Gefahr bedenken, um Leopolds unsicheres Verhalten im Westen zu verstehen.
Es waren die schwierigen Verhältnisse Siebenbürgens, die einen Zusammenstoß mit der Türkei herbeiführten. Dies Land hatte sich unter ehrgeizigen und oft hervorragenden Führern eine Art Selbständigkeit zwischen der Pforte und Österreich zu behaupten gewusst, sich bald mehr dem einen, bald dem anderen Land anschließend. Als die Pforte den Großfürsten Rákoczy, der ihre Unzufriedenheit erregt hatte, angriff und besiegte, dann das ungarische Großwardein eroberte, glaubte die österreichische Regierung sich einmischen zu müssen, um einem türkischen Einfall in die Erblande vorzubeugen.
Wenn sich der Kaiser nicht leicht zum Krieg entschloss, so erklärt sich das aus der Schwierigkeit, ein den türkischen Streitkräften nur einigermaßen gewachsenes Heer zusammenzubringen. Er verfügte damals über 12.000 Mann, wozu noch das etwa 15.000 Mann zählende Aufgebot der Ungarn kam, und diesen standen 120.000 Türken gegenüber. Sicherlich hätte der Kaiser mehr Geld und mehr Soldaten aus den Erblanden aufbringen können, wenn die militärischen Angelegenheiten ganz in seiner Hand gelegen hätten und wenn nicht in der Verwaltung Schlendrian und Schlamperei herkömmlich gewesen wären. „Kein Mensch hat hier Lust zu ernstlicher Arbeit“, schrieb der Nuntius an den Papst, und später Prinz Eugen: „Es mag auch noch so schlechte Nachricht kommen, ist man doch hier weit entfernt, sich zu beunruhigen oder an Abhilfe zu denken. Man ist hier von außerordentlicher Gemütsruhe und lässt alles seinen Gang gehen.“
Hier Ordnung zu schaffen, war Leopold nicht die Persönlichkeit. „O Dio“, schrieb er einmal seinem Beichtvater, „come detesto di dover prendere delle resoluzioni!“ Aus Angst vor Entschlüssen und Entscheidungen ließ er die Dinge gehen, und eine ähnliche Geistesverfassung herrschte in seiner Umgebung.

Raimondo Graf von Montecuccoli, seit 1651 Fürst von Montecuccoli (* 21. Februar 1609 auf Schloss Montecuccolo in Pavullo nel Frignano bei Modena; † 16. Oktober 1680 in Linz), war ein italienischer kaiserlicher Feldherr, Diplomat und Staatsmann in österreichisch-habsburgischen Diensten.
Der Oberbefehlshaber des kaiserlichen Heeres, Raimondo de Montecuccoli, einer der vielen zu Österreichern gewordenen Italiener, war im Jahr 1609 in Modena geboren, hatte in vielen Schlachten des Dreißigjährigen Krieges mitgekämpft und war in den Jahren 1639-42 in schwedischer Gefangenschaft gewesen. Diese Zeit hatte er benützt, um viel zu lesen, nicht nur kriegswissenschaftliche, sondern auch allgemein wissenschaftliche Werke, und hatte sich eine bedeutende Gelehrsamkeit erworben. Vielleicht war es dies Wissen, vielleicht auch das zunehmende Alter, das seine Kriegführung bedächtig, oft allzu bedächtig machte. Überhaupt aber war es der Grundsatz dieser Epoche, Schlachten womöglich zu vermeiden, um die Soldaten, eine kostbare Ware, zu sparen, und mehr durch geschickte strategische Bewegungen Erfolg zu erringen. Montecuccoli ging darin sehr weit; allerdings war er fast immer in der Lage, mit einer geringen Truppenzahl einer Übermacht entgegenzugehen. Als Mensch war er ehrenhaft und sympathisch.
Nachdem die wichtige, der Grenze nahegelegene Festung Neuhäusel von den Türken erobert worden war, und nachdem Leopold den Regensburger Reichstag gehörig bearbeitet hatte, ließ sich das Reich zur Hilfeleistung bereitfinden. Sie war dreifacher Art: das Reich stellte die eigentlichen Reichstruppen, Brandenburg, Sachsen und Bayern schickten ihre Hilfe gesondert, und ebenso trat der Rheinbund als selbständig handelnde Macht auf. Als das vornehmste Glied desselben lieferte Ludwig XIV. die meisten Truppen, zu denen sich viele von Adel als Freiwillige gesellten. Dass Ludwig ihm als Teilnehmer am Krieg aufgedrängt wurde, während man doch wusste, dass er die Türken gegen Österreich aufzuhetzen pflegte, war eine Beleidigung des Kaisers, die er tief empfand. Doch kämpften die Franzosen mit der ihnen eigenen Bravour und Disziplin, so dass sich Ludwig rühmen konnte, einen großen Teil zum Sieg beigetragen zu haben.
Bei St. Gotthardt an der Raab, nahe der steiermärkischen Grenze, kam es zur Schlacht, die ungeachtet des Zurückweichens der Reichstruppen im Beginn mit einem vollständigen Sieg der Christen endete. Es scheint, dass Montecuccoli auch in diesem Fall die Schlacht vermeiden wollte und nur durch den Rat der übrigen Heerführer zum Angriff bestimmt wurde. Trotz des glänzenden Erfolges schloss der Kaiser noch im selben Monat, im August 1664, den für ihn unvorteilhaften Frieden von Vasvar, der die Festungen Großwardein und Neuhäusel in den Händen der Türken ließ. Auch Siebenbürgen blieb bis auf weiteres unter türkischem Einfluss. Die Sorge um die Entwicklung in Spanien im Falle des Todes Philipps IV., der damals erwartet wurde, noch mehr vielleicht der Unmut über die unwürdige Bundesgenossenschaft Frankreichs, scheint beim Abschluss eines so verzichtvollen Vertrages den Ausschlag gegeben zu haben.
Der Unwille über den nachteiligen Friedensschluss war auch in Ungarn groß und steigerte die im Kreis der Magnaten ohnehin herrschende Unzufriedenheit zu förmlicher Verschwörung. Nur einige Komitate Ungarns, die der österreichischen Grenze nahe lagen, waren damals in österreichischem Besitz, die Mitte, nämlich die Komitate oder Paschaliks Ofen, Temesvar, Kanischa und Erlau mit dem hochgelegenen Ofen und den übrigen wichtigsten Festungen, darunter Grau, Stuhlweißenburg und Belgrad, befand sich in türkischen Händen. Aber auch das österreichische Ungarn war kein sicherer Besitz. Es war ein tragisches Verhängnis, dass Österreich Ungarn als Vormauer gegen die Türkei zu beherrschen suchen musste und dass andrerseits die Ungarn der deutschen Herrschaft natürlicherweise widerstrebten. Die Ungarn lebten noch in mittelalterlich feudalen Verhältnissen, während Österreich seine ständische Verfassung mehr und mehr durch eine modern-zentralistische zu überwinden suchte. Die ungarischen Stände konnten sich rühmen, im Besitz eines aus dem 13. Jahrhundert stammenden Privilegiums, der sogenannten Goldenen Bulle König Andreas II. zu sein, welches ihnen ein Widerstandsrecht verbürgte für den Fall, dass ein König ihre Rechte verletzen sollte. Die militärischen Stationen, die der Kaiser in Ungarn errichtete und die zum Schutz gegen die Türken notwendig waren, wurden von den Ungarn als unrechtmäßiger Druck empfunden. Besonders die ungarischen Protestanten, die von der österreichischen Regierung ihren Versprechungen zuwider unterdrückt wurden, hassten die Deutschen. Viele von ihnen hätten die Herrschaft der Türken, welche Andersgläubige gewähren ließen, der deutschen vorgezogen; aber auch viele Katholiken dachten so. Nach dem Frieden von Vasvar kam der angesammelte Widerwille zum Ausbruch. Bei Gelegenheit der Verlobung der Helene Zriny mit Franz Rákoczy kamen verschiedene Häupter der Bewegung unauffällig zusammen und beredeten die vorzunehmenden Schritte. Die angesehensten und tätigsten Häupter der Empörung waren Peter Zriny, Ban von Croatien, dessen Schwager Graf Frangipani und Graf Nadasdy, der reichste unter den ungarischen Magnaten. Sie hofften auf Hilfe von der Pforte, von Frankreich, von Polen, von Venedig. An alle diese Mächte wendeten sie sich insgeheim und erhielten auch hie und da ermunternde Antworten, aber keine bindenden Versprechungen. So zogen sich die Vorbereitungen durch mehrere Jahre hin unter wechselnder Teilnahme der einen und anderen, als die österreichische Regierung bereits durch Verräter von den Vorgängen unterrichtet war. Wie schwer erträglich die trotzige Selbständigkeit der Ungarn auch für die Regierung war und wie gern sie auch einen Anlass ergriffen hätte, sie zu brechen, ging sie doch behutsam mit den ungarischen Magnaten um. Sie waren große Herren, verschwenderisch, liebenswürdig, gute Gesellschafter, großartig im Auftreten, und unterhielten freundschaftliche Beziehungen zum österreichischen Adel. Trotz mancherlei Feindschaft und Eifersucht im einzelnen Fall fühlte sich der Adel aller Länder, die herrschende Schicht jener Zeit, wie eine internationale Kaste untereinander verbunden. Zunächst wurde versucht, ob sich die Schuldigen in Güte gewinnen ließen. Zriny, Frangipani und Nadasdy bekundeten Reue, als ihnen Vorhalte gemacht wurden, und gelobten, künftig dem Kaiser treu dienen zu wollen; sie setzten aber die Versuche, ausländische Hilfe zu gewinnen, fort. Damals begannen die Kriege Ludwigs XIV., die Pforte hielt zwar noch Frieden, konnte ihn aber jeden Augenblick brechen, die Lage Österreichs zwischen den beiden Erbfeinden war so, dass es geraten schien, den sich vorbereitenden ungarischen Aufstand im Keim zu unterdrücken. Als sie sich verloren sahen, flohen die Grafen Zriny und Frangipani nach Wien und ergaben sich der Gnade des Kaisers, die sie schon einmal erfahren hatten. Die Räte des Kaisers entschieden sich für Anwendung äußerster Strenge, das Gericht verurteilte Zriny, Frangipani und Nadasdy, der sich ahnungslos in Baden bei Wien aufgehalten hatte, außerdem noch den Grafen Tattenbach, einen etwas schwachköpfigen Steiermärker, zum Tode. Es war natürlich, dass die Angeklagten leugneten und sich auszureden suchten; aber die Art, wie einer die Schuld auf den andern abzuwälzen versuchte, macht einen peinlichen Eindruck. Als Menschen, die ganz im wilden Genuss ihrer Kraft und ihrer Leidenschaften gelebt hatten, brachen sie zusammen, als sie plötzlich aller äußeren Stützen beraubt waren. Indessen, als sie den Untergang vor Augen sahen, rafften sie sich auf und starben stolz und furchtlos. Nur Graf Tattenbach war haltlos und musste bis zuletzt mit tröstenden Beamten umgeben werden. Die Verurteilten wurden vor ihrem Tod aus der Adelsmatrikel ausgestoßen, was sie sehr schmerzte. Andrerseits wurde dafür gesorgt, dass der Henker sie bei der Vollziehung des Urteils nicht mit der Hand berührte. Ihr Vermögen wurde konfisziert, es bestand zum größten Teil in liegenden Gütern, daneben in edlen Steinen, kostbarem Gerät und Schmuck, auch in Geld. Von den Gütern kamen die meisten an die Familie Esterhazy, die dem Kaiser stets treu angehangen hatte. Graf Frangipani war der letzte seines Geschlechtes, die Familie Zriny erlosch mit dem Sohne des Hingerichteten. In Zrinys Tochter Helene, die in erster Ehe mit Rákoczcy vermählt war, brannte die Flamme des Hasses weiter. Mit ihrem zweiten Gatten, dem hochbegabten, glänzenden Emerich Tököly, entfachte sie den Aufruhr immer neu, schließlich aber mussten sie sich, von den Türken verlassen und verraten, nach Kleinasien zurückziehen, wo sie im Beginn des 18. Jahrhunderts gestorben sind.
Читать дальше