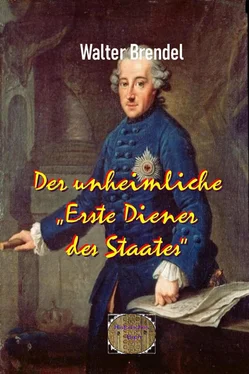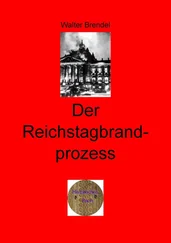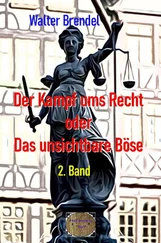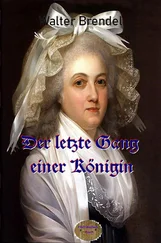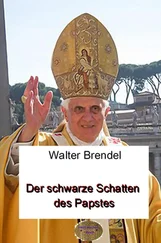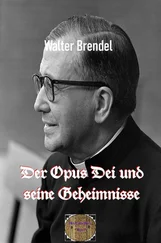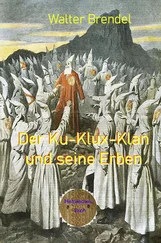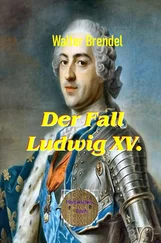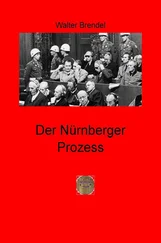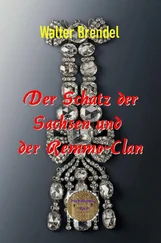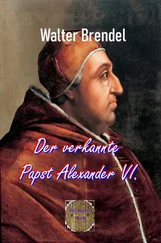Aber ihr Gemahl hat nur hochmütig geantwortet, auf Kinder solle sie sich keine Hoffnung machen. Im Übrigen wolle er selbst seinem Herrn Vater über den General von Grumbkow die entsprechende Antwort erteilen. Damit hat er abrupt das Zimmer verlassen.
Gar nicht lange danach ist General von Grumbkow übel und grausam genug gewesen, ihr recht unverblümt die Quintessenz des Briefes zu verraten, den ihr Gemahl als Antwort auf die Frage nach Nachkommenschaft an ihn gerichtet hat. Ungefähr so war der Inhalt: Er, der Kronprinz, habe sich durch die aufgezwungene Heirat lediglich die Freiheit erkaufen wollen, die ein verheirateter Prinz nun einmal genieße. Ohne Heirat würde ihm sein Herr Vater vermutlich noch lange keine eigene Hofhaltung gewährt haben. Was aber seine Gemahlin, die braunschweigische Prinzessin, anbeträfe - nun, sie sei nicht uneben, aber er würde sie nicht lieben können...
Die Königin vor Schloss Schönhausen (Porträt von Frédéric Reclam, nach 1764)
„Madame sind korpulenter geworden“ – mit diesem Satz begrüßte Friedrich II. nach dem Siebenjährigen Krieg seine Gemahlin Elisabeth Christine. Der König von Preußen war nicht gerade berühmt für seinen Charme. Gelegentlich – wie an diesem 30. März 1763 – überschritt er auch die Grenze der Geschmacklosigkeit. Elisabeth Christine hätte allen Grund gehabt, den zynischen Gemahl in die Schranken zu weisen. Immerhin war die Zeit auch an ihm nicht spurlos vorübergegangen: Aus dem strahlenden jungen König war ein alter Mann geworden, der sich beim Gehen auf einen Stock stützte. Doch Elisabeth Christine sagte nichts. Sie schwieg und litt leise.
Friedrich II. war sicher ein genialer Staatsmann: Er hatte sich im Ersten und Zweiten Schlesischen Krieg (1744/45) gegen die mächtigen Habsburger behauptet. Durch sein strategisches Geschick war Preußen im Siebenjährigen Krieg (1756–1763) eine europäische Großmacht geworden. Bei der Organisation seines Staates orientierte sich der König, der sich selbst einen Philosophen nannte, an den Idealen des aufgeklärten Absolutismus: In Preußen sorgte er für Ruhe und Ordnung, führte die Schulpflicht und eine – wenn auch eingeschränkte – Pressefreiheit ein. Friedrichs Verhalten war geprägt von Pflichtgefühl. Sich selbst betrachtete er als „ersten Diener seines Staates“. Seine Beziehung zum weiblichen Geschlecht jedoch ließ jede Genialität vermissen: Für Elisabeth Christine, die er vor seinem Regierungsantritt geheiratet hatte, empfand er weder Mitgefühl noch Achtung, geschweige denn Liebe. Sie war ihm einfach gleichgültig. Nachdem er König geworden war, vermied er jeden persönlichen Kontakt und schob sie ab auf das Schloss Schönhausen.
Elisabeth Christine wurde zu Lebzeiten übersehen und von der Nachwelt vergessen. Die meisten Biografen Friedrichs widmen ihr nicht mehr als ein paar Nebensätze. Dabei war sie keineswegs unattraktiv. Ein Zeitzeuge beschrieb Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern als „groß und vollkommen wohl gewachsen. Ich habe niemals eine in allen ihren Verhältnissen so regelmäßige Taille gesehen. Ihre Brust, ihre Hände, ihre Füße könnten einem Maler zum Muster dienen. Sie hat einen sehr zarten Teint und große blaue Augen, in welchen Lebhaftigkeit und sanftes Wesen miteinander um den Vorzug streiten.“
Die Prinzessin war am 8. November 1715 in Wolfenbüttel zur Welt gekommen. Ihre Eltern, Herzog Ferdinand Albrecht von Braunschweig-Bevern und seine Gemahlin Antoinette Amalie von Braunschweig-Blankenburg – eine Schwester der habsburgischen Kaiserin Elisabeth Christine, der Mutter Maria Theresias –, legten keinen gesteigerten Wert auf höfische Etikette. Ihre insgesamt 14 Kinder wuchsen in einer unbeschwerten und recht lockeren Atmosphäre auf. Die drittgeborene Elisabeth Christine zeigte beim Malen und Musizieren Talent. Für ihre Glaubenserziehung engagierte die Mutter einen Pastor, den „Informator“, unter dessen Einfluss die Prinzessin zu einer überzeugten Lutheranerin heranwuchs. Mit 16 Jahren, als sie dem preußischen Kronprinzen Friedrich versprochen wurde, war sie ein natürliches, hübsches und hoch gewachsenes Mädchen, das von der großen Liebe träumte und das auf die Frage, ob „Fritz“ ihr gefalle, errötete. Nun war die Vermählung der Braunschweiger Prinzessin mit dem preußischen Thronfolger am 12. Juni 1733 sicher keine Liebesheirat. König Friedrich Wilhelm I. von Preußen wollte in erster Linie stabile politische Verhältnisse schaffen, indem er seine Kinder mit den deutschen Fürstenhöfen verheiratete. Großes Eheglück kann man in solchen Fällen wohl nicht erwarten. Doch die Verbindung zwischen Friedrich und Elisabeth Christine stand unter einem besonders ungünstigen Stern: Das Ja-Wort des Bräutigams war erzwungen durch einen despotischen Vater, der von seinem Sohn Unterwerfung verlangte.
Die Beziehung zwischen Friedrich Wilhelm I. und seinem musisch begabten Filius war nie gut gewesen. Als Friedrich 1730 versuchte, mit seinem Freund Hans Hermann von Katte aus Preußen zu fliehen, eskalierte der Vater-Sohn-Konflikt: Die „Deserteure“ wurden gefasst und festgenommen. Der Preußenkönig ließ Katte vor den Augen des Sohnes hinrichten und Friedrich auf der Festung Küstrin einsperren. Dort hatte er Zeit, über sein Leben nachzudenken. Sein Hass auf den unerbittlichen Vater war größer denn je. Noch stärker war jedoch sein Wunsch, Kronprinz zu bleiben und König zu werden. Dieses Ziel war nur zu erreichen, indem er seine Wut hinunterschluckte und sich dem Willen des Vaters beugte: Er heuchelte Reue und zeigte sich gefügig, als er aufgefordert wurde, Elisabeth Christine zur Frau zu nehmen. Tatsächlich war sein Gehorsam aber nur Show. An einen Freund schrieb er: „Ich werde mein Wort halten. Ich werde heiraten. Aber sobald es geschehen ist, heißt es: Bonjour Madame et bon chemin.“ (Guten Tag, Madame, und gute Reise.) Zu diesem Zeitpunkt hatte Friedrich die Zukünftige zwar noch nicht gesehen, aber er war fest entschlossen, sich emotional nicht an sie zu binden und seiner eigenen Wege zu gehen.
Tragisch daran ist, dass Elisabeth Christine – jung, fromm, unschuldig und voller Träume – den drei Jahre älteren Friedrich aufrichtig verehrte und liebte, zumindest soweit man jemanden lieben kann, der emotional völlig verschlossen ist. Sie meinte es ernst, als sie Friedrich Wilhelm I. schrieb, wie sehr sie sich freue, im Hause Ho-henzollern aufgenommen zu werden. Der Empfang in Berlin muss für sie ziemlich ernüchternd gewesen sein: Friedrichs Schwestern, ihre künftigen Schwägerinnen, „erkannten gleich“, dass sie „erbärmlich roch“, „strohdumm“ und „schief gewachsen“ war. Die Königin hätte ihren Sohn lieber in den Armen einer englischen Prinzessin gesehen, konnte die Heiratspläne jedoch nicht gegen ihren Mann durchsetzen. Sie ließ daher die angehende Schwiegertochter aus Braunschweig spüren, dass sie nicht die erste Wahl war. Der Bräutigam selbst nannte seine Verlobte „die verfluchte Prinzessin von Bevern“ und ein „hässliches Geschöpf“. Sie war größer als er – vielleicht war das sein Problem. Das erste gemeinsame Beilager beim Hochzeitsfest verließ er jedenfalls nach einer halben Stunde und wendete sich einer Hofdame zu. Ein paar Tage später verabschiedete er sich von seiner jungen Gemahlin und begab sich wieder zu seiner Garnison in Ruppin. Elisabeth Christine blieb in Berlin bei ihrer neuen Verwandtschaft. Sie fühlte sich allein gelassen, litt unter den ständigen Intrigen ihrer Schwägerinnen und den Launen der Königin. Nur Friedrich Wilhelm I., der Despot, war stets freundlich zu ihr. Er schenkte dem jungen Paar auch ein eigenes Domizil – Schloss Rheinsberg in der Mark Brandenburg. Genau genommen schenkte der sparsame König dem jungen Paar jedoch nur zwei Drittel des Schlosses. Der Rest wurde mit Elisabeth Christines Mitgift finanziert. Erst als das Schloss 1736 bezugsfertig war, atmete die unglückliche Gattin des Kronprinzen auf. Drei Jahre hatte sie – ohne Beistand Friedrichs – das strenge Zeremoniell am Berliner Hof ertragen müssen. Nun konnte sie endlich ein neues Leben an der Seite ihres Gemahls beginnen. Die folgenden vier Jahre nannte sie selbst die glücklichsten ihres Lebens. Friedrich scheint in dieser Zeit seine Abneigung gegen die Gemahlin zumindest partiell überwunden zu haben. Er soll gesagt haben: „Ich war niemals in sie verliebt, aber ich müsste der niedrigste Mensch sein, wenn ich sie nicht aufrichtig schätzen wollte, denn sie hat erstens ein sanftes Gemüt, sie ist zweitens so gelehrig, wie man es sich nur wünschen kann, und drittens gefällig bis zum Übermaß.“
Читать дальше