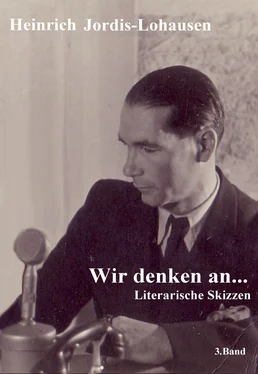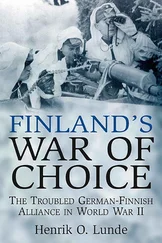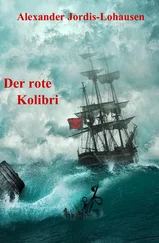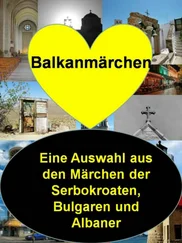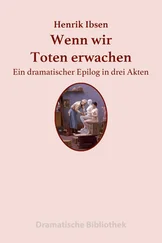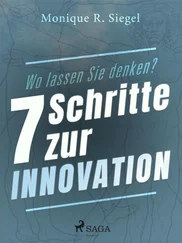Schon deutet sich in Einzelheiten die künftige Eigenart an, aber noch bedarf es mehrerer Jahre und zuletzt des Anstoßes einer neuen Umgebung, um sie endgültig zum Durchbruch zu führen.
Damals, im Jahre 1899, zog Egger nach 15-jährigem Aufenthalt an der Isar seiner jungen Gattin zuliebe nach Wien.
Die Wende brachte „Das Kreuz“ – wieder eine Darstellung aus den Tiroler Freiheitskämpfen. Schon schien es, als dränge die Ausdruckskraft Eggers zur eigentümlichen Dämonie eines Alfred Kubin.
Denn weit entfernt von der wohlgesetzten Würde der ausziehenden Alten in Defreggers „Aufgebot“, gemahnen Eggers nachtschattenhaft verzerrten Bauerngesichter unter den spukhaften Hüten mehr an ein Traumgeschehen, als an ein historisch-verbürgtes Erlebnis.
Doch brachte Egger dasselbe Thema 10 Jahre später abermals – nun unter dem Titel „Haspinger“ – und wieder in Form wie Ausdruck vom letzten völlig verschieden.
Was dort noch seltsam zwiespältig erschien, ist hier handfest und klar und alles Gespenstische unterdrückt, zugunsten eines rein dynamischen Prinzips – der mitreißenden Bewegung der sich im Gleichtritt bergab stürmenden Bauern.
Um deren Wirkung weiter zu verstärken, schneidet Egger die rückwärtigen Reihen unbedenklich durch den oberen Bildrand an Hals oder Schulter ab und unterstreicht damit gleichzeitig durch die Anonymität ihrer Körper den Eindruck des Unpersönlichen und Massenhaften. Nicht Köpfe oder Gesichter beherrschen das Bild wie im „Kreuz“, sondern Arme und Beine und alles Geistige wird bewusst zurückgedrängt zugunsten einer äußersten Steigerung von Rhythmus und Blut.
Stärker noch, weil tiefer gegründet, berührt Eggers gleichzeitiger „Totentanz“. Koboldhafte Klobigkeit erinnert an frühgotische Holzschnitzereien.
Er zeigt vier Bauern, zeitlos in ihrer Kleidung (wie die des „Haspinger“ auch), aber mit den Waffen der Bauernkriege – Morgenstern, Knüppel und schwere Büchse – auf ihrem Gang in den Krieg.
Kein Strich an ihren verschlossenen Gesichtern, keine Linie ihrer sich schwer über die Erde schleppenden Körper ist zu viel. Auch ohne den begleitenden Gevatter Tod scheint ihr Schicksal und das, das sie bringen, unwiderruflich. Das ganze Bild wie ein Bibelwort: „Wer das Schwert nimmt, wird auch durch das Schwert umkommen“.
Schon hier hat Egger wie überall da, wo dem menschlichen Antlitz tiefere Bedeutung zukam, streng nach der Natur gearbeitet und keine Mühe gescheut, die jeweils voll entsprechenden Modelle zu finden.
Er mied dabei jene ebenmäßig gefälligen Köpfe, denen Defregger seine Vorbilder entnahm. Er suchte vielmehr das Unebenmäßige, der Erde und dem Leben auf ihr in seiner ganzen Härte Verhaftete, in den Zügen seiner Bauern – und das Schwere und Ungeschlachte an ihnen, fern aller spielerischen Leichtigkeit.
Und wo immer er ausnahmsweise versuchte, ein Bild der Anmut zu zeichnen, versagte er, wie vor dem Bildnis seiner Tochter Lorli.
Seine Lieblingsmodelle waren die Bauern und Hirten der innersten Täler. Sie besuchte er Jahr für Jahr in der Einöde ihrer Höfe und galt ihnen als einer der Ihren. Diese Jahre vor dem ersten Weltkrieg waren für Egger Jahre vollreifen Gelingens. In keinem der späteren vollbrachte er ähnlich Ausgewogenes, Vollendetes, wie damals auf der stillen Höhe seines Lebens. Neben zeichnerisch betonten Entwürfen, wie dem „Haspinger“ stehen ausgesprochen malerisch empfundene wie die „Bergmänner“ oder die beiden ersten Fassungen des „Mittagsbrotes“. Dabei griff Egger mit Vorliebe auf schon einmal behandelte Motive zurück und gestaltete sie, immer wieder bewegt vom ewigen Gleichschlag bäuerlichen Lebens, immer wieder neu. Eine seiner größten Schöpfungen allerdings blieb unwiederholt. Sie heißt „Die ruhenden Hirten“ und gehört zu den größten Schöpfungen der deutschen Malerei überhaupt. Nichts als die massigen Umrisse zweier vor den Horizont gekauerten Gestalten. Über unkenntlichen Gesichtern die dunklen Schlagschatten formloser Hüte – wie sie von Hirten nirgendwo in der Welt getragen werden könnten – vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht vor tausend, vielleicht in tausend Jahren.
Alles landschaftlich oder zeitlich bedingte versinkt – wie in allen späteren Bildern Eggers – als unwesentlich. Diese Hirten sind nichts als ein Stück Erde in ihrer reglosen Hingabe an Licht, Stille und Wärme – ein Stück Erde, das sich sonnt – darüber ein einziges tiefes Blau und der Hauch einer Wolke.
Wahrscheinlich hat Egger neben seiner um einige Jahre älteren „Weihnacht“ kein Werk mehr geschaffen, das so unmittelbar für sich spricht wie dieses, und erreicht, was als letzter Zweck allen Kunstschaffens gilt: den Beschauer über seinem Schauen den Künstler vergessen zu lassen.
Gerade deshalb jedoch bedeuten die „Hirten“ für die Beurteilung der zeitgenössischen Malerei weniger als jene anderen, späteren Werke von Egger, an denen weder der Künstler noch der Zeitgeist übersehen werden können, weil sie ihre Betrachter mit unwiderstehlicher Gewalt zur Parteinahme herausfordern.
Das gilt schon vom „Totentanz“ und wird von Eggers Nachkriegswerken noch mehr gelten. Sagen diese weniger über das Ewige aus – in das auch sein Schaffen eingebettet lag wie das jedes Künstlers – so umso mehr über die Erde und über das Jahrhundert, mit welchem er lebte.
Der künstlerische Wert eines Bildes bemisst sich wohl nach seiner Nähe zu Gott, der kunstgeschichtliche aber – und das ist keineswegs immer dasselbe – nach der Nähe zu seiner Zeit.
Den fruchtbarsten Anstoß zur Auseinandersetzung mit dieser seiner Zeit gab Egger der Krieg, zumal seit 1915 der mit Italien, dessen Geschichte ihn, den eingerückten Soldaten und Frontmaler, nie mehr ganz los ließ und deren erster starker Niederschlag seine abermalige Abwandlung des im „Kreuz“ und „Haspinger“ versuchten Themas wurde: „Die Namenlosen“.
Wieder, wie dort, die sich ungezählt über eine horizontlose Fläche vorschiebenden Körper – in ihrer geduckten Gewalt vergleichbar einer alles bedeckenden Spinne aus menschlichen Gliedern ohne Antlitz und ohne Individualität – und bedrückendes Abbild unseres heutigen von den Massen geprägten Krieges.
Der Weg, den Egger von da ab weiterging – wie unter Verzicht auf jede Gefälligkeit – war einsam und steil. Er suchte Schrankenlosigkeit des Ausdrucks in allen seinen Bildern. Aber die war nur zu finden bei äußerster Enthaltsamkeit der Ausdrucksmittel. Bilder wie „Die Kriegsfrauen“, die „Generationen“, „Das Totenopfer“, „Missa eroica“, „Pieta“ oder selbst „Die Auferstehung“, bezeichnen sie als Meilensteine einer seltsamen Passion.
Und nur hie und da fallen in ihre karge Unbarmherzigkeit Lichtblicke wie die „Quelle“ oder sonnenübergossene Gemälde wie der im sengenden Mittag einsam verloren stehende „Blinde“ oder die letzte Fassung des „Mittagessens“.
Oder – wieder anders – die unheimliche Dämonie des „Weihwasser sprengenden Bauern“ (Gegenstück zu Wagners „Hunding“ im 1. Akt der „Walküre“), dessen letzte Fassung in eindrucksvoller Weise verwirklicht, was Egger nach dem Titel seiner selbst herausgegebenen Zeitschrift erstrebt: „Monumentale Kunst“.
„Monumental“, nennt Egger, „was seinen Ursprung in sich selbst hat, dekorativ, was ihn außer sich hat“ und das eine ist dem andern „so entgegengesetzt wie der Begriff ‚Stil‘ dem Begriff ‚Geschmack‘ wie der Begriff ‚Ausdruck‘ dem Begriff ‚Markierung‘.“
Wobei Stil entschleiert, was einer innerlich ist, den Charakter also, während seine Maske bloß kundtut, „als was er erscheinen möchte… seine Rolle. Stil ist das Vermögen, wahr … Geschmack, gefällig zu sein.“
Als „Feigheit“ empfand Egger die moderne Tendenz, dem Kampf mit der Materie aus dem Wege zu gehen. „Bildende Kunst ist Nachbildung, Beseelung der uns umgebenden Materie und ihre Neuschöpfung.“
Читать дальше