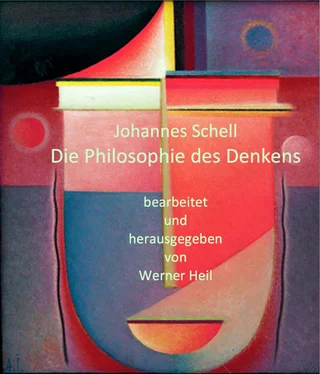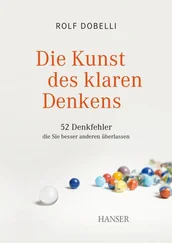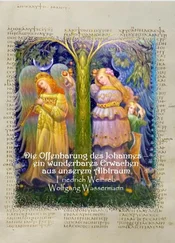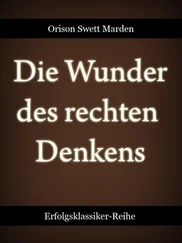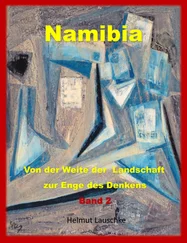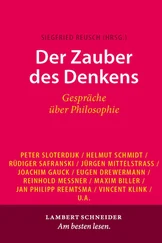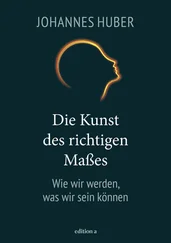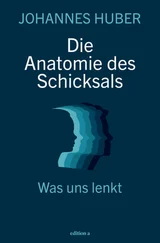18. Der Denkentzug
Ursprünglich waren wir von der Erkenntnis ausgegangen, dass unser Bewusstsein nur zwei Elemente enthält, die allem Denken zugrunde liegen, nämlich Begriff und Wahrnehmung. Etwas Drittes hatte sich nicht finden lassen. Und alles, was wir bisher herausgearbeitet haben, diente dem einzigen Zweck, die beiden in ein vertretbares Verhältnis zueinander zu bringen. Ohne uns dem Adäquationsbegriff der Wahrheit anschließen zu können, war uns doch klar geworden, dass Begriff und Wahrnehmung in dauernder Wechselwirkung miteinander stehen, die mit dem Problem der Wahrheit etwas zu tun haben muss. Statt nun zu deduzieren und Begriffe auseinanderzuspinnen, wollen wir wieder aktologisch vorgehen und dasselbe Verfahren anwenden, das den Seinsentzug charakterisiert: wir hatten festzustellen versucht, was der Begriff ohne Wahrnehmung wert ist; jetzt wollen wir die Gegenprobe machen und herausfinden, was von der Wahrnehmung ohne den Begriff übrigbleibt. Beide sind aufeinander angewiesen, wie uns die Erfahrungen und unsere Untersuchungen zeigen, aber wir wissen nicht, wie wir die Wechselwirkung beider verstehen sollen. Beim Seinsentzug ging uns alles Ideelle unter den Händen verloren, wir landeten bei einem Unmöglichen, beim „ideellen Schein“ - was wird nun geschehen, wenn wir den entgegengesetzten Weg gehen und einmal alles Denken, alle Begrifflichkeit aus der Wahrnehmung herausnehmen? Dabei ist es gleichgültig, wie das Denken philosophisch begriffen wird, denn jeder muss denken, wenn er sich in der Welt der Wahrnehmungen zurechtfinden will. Die genannte Wechselwirkung kann nicht geleugnet werden. Werfen wir also das gesamte Denken aus dem „Gegenüberstehenden“, aus dem „Vorgegebenen“, das wir nicht selbst produziert haben, hinaus. Zur Bezeichnung dieses speziellen Falles bediene ich mich des Ausdrucks „Denkentzug“, den ein Schüler Rudolf Steiners geprägt hat. Es sei noch einmal erwähnt, dass wir unter „Wahrnehmung“ alles verstehen, was durch den Begriff „Gegenüberstellung“ abgedeckt wird, also das raumzeitliche Weltpanorama und die innere Sphäre der Gefühle, Triebe und Bedürfnisse einschließlich der Vorstellungen und Erinnerungen.
Geben wir zum Denkentzug gleich Rudolf Steiner das Wort:
„Sehen wir uns die reine Erfahrung einmal an. Was enthält sie, wenn sie an unserem Bewusstsein vorüberzieht, ohne dass wir sie denkend bearbeiten? Sie ist bloßes Nebeneinander im Raum und Nacheinander in der Zeit, ein Aggregat aus lauter zusammenhangslosen Einzelheiten. Keiner der Gegenstände, die da kommen und gehen, hat mit dem anderen etwas zu tun. Auf dieser Stufe sind die Tatsachen, die wir wahrnehmen, die wir innerlich durchleben, absolut gleichgültig füreinander. Die Welt ist da eine Mannigfaltigkeit von ganz gleichwertigen Dingen. Kein Ding, kein Ereignis darf den Anspruch erheben, eine größere Rolle in dem Getriebe der Welt zu spielen als ein anderes Glied der Erfahrungswelt. Soll uns klar werden, dass diese oder jene Tatsache größere Bedeutung hat als eine andere, so müssen wir die Dinge nicht bloß beobachten, sondern schon in gedankliche Beziehung setzen. Das rudimentäre Organ eines Tieres, das vielleicht nicht die geringste Bedeutung für dessen organische Funktionen hat, ist für die Erfahrung ganz gleichwertig mit dem wichtigsten Organe des Tierkörpers. Jene größere oder geringere Wichtigkeit wird uns eben erst klar, wenn wir über die Beziehungen der einzelnen Glieder der Beobachtung nachdenken, das heißt, wenn wir die Erfahrung bearbeiten ... Die Welt ist uns auf dieser Stufe der Betrachtung gedanklich eine vollkommen ebene Fläche. Kein Teil dieser Fläche ragt über den anderen empor; keiner zeigt irgendeinen gedanklichen Unterschied von dem anderen. Erst wenn der Funke des Gedankens in diese Fläche einschlägt, treten Erhöhungen und Vertiefungen ein, erscheint das eine mehr oder minder weit über das andere emporragend, formt sich alles in bestimmter Weise, schlingen sich die Fäden von einem Gebilde zum anderen; wird alles zu einer in sich vollkommenen Harmonie.“ (Rudolf Steiner: Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung. Dornach 7. Auflage 1979, S. 30f.)
Es kommt Rudolf Steiner auf den Zusammenhang der Dinge an, die uns in ihrer Verschiedenheit entgegentreten. Er fährt fort:
„Damit glauben wir zugleich vor dem Einwand gesichert zu sein, dass unsere Erfahrungswelt ja auch schon unendliche Unterschiede in ihren Objekten zeigt, bevor das Denken an sie herantritt. Eine rote Fläche unterscheide sich doch auch ohne Betätigung des Denkens von einer grünen. Das ist richtig. Wer uns aber damit widerlegen wollte, hat unsere Behauptung vollständig missverstanden. Das gerade behaupten wir, dass es eine unendliche Menge von Einzelheiten ist, die uns in der Erfahrung geboten wird... Auf diesem Gesamtbilde erscheint nach Betätigung des Denkens jede Einzelheit nicht so, wie sie die bloßen Sinne vermitteln, sondern schon mit der Bedeutung, die sie für das Ganze der Wirklichkeit hat. Sie erscheint somit mit Eigenschaften, die ihr in der Form der Erfahrung vollständig fehlen“. (Rudolf Steiner: Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung. Dornach 7. Auflage 1979, S. 32f.)
So weit Rudolf Steiner. Natürlich erhebt sich hier eine Fülle erkenntnistheoretischer Fragen, auf die Rudolf Steiner in anderen Zusammenhängen eingeht und die wir später in Betracht ziehen werden, obwohl unsere früheren Ausführungen über das Denken vollauf genügen sollten. Sie werden an den zitierten Sätzen festgestellt haben, dass Rudolf Steiner sein Gedankenexperiment bis zu einer bestimmten Grenze ausführt. Erst viel später polarisiert er die beiden Ergebnisse, ohne sich näher darauf einzulassen. So lesen wir:
„Was im Menschen ist, ist ideeller Schein, was in der wahrzunehmenden Welt ist, ist Sinnenschein“. (Rudolf Steiner: Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung. Dornach 7. Auflage 1979, S. 137, Erste Anmerkung zur Neuauflage 1924)
Hier könnten sehr leicht Missverständnisse auftreten, dahingehend, dass man den Begriff „Schein“ als etwas interpretiert, das mit einer Vorspiegelung gleichzusetzen ist, der jede Realität fehlt. Natürlich gibt es das Ideelle, aber nicht für sich allein, sondern immer im Verbund mit den Phänomenen der Welt. Genauso verhält es sich mit dem „Sinnenschein“. Auch er ist existent, aber ohne ein Realitätserlebnis zu vermitteln, weil das ideelle Element unfassbar wird. Wir wollen deshalb zum besseren Verständnis die beiden Ausdrücke von Rudolf Steiner, mit denen er die subjektive Scheinwelt der bloßen Sinneserfahrung bezeichnet, nämlich „reine Erfahrung“ und „Sinnenschein“, so formulieren, dass Eindeutigkeit besteht: wir sprechen in Zukunft nur vom „begrifflosen Sinnenschein“, um den Gegensatz zum „ideellen Schein“ deutlich hervorzuheben. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Stellen Sie sich eine camera obscura vor, die irgendeinen Ausschnitt eines räumlichen Panoramas abbildet, rein nach optischen Gesetzen, also ohne die Möglichkeit, dieses so gewonnene Lichtbild in eigener Regie als begrifflich geordnete Erscheinung zu erfassen, d.h. genauso, wie es unsere physischen Wahrnehmungsorgane machen, die ja auch nicht denken können -, und Sie haben das, was wir den „begrifflosen Sinnenschein“ nennen. Dasselbe müssen Sie natürlich auch auf Ihre inneren Wahrnehmungen übertragen: Sie erfahren Gefühle aller Art von denen Sie nichts wissen könnten, wenn Sie keine begriffliche Vernetzung erfahren würden. Nun sind wir aber keine camera obscura, wir sind denkende Wesen, die dem jeweiligen „Schein“ zuordnen, was dem andern fehlt. Als für sich gesonderte Zustände sind diese bloß gedachten Formen des „Scheins“ überhaupt nicht erlebbar, weil der erste die Sinnesphänomene ausschließt und der zweite keine ideelle Profilierung aufweist. Wir könnten überhaupt kein Bewusstsein entwickeln, weil es ohne das Denken kein Bewusstsein und ohne die Sinneserfahrungen keinen Bewusstseinsinhalt geben würde. Woran sollten wir uns halten? Ein ontischer Dualismus ist völlig sinnlos. Die vorgenommene Spaltung in zwei verschiedene Sphären hat ausschließlich methodologischen Charakter. Hüten wir uns davor, methodologische Probleme in ontologische zu verwandeln. Wir sitzen sonst einer vordergründigen Täuschung auf, einer vermeintlichen ideellen Innen- und einer raumzeitlichen Außenwelt. Wir verabsolutieren vielleicht nur unsere menschliche Organisation, die einem geschichtlichen Entfaltungsprozess unterworfen sein könnte. Darüber später.
Читать дальше