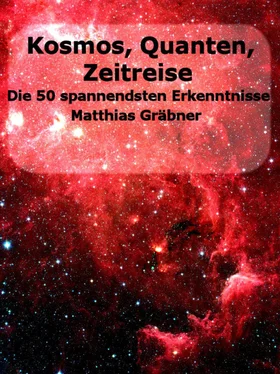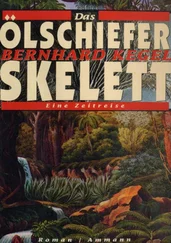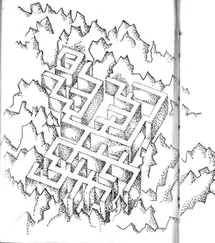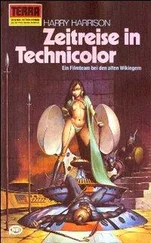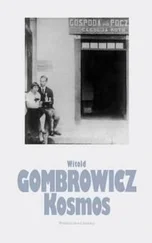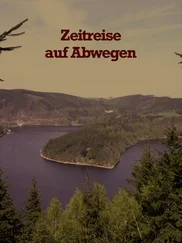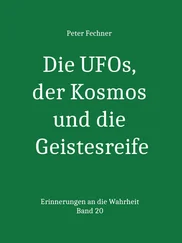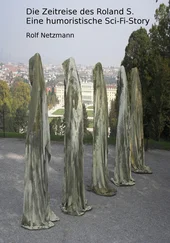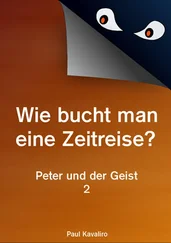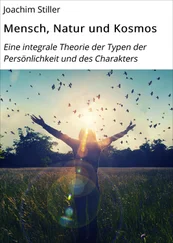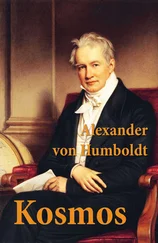Genau damit sind seit ein paar Jahren zwei internationale Forscherteams befasst. Denn das Microlensing-Verfahren bietet zwei Vorteile: Es verschafft einen guten statistischen Überblick über die Bestandteile des Universums, und es ist auch geeignet, recht kleine Planeten zu lokalisieren. In Nature berichten (http://dx.doi.org/10.1038/nature10092) die Forscher nun von den Ergebnissen ihrer Arbeit. Dem MOA-Team (Microlensing Observations in Astrophysics) etwa ist es gelungen, 50 Millionen Sterne der Milchstraße über zwei Jahre hinweg mindestens einmal pro Stunde zu überprüfen. Dabei entdeckten die Forscher gerade einmal 474 Microlensing-Ereignisse, von denen zehn kürzer als zwei Tage zu beobachten waren.
Je kürzer das Event, desto kleiner die Linse - bei weniger als zwei Tagen gehen die Forscher davon aus, dass die Linsen Planeten-, nicht Sternenmasse hatten. Die Wissenschaftler verglichen ihre Daten mit denen des OGLE-Teams (Optical Gravitational Lensing Experiment) - sieben der Ereignisse waren bei OGLE ebenfalls aufgefallen. Da sich auch über acht Jahre keine Periodizität zeigte, gehen die Forscher davon aus, dass es sich um mindestens sehr weit von ihren Gaststernen entfernte Planeten handeln muss - vermutlich auch um solche, die ganz allein durch das All wandern. Interessant ist aber auch die statistische Analyse: Sie zeigt, dass solche Planeten weit häufiger sein müssen, als man bisher annahm. Es sollten in der Milchstraße sogar mehr davon existieren, als es Sterne der Hauptreihe gibt.
Wie sind die einsamen Wanderer zu ihrer Reise aufgebrochen? Die Forscher vermuten, dass es sich um die Ergebnisse kosmischen Billards handeln könnte. In Systemen und protoplanetaren Scheiben mit mehreren großen Körpern kann es leicht dazu kommen, dass einerseits Gasriesen in große Nähe zu ihren Heimatsternen gelangen, ihre Brüder aber andererseits aus dem System geschleudert werden.
3. Blick in die Exo-Atmosphäre
15 Jahre Jagd nach fremden Planeten: Forschern ist erstmals ein zaghafter Blick in die Gashülle einer Super-Erde gelungen, die eine fremde Sonne umkreist.
Wenn das Außenteam von Raumschiff Enterprise auf einem fremden Planeten landet, behalten alle Raumfahrer brav ihren Helm auf - bis der Wissenschaftsoffizier sich mit einem Blick auf den Tricorder überzeugt hat, dass die Atmosphäre des Fremdgestirns auch wirklich atembar ist. Das ergibt natürlich mehr Dramatik (vor allem, wenn sich im Nachhinein zeigt, dass man irgendein fieses, extraterrestrisches Virus übersehen hat, das nun die Gedankenkontrolle übernimmt) als der langsame, geradezu umständliche Weg, den Astrophysiker in der Realität beschreiten.
Umso mehr überrascht, wie viele Details man offenbar auch aus der Ferne erkennen kann - auf den Warp-Antrieb können wir zwar nicht zurückgreifen, wohl aber auf ausgefeilte Beobachtungsmethoden in jedem Bereich des Spektrums. Die Jagd nach erdähnlichen Planeten im Weltraum ist dafür das beste Beispiel - erst vor gut 15 Jahren ging mit 51 Pegasi b das erste Exemplar ins Netz. Als Riesen-Planet vom Hot-Jupiter-Typ war er zwar wohl am einfachsten zu entdecken, doch für die Suche nach Weltraumobjekten mit erdähnlichen, lebensbefördernden Eigenschaften war er noch nicht der richtige Kandidat.
Für die Entdeckung von 51 Pegasi b kam die sogenannte Radialgeschwindigkeitsmethode zum Einsatz. Dabei nutzt man die Tatsache, dass ein System aus Planet und Sonne stets um einen gemeinsamen Schwerpunkt kreist. Beobachtet man den Stern, erkennt man seine Wankel-Bahn an einer Dopplerverschiebung seines Spektrums: Mal kommt das Gestirn ja auf den Beobachter auf der Erde zu, mal entfernt es sich von ihm. Verblüffend ist allerdings, welche kleine Abweichungen man auf diese Weise schon detektieren kann. Das Verfahren funktioniert natürlich umso besser, je kleiner der Größenunterschied von Stern und Planet ist. Bei Zwergsternen, die relativ eng von Planeten umlaufen werden, kommt man so auch tatsächlich erdähnlichen Welten auf die Spur.
Bei der Konkurrenzmethode hingegen, der Transitmethode, hofft man darauf, einen wichtigen Moment mitzubekommen: Wenn der vermutete Planet sich zwischen seinem Stern und dem Beobachter befindet, sollte es zu einer Abdunklung des Sternenlichts kommen. Die Transitmethode traut die Forschergemeinde derzeit mehr Erfolge insbesondere bei der Entdeckung möglichst kleiner Planeten zu. Voraussetzung ist natürlich, dass wir von der Seite auf die Bahnebene des Planeten schauen - sonst fällt die Bedeckung aus.
Relativ selten hat man bisher jedoch Planeten direkt beobachten können, wie es im Jahre 2008 Astronomen bei dem Drei-Planeten-System des Sterns HR 8799 gelang. Hier handelte es sich allerdings um recht große Welten mit mehreren Jupitermassen - die auch auf ein Problem der Planetenjagd aufmerksam machen: Man kann sich bei sehr großen Objekten nicht wirklich sicher sein, es mit einem Planeten zu tun zu haben. Ab 13 Jupitermassen könnte solch ein Objekt in seinem Inneren Deuterium fusionieren und wäre damit ein Brauner Zwergstern. In die Datenbank der Exo-Planeten, die erst kürzlich die 500. Entdeckung feierte, werden Exo-Objekte bis zu 20 Jupitermassen aufgenommen.
HR 8799 hat Anfang dieses Jahres erneut astrophysikalische Schlagzeilen gemacht: Von einem der Planeten des Systems konnten Forscher erstmals direkt ein Spektrum auffangen. Das Spektrum verrät viel über den Aufbau eines Objekts. Umso spannender ist die Entdeckung, von der nun Astrophysiker im Wissenschaftsmagazins Nature berichten: Ihnen ist es gelungen, einen Blick in die Atmosphäre von GJ 1214 b zu werfen. Dem Planeten mit knapp sieben Erdmassen hatte man schon eine relativ dichte Atmosphäre zugeschrieben.
Doch woraus besteht diese? Offenbar nicht aus Wasserstoff. Eine Wasserstoff-Atmosphäre würde wegen ihrer leichten Bestandteile sehr weit in den Raum reichen, es käme zu vielen Interaktionen mit dem Licht des Sterns - und es müssten sich entsprechende Linien im Spektrum nachweisen lassen. Genau diese Linien fehlen jedoch - und das kann im Umkehrschluss nur heißen, dass GJ 1214 b eine wasserreiche, von Wolkenbildung gekennzeichnete Atmosphäre besitzen muss, die sich wie bei der Erde in der Nähe der Oberfläche konzentriert. Über die Atembarkeit sagt das zwar noch nichts, aber da GJ 1214 b nur rund 40 Lichtjahre von der Erde entfernt seinen Mutterstern umkreist, könnte man ja auch ohne Warp-Antrieb in nicht allzu ferner Zukunft einen Kontrollflug unternehmen.
4. Das Universum ist eine Scheibe
Welche Gestalt hat das Universum?
Schon Einstein wusste, dass die Geometrie des Raums von seinem Inhalt abhängt. Diese Beziehung gilt auch andersherum: Wenn die Geometrie, die Form, des Universums bekannt ist, können wir auf seinen Inhalt schließen. Beide Fragen gehören in der Kosmologie gerade zu den heißesten Tagesordnungspunkten - noch vor 20 Jahren wären die Antworten darauf ganz anders ausgefallen. Erst genaue Analysen der kosmischen Mikrowellen-Hintergrundstrahlung gaben schlüssige Hinweise darauf, dass das Universum tatsächlich flach sein könnte.
Dann müsste sich allerdings seine Expansion mit der Zeit verlangsamen, gebremst von der allgegenwärtigen Gravitation. Die direkte Beobachtung sagt jedoch, dass genau das Gegenteil der Fall ist - das Weltall dehnt sich immer schneller aus. Zu erklären war diese Tatsache nur mit einer Größe, die man Dunkle Energie nannte - sie wirkt demnach der Gravitation entgegen. So verkehrte sich die ältere Annahme, das Universum bestünde vor allem aus Dunkler Materie (deren Existenz man aus Gravitationswirkungen ableitet, die nicht allein von sichtbarer, gewöhnlicher Materie herrühren können), in ihr Gegenteil: Im aktuellen Standard-Modell der Kosmologie nimmt man an, dass der Kosmos nur zu 4 Prozent aus gewöhnlicher Materie besteht, wie wir sie kennen, und auch nur zu 23 Prozent aus Dunkler Materie - aber zu 73 Prozent aus Dunkler Energie.
Читать дальше