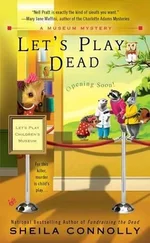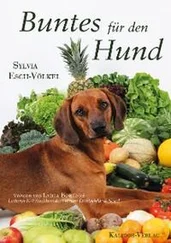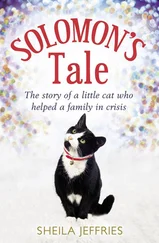Mein Bruder zerrte mich zum Auto zurück. Mit der rechten Hand hielt er mich grob am Arm gepackt, die linke hob er wie einen Schutzschild über seine Nase. Das Auto stand an der Kurve der Tartanbahn halb im lockeren Grund des Hanges. Ich wusste nicht, ob es ihnen überhaupt gelungen würde, den Wagen dort wieder raus zu bekommen, aber ich hätte mich darum nicht zu sorgen brauchen: Mein Bruder hatte in seinem sozialen Jahr beim Rettungsdienst Autofahren gelernt. Und wie!
Mein Vater drängte meinen Bruder von mir fort. Er zerrte mich zum Auto und warf meinen Oberkörper auf die Motorhaube. Sie war heiß und hart. Ich spürte seine Hand, die mir zwischen die Beine ging und im Schritt zupackte.
„Das“, sagte er heiser, „das hätten wir früher auch so gemacht!“
*
Zuhause hatten sie ein Zimmer für mich frei geräumt. Extra für mich! Das war irre, denn so viel Platz, dass wir Mädchen eines hätten alleine bewohnten können, das hatten wir sonst nicht.
So viel Mühe!
So viel Mühe, um mich einzusperren!
Auf der Rückfahrt vom Sportplatz hatte mein Vater im Dunkeln des Wegrandes meine Schwester ausgemacht, die dort ging und versuchte, davonzukommen. Er hatte meinen Bruder angeschrieen, er solle umdrehen, was dieser dann auch tat. Meine Schwester kreischte und schlug mit den Armen, aber ehe sie sich versah, saß sie auf dem Rücksitz neben mir.
In der Wohnung hatte mein Vater sie am Arm ins Mädelszimmer geschleppt und den Schlüssel hinter ihr herumgedreht.
Auch das Mädchenzimmer besaß ein Schloss, aber für mich und meine zukünftige Aufbewahrung musste das Zimmer meines Bruders her, denn einzig dieser Raum war geeignet für den gedachten Zweck. Brav hatte mein Bruder alle seine persönlichen Sachen ausgeräumt und saß nun auf seinem Bett, das er für mich aufgegeben hatte.
Unser Vater hatte mich auf seinen Schreibtischstuhl gesetzt und die Hände hinten neu gefesselt, damit die kurze Kette zwischen den Metallschließen der Handschellen zwischen den Streben der Lehne durchgeführt werden konnte.
„Du gehst nicht weg“, flüsterte mein Bruder, während Vater hinter meinem Rücken rumfummelte, „oder?“
Wie kam er denn auf die Idee?
„Du gehst nicht weg“, flüsterte mein Bruder, als Vater den Raum verlassen hatte, „oder?“
Bei Licht betrachtet sah seine Nase seltsam aus. Das Deckenlicht schien erbarmungslos darauf. Ob ich sie ihm gebrochen hatte?
Am liebsten hätte ich ihm entgegengeschleudert, dass ich bei solchen Geschwistern nun gar keinen Grund mehr erkennen konnte, zu bleiben. Abgesehen von diesem einen, zu vernachlässigendem Grund, dass ich keinen Schritt weit fort kam von seinem Stuhl.
Mein Bruder saß reglos, wie gelähmt auf seinem Fleck. Ein einziger, nur noch halblebendiger Trauerkloß. Ich fing an, mich zu fragen, weswegen er so traurig war. Weil er für meinen Vater den Bluthund gegeben hatte, der ihm die Beute riss? Weil er seiner eigenen Schwester das angetan hatte?
Oder war für ihn die Vorstellung so schlimm, dass ich fort wäre und es gäbe nie wieder ein Wiedersehen? War ich, wenn ich ihn allein ließ, überhaupt noch seine Schwester?
Tief in mir war ich mir auch nicht sicher, was ich getan hätte, wenn es gegolten hätte, einen der anderen einzufangen. Wenn meine Schwester oder mein Bruder vor mir geflohen wären, was hätte ich getan?
Ich kannte meinen Vater. Was er am besten drauf hatte, das war Gewalt. Darin bestand die Gemeinsamkeit zwischen ihm und den Verbrechern, die er früher gejagt hatte und die er heute noch einsperrte. Weder mein Bruder noch meine Schwester waren freiwillig auf die Jagd nach mir gegangen. Einzig vorwerfen konnte ich ihnen, dass sie sich so geschickt dabei angestellt hatten, mich zu stellen. Empörend war, dass sie nicht dazu bereit gewesen waren, für mich den Kopf hinzuhalten. Im Sinne des Wortes.
„Kommst du nun!“ brüllte mein Vater durch die Wohnung. Er saß nebenan mit einer Flasche Bier am Esstisch. „Oder hast du etwa schon gegessen?“
So harmlos klang eine Drohung bei ihm. Mein Bruder fuhr hoch und verließ blitzartig den Raum. Brav schloss er sein ehemaliges Kinderzimmer von außen zu.
Kaum dass er den Tisch draußen erreicht haben konnte, hörte ich Schritte, die zu mir zurückkehrten. Der Schlüssel im Schloss ging noch einmal, die Tür flog auf. Mein Vater sah zu mir herein. Ich fuhr zusammen, so heftig, dass die Eisen, in denen meine Hände steckten, mir fast die Handgelenke gebrochen hätten.
Mein Leben lang war ich in seiner Gegenwart hilflos gewesen. Natürlich, die meiste Zeit war ich ein Kind gewesen. Und potentiell bedroht, ja klar, das immer.
Aber nie zuvor hatte ich in Handschellen vor ihm gesessen.
„Du entkommst mir nicht! Hab ich dir das nicht versprochen? Hab ich dir das nicht immer wieder gesagt…?“
Mein Vater war es mit Hilfe seiner wohlmeinenden Kontakte gelungen, nach seinem Rausschmiss bei der Polizei direkt in den Vollzugsdienst hinüberzuwechseln. Dort wo wir wohnten war ein Frauengefängnis. Die Frauenstrafvollzugsanstalt Mersheim. Seitdem ich meinen Vater kannte, arbeitete er im Frauenstrafvollzug.
Obgleich das mein Leben lang schon so gewesen und somit normal war, kam es mir eines Tages seltsam vor. Überall gab es Frauen- und Männertoiletten; im Schwimmbad und in der Schule waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt. Meine Mutter war sogar in einem Mädchengymnasium gewesen, ehe mein Vater sie mit meiner ältesten Schwester geschwängert hatte und sie ohne Abschluss von der Schule abgegangen war. Sogar zuhause bekam mein Bruder Extraprügel, wenn er sich nachts bei uns im Mädchenzimmer versteckt hatte.
Wie also kamen männliche Vollzugsbeamte in den Frauenknast?
Nicht etwa, dass ich meinen Vater damals verdächtigt hätte, das irgendwie auszunutzen. Genau genommen lag meine Arglosigkeit aber einzig daran, dass ich nicht darauf gekommen wäre, wie er das hätte nutzen können.
Bei uns Kindern war ihm sein Job immer schon von Nutzen. Gerne führte er mich vor die Mauer, hinter der er täglich verschwand, packte mich im Nacken und hielt mich fest wie ein Stück Vieh. Mir blieb nur, auf die gewalttätig hohe Mauer, gesäumt mit in Schlaufen gelegtem Stacheldraht, zu starren, bis seine Hand nachließ.
„Da schau hin! Schau hin!“
Brandgefährlich war es, die Augen zu schließen. Denn immer bekam er das mit. Dann schüttelte er meinen Kopf in einem irren Tremolo, wie ein frischgebackener Vater, der sein brüllendes Baby tötet.
„Schau hin! Da schau hin!“
Ich sah auf die Gefängnismauer, den Stacheldraht und das trübselige Gebäude dahinter und würdigte, was ich sah, in einer meines Vaters Vorstellungen angemessenen Form: Ich machte mir vor Angst in die Hose.
„Dort hinter Mauern und Stacheldraht“, versprach er mir heiser, „dort werden wir uns wieder sehen! Mach du nur weiter wie bisher! Da drin werd ich dich eines Tages Willkommen heißen! Willkommen, Schätzlein, Herzallerliebst – du wirst sehen! Eines Tages sehen wir uns wieder!“
Erst später, viel später, habe ich darüber nachgedacht, was ein Psychopath wie mein Vater im Frauengefängnis anrichtet. Was er dort treibt.
Hat sich das irgendjemand außer mir je gefragt?
Ich wusste nicht, was mit mir passieren sollte. Als ich als Kind meinen Vater als gefährlich empfunden hatte, hatte ich ihn mit den Augen eines Kindes gesehen, und war die möglichen Strafen mit dem Hirn eines Kindes durchgegangen. Wie leicht ist es, ein Kind zu bestrafen!
Heute war ich erwachsen, und meine Ängste galten nicht mehr einem Schlag aus seiner Hand, einem versagten Abendessen oder einer Woche Fernsehverbot. Ein Blick auf seine Mauer konnte mich nicht mehr schrecken. Meine Welt war größer geworden. Doch er kam mir noch immer gefährlich vor.
Читать дальше