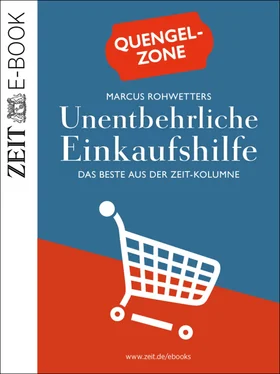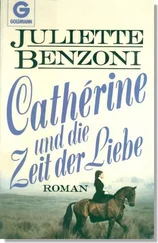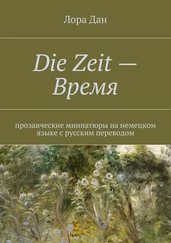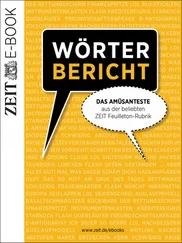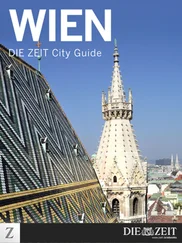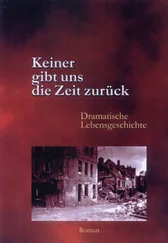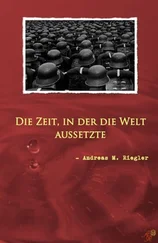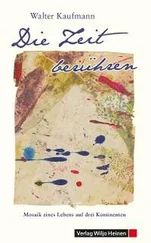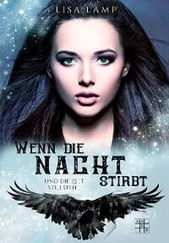VON MARCUS ROHWETTER
DIE ZEIT, 14.08.2013 Nr. 34
Verkauft wird nahezu alles. Autos beispielsweise werden für viel Geld verkauft. Kaugummis werden für wenig Geld verkauft. Und Kunden werden für dumm verkauft – in jeder Preisklasse.
Nichts ist umsonst, das weiß der Volksmund, selbst der Tod kostet das Leben. Und weil im Kapitalismus eben alles seinen Preis hat, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass einem etwas geschenkt wird. Falls doch, ist es dermaßen unglaublich, dass die Kunden extra darauf hingewiesen werden müssen. Und zwar gleich doppelt. Denn sicher ist sicher. Sonst verstehen sie es nicht.
Deswegen gibt es das »Gratis-Geschenk«. Ein solches erhält, wer bei den Make-up-Botanikern von Yves Rocher ein Näpfchen mit Pflanzencreme oder sonst was bestellt. Man muss dafür also nichts bezahlen, denn es ist ein Geschenk. Und gratis obendrein. Also kostenlos. Falls man es noch nicht verstanden hat. Ein kostenloses »Gratis-Geschenk« gibt es auch beim Werkzeug-Versandhandel Westfalia oder bei den meisten Zeitungen, die mit einem »Gratis-Geschenk« Probeabos attraktiver machen wollen. Und vielerorts mehr. Eine Leserin aus Mainz bemerkte diese Sprachschluderei.
Bei »Gratis-Geschenken« handelt es sich meist um die Insolvenzmasse von 1-Euro-Shops und/oder ästhetischen Sondermüll: grellbunte Plastikschüsseln, eine Qual fürs Auge. Irgendwelchen gläsernen Deko-Krempel für die Fensterbank, der so hässlich ist, dass sogar Recyclinghöfe die Annahme verweigern. Armbanduhren, deren Zeiger bei der ersten Erschütterung abbrechen und deren Armband nach zwei Wochen einreißt.
Warum das Zeug verschenkt wird? Na, weil es sich nicht verkaufen lässt! Und zurücknehmen will es der Spender auch nicht. Steht immer im Kleingedruckten: Ihr »Gratis-Geschenk« dürfen Sie in jedem Fall behalten. Falls man es noch nicht verstanden hat.
VON MARCUS ROHWETTER
DIE ZEIT, 02.08.2012 Nr. 32
Heute finden sich auf Lebensmittelverpackungen mehr Auszeichnungen als seinerzeit an der Uniform von Oberst Gaddafi. Gütezeichen, Prüfsiegel, Qualitätsorden – alle bunt und irgendwie offiziell. Manche dieser Zeichen basieren auf einer strengen Kontrolle, manche belegen bloß das kreative Potenzial der Verpackungsdesigner. Einige sind ehrlich, andere irreführend, viele nichtssagend.
Dann gibt es noch die seltsamen. In diese Kategorie fällt eine Medaille, die in Gold, Silber oder Bronze zahlreiche Produkte adelt, von Milch bis hin zu Gummibärchen: »Jährlich DLG-prämiert«.
Davor sollte man kurz innehalten. Wenn man diese Auszeichnung jährlich bekommt – also jedes Jahr aufs Neue –, was mag sie dann wert sein? Wie streng sind wohl die Kriterien, wenn das schon klar ist? Man kann die Formulierung auch so verstehen, dass ein Produkt die Medaille im nächsten und im übernächstem Jahr wieder erhalten wird. Aber wenn das schon feststeht: Was soll dann der Quatsch?
Man muss dazu wissen, dass die DLG, die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, ihrer Selbstdarstellung zufolge »eine der vier Spitzenorganisationen der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft« ist. Unklar ist, wozu die Branche gleich vier Spitzenverbände benötigt. Die DLG jedenfalls vergibt unter anderem jene Medaillen. Eine Beurteilung der Ware »in lebensmittelrechtlicher Hinsicht« sei mit der Prüfung aber »nicht verbunden«, teilt die DLG mit. Man teste vor allem »sensorisch« (»Farbe, Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack«).
Mit dem Etikett »jährlich prämiert« dürfe sich jeder schmücken, der die Prüfung in »mindestens zwei aufeinanderfolgenden Jahren« bestanden hat. Viel ist das ja nicht für eine Medaille mit der Aura der Ewigkeit. Bronze, Silber und Gold sollen Kunden wohl eher an die Olympischen Spiele erinnern. Bei denen wahre Bestleistungen prämiert werden.
VON MARCUS ROHWETTER
DIE ZEIT, 04.10.2012 Nr. 41
Nichts ist natürlicher als die Natur. Das ist schon aus phonetischer Sicht ganz selbstverständlich, und deswegen herrscht darüber ein gesellschaftlicher Konsens. Ebenso akzeptiert ist die Gleichsetzung von natürlich und gut – was schon sehr viel seltsamer ist.
Man kann das immer dann beobachten, sobald die Frage aufkommt, ob Nahrung aus biologischem Anbau gesünder ist als solche aus konventionellem. Dann geht es rund. Als gesichert kann immerhin gelten, dass Biokost besser ist für die Umwelt, und das ist definitiv eine gute Sache. Inwieweit ein monokulturelles Maisfeld überhaupt natürlich sein kann (ob Bio oder nicht), soll jeder für sich selbst entscheiden. Die romantische Verklärung des Natürlichen führt jedoch dazu, dass jeder Lebensmittelhersteller bloß das Wort »Natürlich« auf die Packung drucken muss, damit wir glauben, es handele sich um ein gutes Produkt.
Was ja nicht so sein muss. Baumrinde ist natürlich. Schimmel. Maden. Selbst ein Hundehaufen. Alles pure Natur. Abgesehen davon, ist die Natur gar nicht gut, sondern brutal und echt gemein zu Schwächeren. Lassen Sie sich mal im Amazonasdschungel oder im australischen Outback aussetzen statt im Supermarkt, dann lernen Sie jede Menge fieser Viecher kennen und werden schon sehen.
Übrigens ändern Supermarktkunden ihre positive Einstellung zur Natürlichkeit radikal, sobald sie eine Drogerie betreten. Dann kaufen sie große Mengen chemischer Wunderwaffen, um das zu bekämpfen, was natürlich ist: Falten im Gesicht, Grau im Haar, den eigenen Körpergeruch. Da ist Chemie plötzlich ganz toll, Natur hingegen total doof. Auch das ist sehr seltsam.
VON MARCUS ROHWETTER
DIE ZEIT, 06.12.2012 Nr. 50
Zum Standardrepertoire der Lebensmittelindustrie gehört der Hinweis, Produkte seien »ohne Chemie« hergestellt. Das klingt bei flüchtigem Drüberlesen sogar angenehm. Wer genauer drüber nachdenkt, bemerkt allerdings, dass es sich um eine klassische Null-Aussage handelt. Man darf sich darunter vorstellen, was immer man will.
Ich denke beim Wort Chemie auch schnell an Pinselreiniger, Unkrautvertilger oder Autolacke. Die Botschaft, etwas sei »ohne Chemie«, ist dennoch ein wunderbares Beispiel dafür, wie leicht sich Verbraucher intellektuell sedieren lassen. Gut, ich habe im Chemieunterricht in der Schule vielleicht nicht ganz aufgepasst, deshalb bleibt mir jetzt nur noch der Besuch bei Wikipedia. Dort wird Chemie definiert als »eine Naturwissenschaft, die sich mit dem Aufbau, den Eigenschaften und der Umwandlung von Stoffen beschäftigt«.
Bedeutet: Chemie ist überall. Ohne Chemie gäbe es kein Bier, keinen Käse, keinen Salat und keine Weinbergschnecken. Salz ist Chemie (NaCl nämlich, aber das klingt schon wieder gefährlich), und sogar H₂O, also Wasser, ist eine chemische Verbindung aus Wasserstoff und Sauerstoff.
Apropos: Wussten Sie, dass praktisch jedes Lebensmittel und somit auch Babynahrung Dihydrogenmonoxid enthält, das – in reiner Form eingeatmet – oft tödlich wirkt? Ein Klassiker der Naturwissenschaft, googeln Sie mal. Aber egal: »Ohne Chemie« gäbe es nichts. Auch keine chemiefreien Lebensmittel. Wer es dennoch anders sieht, verhält sich wie ein verängstigtes Kind. Das schließt ja auch die Augen, um die Welt verschwinden zu lassen.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.