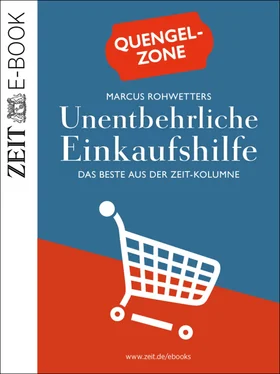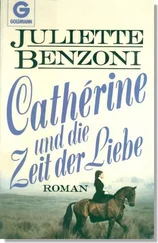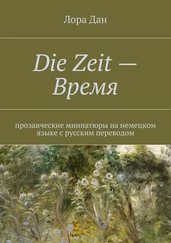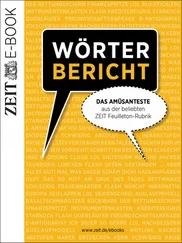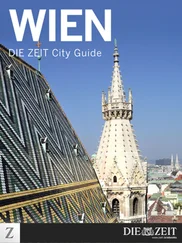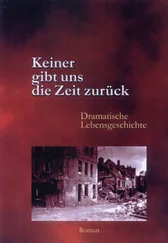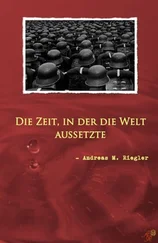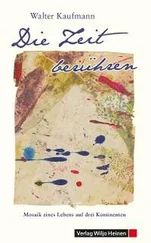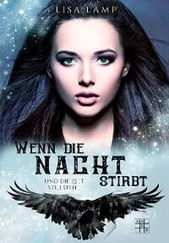»Natürlich« »Natürlich« VON MARCUS ROHWETTER DIE ZEIT, 04.10.2012 Nr. 41 Nichts ist natürlicher als die Natur. Das ist schon aus phonetischer Sicht ganz selbstverständlich, und deswegen herrscht darüber ein gesellschaftlicher Konsens. Ebenso akzeptiert ist die Gleichsetzung von natürlich und gut – was schon sehr viel seltsamer ist. Man kann das immer dann beobachten, sobald die Frage aufkommt, ob Nahrung aus biologischem Anbau gesünder ist als solche aus konventionellem. Dann geht es rund. Als gesichert kann immerhin gelten, dass Biokost besser ist für die Umwelt, und das ist definitiv eine gute Sache. Inwieweit ein monokulturelles Maisfeld überhaupt natürlich sein kann (ob Bio oder nicht), soll jeder für sich selbst entscheiden. Die romantische Verklärung des Natürlichen führt jedoch dazu, dass jeder Lebensmittelhersteller bloß das Wort »Natürlich« auf die Packung drucken muss, damit wir glauben, es handele sich um ein gutes Produkt. Was ja nicht so sein muss. Baumrinde ist natürlich. Schimmel. Maden. Selbst ein Hundehaufen. Alles pure Natur. Abgesehen davon, ist die Natur gar nicht gut, sondern brutal und echt gemein zu Schwächeren. Lassen Sie sich mal im Amazonasdschungel oder im australischen Outback aussetzen statt im Supermarkt, dann lernen Sie jede Menge fieser Viecher kennen und werden schon sehen. Übrigens ändern Supermarktkunden ihre positive Einstellung zur Natürlichkeit radikal, sobald sie eine Drogerie betreten. Dann kaufen sie große Mengen chemischer Wunderwaffen, um das zu bekämpfen, was natürlich ist: Falten im Gesicht, Grau im Haar, den eigenen Körpergeruch. Da ist Chemie plötzlich ganz toll, Natur hingegen total doof. Auch das ist sehr seltsam.
»Ohne Chemie« »Ohne Chemie« VON MARCUS ROHWETTER DIE ZEIT, 06.12.2012 Nr. 50 Zum Standardrepertoire der Lebensmittelindustrie gehört der Hinweis, Produkte seien »ohne Chemie« hergestellt. Das klingt bei flüchtigem Drüberlesen sogar angenehm. Wer genauer drüber nachdenkt, bemerkt allerdings, dass es sich um eine klassische Null-Aussage handelt. Man darf sich darunter vorstellen, was immer man will. Ich denke beim Wort Chemie auch schnell an Pinselreiniger, Unkrautvertilger oder Autolacke. Die Botschaft, etwas sei »ohne Chemie«, ist dennoch ein wunderbares Beispiel dafür, wie leicht sich Verbraucher intellektuell sedieren lassen. Gut, ich habe im Chemieunterricht in der Schule vielleicht nicht ganz aufgepasst, deshalb bleibt mir jetzt nur noch der Besuch bei Wikipedia. Dort wird Chemie definiert als »eine Naturwissenschaft, die sich mit dem Aufbau, den Eigenschaften und der Umwandlung von Stoffen beschäftigt«. Bedeutet: Chemie ist überall. Ohne Chemie gäbe es kein Bier, keinen Käse, keinen Salat und keine Weinbergschnecken. Salz ist Chemie (NaCl nämlich, aber das klingt schon wieder gefährlich), und sogar H₂O, also Wasser, ist eine chemische Verbindung aus Wasserstoff und Sauerstoff. Apropos: Wussten Sie, dass praktisch jedes Lebensmittel und somit auch Babynahrung Dihydrogenmonoxid enthält, das – in reiner Form eingeatmet – oft tödlich wirkt? Ein Klassiker der Naturwissenschaft, googeln Sie mal. Aber egal: »Ohne Chemie« gäbe es nichts. Auch keine chemiefreien Lebensmittel. Wer es dennoch anders sieht, verhält sich wie ein verängstigtes Kind. Das schließt ja auch die Augen, um die Welt verschwinden zu lassen.
»Rein pflanzlich«
»Solange Vorrat reicht«
»Umweltfreundlich«
BESSER ESSEN, MEHR TRINKEN
»100 Prozent Geschmack«
»Aktivierend«
»Alkoholfrei«
»Aus friedfertigem Landbau«
»Ausgesuchte Qualität«
»Dreimal Nein«
»Elefantenkaffee«
»Extra stilles Wasser«
»Fleisch«
»Handgesalzen«
»Kontrollierter Anbau«
»Lernspaß«
»Ohne Ende«
»Seitan«
»Verbesserte Rezeptur«
»Vollmondabfüllung«
»Weidemilch«
GEFANGEN IN DER WELLNESS-OASE
»Dauerpreis-Garantie«
»Inspiriert von der Genforschung«
Küchenrollen
»Limited Edition«
»Mit Diamant-Partikeln«
»Oase der Ruhe«
»Superkleber«
»Turbo Aufwach-Kick«
»Von Dermatologen getestet«
LIFESTYLE FÜR DEPPEN
»Atmungsaktiv«
»Body Bags«
»Designersofas«
»Echt«
»Getrennt Waschen«
»Gruppenreisen für Individualisten«
Lufthansas Mops-Club
»Manufaktur«
»Ohne Zusätze«
»Outdoor-Autos«
»Smart Home«
Weitere ZEIT E-Books
Impressum
Von heißer Luft getrieben
VON MARCUS ROHWETTER
DIE ZEIT, 20.06.2013 Nr. 26
Jede Innenstadt hat ihre A-, B- und C-Lagen. Das Lagen-Alphabet kann jeder Kaufmann auswendig aufsagen, und je weiter hinten die Lage eines Ladenlokals im Alphabet einzuordnen ist, desto schlechter ist sie. In den A-Lagen der großen Metropolen findet man beispielsweise Filialen von Prada, Jil Sander oder Louis Vuitton, wohingegen Schuhdiscounter, Jeansläden und Kaufhäuser die B-Lagen prägen. Ganz unten in der Lagenhierarchie stehen Sonnenstudios, Läden für Bodybuilder-Spezialnahrung und natürlich die »Alles ab 1 Euro«-Geschäfte.
Zu erkennen sind diese von außen an den großen roten Aufklebern mit ebenjenem Spruch auf den Schaufenstern. Im Innern bezaubern sie mit der größtmöglichen Auswahl an Plastikprodukten in ungewöhnlichen Farben. Duschhauben, Haarreife, Trinkbecher, Luftpumpen – und »alles ab 1 Euro«.
Der Werbespruch ist ein Klassiker der Rubrik: Nicht falsch und doch gelogen. Denn »alles ab 1 Euro« ist immer richtig, sofern es in einem Millionen Teile umfassenden Sortiment auch nur ein einziges Teil gibt, das einen Euro kostet. Beispiel: Nur mal angenommen, in einer Luxusboutique könnte man für 1 Euro einzelne kleine grüne Plastikknöpfe erwerben, wohingegen alles andere sonst um ein Vielfaches teurer wäre und schon ein Paar Socken 200 Euro kosten würde – dann wäre der Satz korrekt.
Im »ab« steckt das Geheimnis, dass den Spruch so sinnlos werden lässt, dass man sich ihn gleich ganz schenken könnte. Aber das will der gemeine Für-Dumm-Verkäufer nicht, denn irgendwie wollen seine Kunden sich ja wohl doch ein klein wenig der Illusion hingeben. Hinters Licht geführt werden sie ja in jedem Fall. Natürlich ist der Krempel in den Luxusläden der A-Lagen in der Regel hoffnungslos überteuert. Dass in den 1-Euro-Läden aber alles sein Geld wert sein muss, ist damit noch lange nicht bewiesen.
VON MARCUS ROHWETTER
DIE ZEIT, 22.11.2012 Nr. 48
Gut, dass Selbstbetrug keine Straftat ist. Sonst säßen wohl schon viele Verbraucher im Gefängnis. Weil sie sich etwas vormachen. Oder einreden. Etwa, dass sie »bewusst konsumieren« und damit Gutes tun.
Wie trügerisch das Märchen vom bewussten Konsum ist, lässt sich schnell herausfinden, indem man den Begriff in sein Gegenteil verkehrt. Das ist eine bewährte Methode. Ergibt das Gegenteil einen Sinn, so handelt es sich bei dem ursprünglichen Ausdruck um eine Differenzierung. Andernfalls handelt es sich um Bullshit. Also: Bewusster Konsum, das klingt gut. Aber das Gegenteil? Bewusstloser Konsum. Gibt’s nicht. Wenn es aber bewusstlosen Konsum nicht gibt, ergibt auch bewusster Konsum keinen Sinn.
Trotzdem finden wir bewussten Konsum meistens gut. Der Industrie kommt das sehr gelegen, und ich würde wetten, dass sie das Märchen vom bewussten Konsumenten nach Kräften mitgeschrieben hat.
Читать дальше