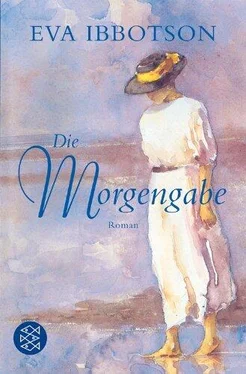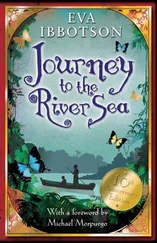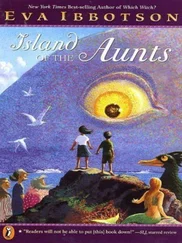«Eine Bauerndirn mit den Augen Nofretetes», sagte ein angesehener Ägyptologe, der zum Abendessen kam.
Sie unterhielt sich für ihr Leben gern, sie mußte alles wissen; sie war ein kleiner Tausendsassa und überzeugt, sie könnte die ganze Welt in Ordnung bringen.
«Solche Wörter sollte sie aber noch nicht kennen!» sagten Leonies Freundinnen schockiert.
Doch die Wörter hatten es Ruth angetan. Und das Wissen.
Der Professor, ein großer, patriarchalisch wirkender Mann mit grauem Bart, an die Bewunderung seiner Studenten gewöhnt, führte sie selbst durch das Naturhistorische Museum, in dem er seine eigenen Räume hatte. Mit sechs war sie mit den Mühen und Komplikationen, die mit der Paarung einhergehen, bereits bestens vertraut.
«Ein bißchen traurig ist das schon, nicht?» sagte sie, während sie an der Hand ihres Vaters die eingeglasten Spinnen betrachtete, die ihren Männchen die Köpfe abbissen, um die Befruchtung zu beschleunigen.
Von der weltfremden Tante Hilda, die es fertigbrachte, morgens ihren Rock verkehrt herum anzuziehen und so in die Universität zu gehen, lernte Ruth den Wert der Toleranz.
«Man darf fremde Kulturen nicht an den Maßstäben der eigenen Kultur messen», sagte Tante Hilda, die an einer Monographie über ihre geliebten Mi-Mi schrieb – und Ruth akzeptierte schnell, daß es bei gewissen Stämmen eben zum Ritual gehörte, die Großmutter zu verspeisen.
Die Forschungsassistenten und Hilfskräfte der Universität kannten sie so gut wie die Präparatoren im Museum. Mit acht durfte sie ihrem Vater beim Sortieren der Zähne der fossilen Höhlenbären helfen, die er in der Drachenhöhle gefunden hatte, und es war klar, daß sie später seine Assistentin werden, seine Bücher tippen und ihn auf seinen wissenschaftlichen Exkursionen begleiten würde.
Ihr kleiner kahlköpfiger Onkel Mishak, der noch immer um seine verstorbene Frau trauerte, führte sie in eine ganz andere Welt ein. Mishak hatte zwanzig Jahre lang pflichtbewußt in der Personalabteilung des Warenhauses seines Bruders gearbeitet, aber im Grunde seines Herzens war er ein Landkind geblieben und pflegte durch die Stadt zu streifen, wie er früher durch die böhmischen Wälder gestreift war. Wenn Ruth mit Mishak zusammen war, gab es immer irgendein Tier zu füttern – eine Ente im Stadtpark, ein Eichhörnchen – oder etwas zu streicheln – einen müden Fiakergaul an den Toren zum Prater, die steinernen Zehen des Neptun auf dem Springbrunnen in Schönbrunn.
Und natürlich war da ihre Mutter, Leonie, die sie herzte und küßte, die sie tadelte und schalt; die zutiefst verletzt sein konnte von der bissigen Bemerkung einer Großtante und nichts mehr von dieser Tante wissen wollte, nur um sich bei nächster Gelegenheit mit einem riesigen Blumenstrauß unter Tränen mit ihr zu versöhnen; die Ruth in das Warenhaus ihres Großvaters schleppte, um sie mit Matrosenkleidern und Lackschuhen und seidenen Faltenröckchen auszustaffieren, und die sie anschrie, wenn sie von der Schule nach Hause kam.
«Wieso bist du in Englisch nicht die Beste? Du hast dich von dieser dummen Inge überflügeln lassen», rief sie dann wohl – und lud Ruth gleich darauf zum Trost zu Schokoladeneclairs bei Demel ein. «Na ja, sie hat ja auch eine Nase wie ein Ameisenbär, die Arme, da kann man es ihr gönnen, daß sie wenigstens in Englisch die Beste ist», sagte sie abschließend; aber im folgenden Jahr importierte sie eine schottische Gouvernante, um dafür zu sorgen, daß ihre Ruth in Englisch alle übertrumpfte.
Das Kind wuchs heran; kapriziös, leidenschaftlich, klug; empfahl Geburtenkontrolle für die Katze seiner Großmutter und weinte herzzerreißend, als es bei der Schulaufführung zu Weihnachten nicht die Schneekönigin spielen durfte, sondern nur einen Eiszapfen.
«Hört sie eigentlich nie zu reden auf?» pflegten Leonies Freundinnen zu fragen – dabei war sie ganz leicht zum Schweigen zu bringen. Eine Zurechtweisung, ein unfreundliches Wort ließen sie augenblicklich verstummen.
Und noch etwas: Musik.
Ruths Liebe zur Musik war so sehr Teil ihres Wiener Erbes, daß zunächst keinem auffiel, wie ausgeprägt sie war. Von frühester Kindheit an war sie wie gebannt und durch nichts abzulenken, wenn irgendwo Musik gemacht wurde, und es gab bestimmte Orte, Musikplätze nannte sie sie, zu denen es sie hinzog wie einen durstigen Büffel zum Wasserloch.
Da war einmal das Erdgeschoßfenster der schäbigen alten Hochschule für Musik, in der das Ziller-Quartett zu proben pflegte; dann der Konzertsaal – der Musikverein –, wo man die Philharmoniker spielen hören konnte, wenn der Hausmeister so nett gewesen war, die Tür offenzulassen. Ein blinder Geiger unter all den Straßenmusikanten fesselte sie so sehr, daß sie vor lauter Konzentration ganz bleich wurde. Ihre Eltern zeigten Verständnis; sie bekam Klavierstunden, die ihr Freude machten, sie bestand ihre Prüfungen, aber sie sehnte sich nach einer Brillanz, die ihr fehlte.
Kein Wunder, daß sie lange Zeit mit großen Augen den Geschichten von ihrem Vetter Heini in Budapest zuhörte.
Heini war knapp ein Jahr älter als Ruth, ein Märchenkind, wie ihr schien. Seine Mutter, Leonies Stiefschwester, hatte einen ungarischen Journalisten namens Radek geheiratet, und Heini wohnte an einem Ort, der Rosenhügel hieß, hoch über der Donau in einer gelben, von Apfelbäumen beschatteten Villa. Etwas weiter hangabwärts stand das Grabmal eines türkischen Paschas; vom Balkon der Radeks konnte man den mächtigen Fluß sehen, der den ungarischen Ebenen entgegenströmte, die anmutigen Brücken, die ihn überspannten, die Türmchen und Giebel des Parlaments, einem Traumschloß ähnlich. In Budapest nämlich fließt die Donau anders als in Wien mitten durch das Herz der Stadt.
Aber das war nicht alles. Im Alter von drei Jahren kletterte Heini eines Tages auf den Klavierhocker seines Vaters.
«Es war wie eine Heimkehr», sollte er später den Journalisten erzählen. Mit sechs Jahren gab er in dem Saal, in dem Franz Liszt gespielt hatte, sein erstes Konzert. Zwei Jahre später durfte er Béla Bartok vorspielen, und der große Mann nickte beifällig.
Aber im Märchen gibt es immer auch traurige Ereignisse. Als Heini elf war, starb seine Mutter, und das goldene Wunderkind wurde beinahe zur Waise, da sein Vater, Herausgeber einer deutschsprachigen Zeitung, Tag und Nacht arbeitete. Deshalb beschloß dieser, Heini sein Studium in Wien fortsetzen und sich dort auf den Eintritt in das Konservatorium vorbereiten zu lassen. Der Junge sollte bei seinem Lehrer wohnen, einem hochangesehenen Klavierpädagogen, doch seine Freizeit sollte er bei den Bergers verbringen.
Niemals würde Ruth die erste Begegnung mit ihm vergessen. Sie war gerade von der Schule nach Hause gekommen und hängte ihren Ranzen auf, als sie die Musik hörte. Ein langsames Stück, und traurig, aber in aller Traurigkeit so richtig, so – getröstet.
Ihr Vater und ihre Tante waren noch in der Universität; ihre Mutter war in der Küche und konferierte mit der Köchin. Von der Musik angezogen, eilte Ruth durch die Flucht von Räumen – das Speisezimmer, den Salon, die Bibliothek – und öffnete die Tür des Musikzimmers.
Zuerst sah sie nur den riesigen Deckel des Bechsteinflügels, der wie ein schwarzes Segel ins Zimmer ragte. Dann lugte sie um ihn herum und erblickte den Jungen.
Er hatte ein schmales Gesicht, schwarze Locken, die ihm wirr in die Stirn fielen, bis hinunter zu den großen grauen Augen. Als er sie bemerkte, lächelte er, ohne die Hände von den Tasten zu nehmen, und sagte: «Guten Tag.»
Sie lächelte ebenfalls, gebannt von dem Entzücken, das ihr diese Musik bereitete, überwältigt von der Autorität, die er ausstrahlte, so jung er war.
«Das ist Mozart, nicht wahr?» sagte sie und seufzte, denn sie wußte schon, daß in Mozart alles war; wenn man sich an ihn hielt, konnte man nicht fehlgehen. Zwei Jahre zuvor hatte sie begonnen, sich in ihren Tagträumen seiner anzunehmen, und hatte ihn mit ihren Kochkünsten und ihrer Fürsorge weit über sein sechsunddreißigstes Jahr hinaus am Leben erhalten.
Читать дальше