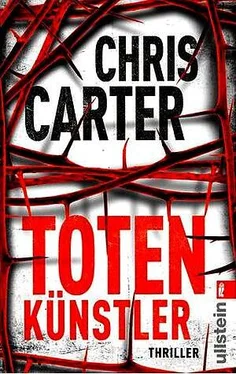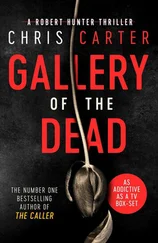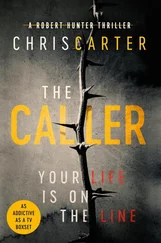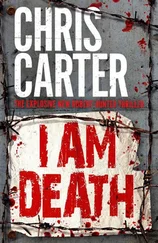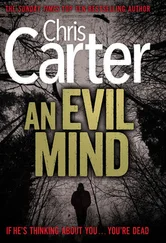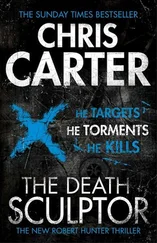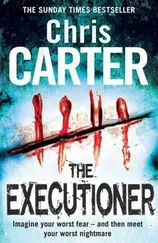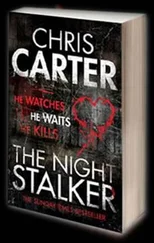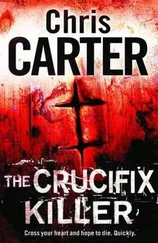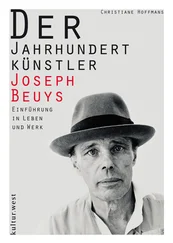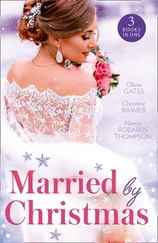»Wir müssen ihn finden.«
»Und wieso fragt ihr da mich? Ihr seid doch die Ermittler, oder nicht? Ermittelt halt.«
»Genau das tun wir doch, Einstein.« Garcia schlenderte in Richtung Küchenecke. Dort mischte sich der Geruch von Marihuana mit dem von geronnener Milch. In der uralten Spüle türmte sich schmutziges Geschirr. Die Arbeitsflächen waren mit Papptellern, Essensschachteln und leeren Bierdosen übersät. »Deine Deko-Ideen gefallen mir«, meinte Garcia und öffnete die Kühlschranktür. »Bier?«
»Du fragst mich, ob ich mein eigenes Bier trinken will?«
»Ich will nur höflich sein, aber du vermasselst es mir total.« Garcia knallte die Kühlschranktür wieder zu und trat auf das Pedal des Mülleimers. Als der Deckel sich hob, entwich eine überwältigende Cannabiswolke. »O Gott!« Garcia wich einen Schritt zurück und verzog das Gesicht. »Sind das etwa die Stummel von Joints? Da müssen ja mindestens hundert Stück drin sein.«
»Hey, Mann, was soll der Scheiß?«
»Tito.« Hunter setzte sich vor Tito hin – so war seine Haltung weniger bedrohlich. Er wollte, dass Tito sich ein bisschen entspannte. »Wir müssen Sands wirklich dringend finden, verstehst du?«
»Woher soll ich wissen, wo der steckt, verdammt? Wir waren ja nicht befreundet oder so.«
»Aber du warst mit anderen befreundet, die möglicherweise das eine oder andere wissen.« Hunter beobachtete, wie Titos Pupillen sich bewegten. Er versuchte sich zu erinnern. Sekunden später kamen sie zur Ruhe, und sein Blick wurde starr. Ihm war jemand eingefallen.
»Ich hab keine Ahnung, wen ich da fragen soll, Mann.«
»Doch, die hast du«, konterte Hunter.
Titos und Hunters Blicke kreuzten sich einen Moment lang.
»Hör zu, Kumpel.« Garcia umrundete den Tisch. »Alles, was wir wollen, sind ein paar Informationen. Wir müssen wissen, wo wir Sands finden können, es ist sehr wichtig. Im Gegenzug dafür bekommst du nicht innerhalb der nächsten Stunde Besuch von deinem Bewährungshelfer oder unseren Kollegen von der Drogenfahndung. Ich bin mir sicher, dass die deine Wohnung liebend gern durchsuchen würden, vor allem das Zimmer mit deinen zwei jungen Bekannten drin.«
»Das ist doch Arschwichse, Mann.«
»Tja, was anderes haben wir leider nicht im Angebot.«
»Kacke.« Noch ein nervöses Zucken, gefolgt von einem tiefen Seufzer. »Ich schau mal, was ich rausfinden kann. Aber ich brauch Zeit.«
»Die hast du. Bis morgen.«
»Das ist doch wohl ein Scherz!«
»Sehen wir so aus, als würden wir Scherze machen?«, fragte Garcia.
Tito zögerte.
Garcia suchte nach seinem Handy.
»Okay, Leute, ich seh mal, was sich machen lässt. Ich meld mich morgen bei euch. Könnt ihr euch jetzt verpissen?«
»Noch nicht ganz«, sagte Hunter. »Da ist noch jemand anders.«
»Ich glaub’s ja wohl nicht.«
»Ein anderer Mithäftling. Raul Escobedo. Schon mal von dem gehört?«
Auf der Fahrt zu Titos Wohnung hatte Hunter Garcia von seinem Treffen mit Seb Stokes und von Raul Escobedo berichtet.
»Wer?« Titos Augen verengten sich zu Schlitzen.
»Sein Name ist Raul Escobedo«, wiederholte Hunter. »Er hatte ebenfalls ein Zimmer in Lancaster. Sexualstraftäter.«
»Ein Vergewaltiger?« Tito sah ihn verdattert an.
»Genau.«
»Nee, Mann, bist du drauf oder was? Tun sie neuerdings Hasch in eure Donuts?«
»Ich esse keine Donuts.«
»Ich auch nicht«, sagte Garcia.
»Ich war in Block A, Alter, da sitzen die echt krassen Wichser und die Typen, die Einzelhaft gekriegt haben. Auf keinen Fall würden sie einen Vergewaltiger zu uns stecken, klar? Es sei denn, die Bullen wollen, dass er abkratzt. Der wäre innerhalb der ersten Stunde in den Arsch gefickt und tot.«
Tito sagte die Wahrheit. So ging es in den Gefängnissen Kaliforniens zu, und Hunter wusste das. Jeder Häftling, egal welches Verbrechen er begangen hatte, hasste Vergewaltiger. Sie galten als allerniedrigster Abschaum – als Feiglinge, die nicht den Mumm hatten, ein richtiges Verbrechen zu begehen, und die nur dann eine Frau abbekamen, wenn sie Gewalt anwendeten. Außerdem hatte jeder Gefangene eine Mutter, eine Schwester, Tochter, Ehefrau oder Freundin – jemanden, der selbst zum Opfer eines Vergewaltigers werden konnte. Normalerweise wurden Vergewaltiger in einem eigenen Flügel untergebracht, weit weg von den übrigen Häftlingen. Die Gefahr war zu groß, dass ihre Mitgefangenen es ihnen mit gleicher Münze heimzahlten und sie danach brutal ermordeten. Dergleichen war schon oft vorgekommen.
Alice Beaumont wurde immer frustrierter. Sie hatte den ganzen Tag damit zugebracht, sich Bilder im Internet anzusehen und darauf zu warten, dass das kalifornische Staatsgefängnis in Lancaster ihr die benötigten Unterlagen schickte. Trotz mehrerer Telefonate und erhöhter Dringlichkeitsstufe schien man dort keine Eile zu haben, ihrem Wunsch nachzukommen.
Mit ihren Bildrecherchen war sie kein Stück weitergekommen. Sie hatte stundenlang die Inhalte mythologischer und religionsgeschichtlicher Websites durchforstet, ohne dabei etwas Neues zutage zu fördern.
Alice war keine Frau, die Däumchen drehte und darauf wartete, dass andere Leute Dinge für sie erledigten. Sie wollte immer mittendrin sein, außerdem hatte sie allmählich vom Warten die Nase voll.
Also verließ sie das PAB und fuhr höchstpersönlich die knapp über zwei Stunden zum kalifornischen Staatsgefängnis in Lancaster. Zuvor hatte sie Bezirksstaatsanwalt Bradley telefonisch von ihrem Anliegen unterrichtet. Zwei Anrufe und knapp fünfzehn Minuten später war alles in die Wege geleitet. Gefängnisdirektor Clayton Laver ließ ausrichten, Alice könne gerne herkommen und sich die benötigten Unterlagen persönlich zusammensuchen. Sie würden es natürlich gerne für sie übernehmen, hatte der Direktor hinzugefügt, allerdings hätten sie nur wenig Personal und seien ohnehin schon überlastet, weshalb es noch ein oder zwei Tage dauern könnte, bevor sie dazu kämen. Unter Umständen auch länger.
Alice parkte auf dem zweiten der beiden großen Besucherparkplätze und machte sich auf den Weg zum Empfangsgebäude. Dort wurde sie von Gefängnisaufseher Julian Healy begrüßt, einem eins fünfundneunzig großen Afroamerikaner von der Breite eines Staudamms.
»Direktor Laver lässt sich entschuldigen«, sagte Healy mit einem nicht näher identifizierbaren Südstaatenakzent. Er zog die Vokale in die Länge, und seine Stimme hatte etwas Schleppendes, als wäre es ihm zu anstrengend, schneller zu sprechen. »Er ist im Moment leider verhindert und kann Sie nicht empfangen. Also wurde mir aufgetragen, Sie zu begleiten.« Er lächelte, während er Alices Erscheinungsbild musterte. Sie trug ein marineblaues Kostüm mit einer hellgrauen Seidenbluse. Der oberste Knopf der Bluse war geöffnet und gab den Blick auf ihren Halsansatz und eine feine Weißgoldkette mit Diamant-Anhänger frei.
»Besser, Sie knöpfen sich die Bluse zu. Und ich würde vorschlagen, die Jacke ebenfalls zu schließen.«
»Hier drin ist es so heiß wie in Afrika«, protestierte Alice, während sie ihm ihre Tasche zur Durchsuchung aushändigte.
»Das ist nichts im Vergleich zu der Hitze da drin, wenn die Häftlinge Sie in diesem dünnen Oberteil zu sehen kriegen.« Er warf einen Blick auf ihre Pumps. »Na, wenigstens tragen Sie keine offenen Schuhe.«
»Was ist so schlimm an offenen Schuhen?«
»Haben Sie eine Ahnung, wie viele Häftlinge auf Frauenfüße stehen? Vor allem auf Zehen. Und wenn dann noch die Nägel rot lackiert sind … Das macht sie wahnsinnig. Da könnten Sie genauso gut nackt sein. Damit die Triebe bei den Insassen nicht verrücktspielen, müssen alle Besucher Schuhe tragen, die vorne geschlossen sind.«
Alice wusste nicht, was sie dazu sagen sollte. Also sagte sie gar nichts.
Читать дальше