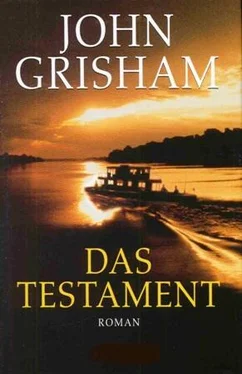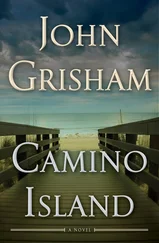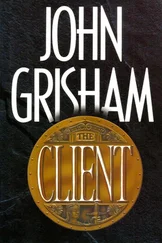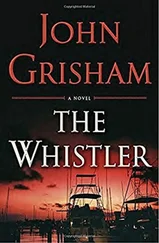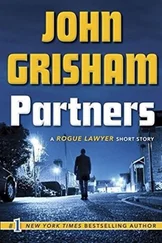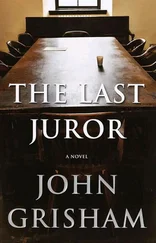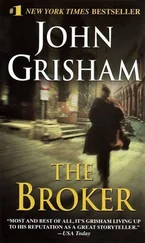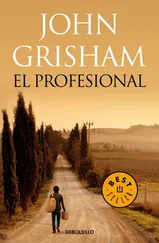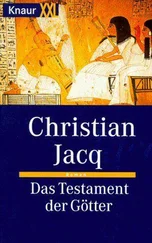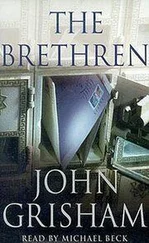»Darüber würde ich mir keine Gedanken machen. Die findet keiner.«
»Am liebsten wäre ich selbst da unten.«
Eine heranziehende Wolke unterbrach das Signal. »Was hast du gesagt?« fragte Nate mit lauter Stimme.
»Nichts. In zwei Tagen wirst du sie also sehen, ja?«
»Wenn wir Glück haben. Wir fahren Tag und Nacht, aber gegen die Strömung, und die ist jetzt in der Regenzeit ziemlich stark. Außerdem wissen wir nicht genau, wohin wir müssen. Wenn ich sage, zwei Tage, ist das ausgesprochen optimistisch. Außerdem gilt das nur unter der Voraussetzung, dass wir das mit der verdammten Schraube hinkriegen.«
»Ihr habt also schlechtes Wetter?« sagte Josh fast aufs Geratewohl. Viel gab es nicht zu besprechen. Nate lebte, es ging ihm gut, und er war auf dem richtigen Weg.
»Es ist heiß wie in der Hölle und regnet fünfmal am Tag. Davon abgesehen, ist es zauberhaft.«
»Schlangen?«
»Ein paar. Anakondas, länger als das Boot. Jede Menge Kaimane. Ratten, so groß wie Hunde. Sie leben am Flussufer zwischen den Kaimanen. Die Leute hier nennen sie capivaras, und wenn sie richtig Hunger kriegen, töten sie sie und essen sie.«
»Ihr habt aber genug zu essen?«
»Aber ja. Unsere Ladung besteht aus schwarzen Bohnen und Reis. Welly kocht mir die dreimal am Tag.«
Nates Stimme klang munter und abenteuerlustig.
»Wer ist Welly?«
»Mein Leichtmatrose. Im Augenblick ist er drei bis vier Meter unter Wasser, hält die Luft an und versucht, das Seil von der Schraubenwelle zu schneiden. Wie schon gesagt, ich führe die Aufsicht.«
»Geh mir ja nicht ins Wasser, Nate.«
»Was glaubst du wohl? Ich sitze auf dem Oberdeck. Hör zu, ich muss aufhören. Ich muss sparsam mit dem Strom umgehen. Wer weiß, wo ich die nächste Steckdose finde, um die Akkus aufzuladen.«
»Wann rufst du wieder an?«
»Ich versuche zu warten, bis ich Rachel Lane gefunden habe.«
»Guter Gedanke. Aber melde dich, falls du Schwierigkeiten hast.«
»Was für einen Sinn hätte das, dich anzurufen, Josh? Du könntest doch sowieso nichts daran ändern.«
»Du hast recht. Ruf nicht an.«
Das Unwetter brach in der Abenddämmerung über sie herein, während Welly in der Kombüse Reis kochte und Jevy zusah, wie es über dem Fluss dunkel wurde. Der plötzlich heranbrausende Wind weckte Nate, denn es rüt-telte so heftig an der Hängematte, dass er auf den Füssen landete. Donner und Blitz folgten sogleich. Nate ging zu Jevy hinüber und sah, dass im Norden eine riesige finstere Wand lag. »Ein schweres Gewitter«, sagte Jevy. Es klang unbeteiligt.
Müssten wir das Ding nicht irgendwo parken? dachte Nate. Zumindest seichteres Wasser aufsuchen? Jevy schien sich keine Sorgen zu machen; sein Gleichmut wirkte beruhigend auf Nate. Als es anfing zu regnen, ging er nach unten und aß schweigend mit Welly in einer Ecke der Kajüte Reis mit Bohnen. Die Glühlampe über ihnen schwang hin und her, während der Sturm das Boot packte und schüttelte. Schwere Regentropfen prasselten gegen die Bullaugen.
Oben auf der Brücke zog Jevy eine fettverschmierte gelbe Öljacke an und kämpfte gegen den Regen, der ihm ins Gesicht peitschte. Das winzige Ruderhaus war nicht verglast. Die beiden Scheinwerfer mühten sich nach Kräften, ihm den Weg durch die Dunkelheit zu zeigen, doch waren voraus lediglich etwa fünfzehn Meter aufgewühltes Wasser zu sehen. Jevy kannte den Fluss gut, und er hatte schon schlimmere Unwetter erlebt.
Es fiel Nate schwer zu lesen, während das Boot krängte und rollte. Schon nach wenigen Minuten war ihm übel.
In seiner Reisetasche fand er ein knielanges Regencape mit einer Kapuze. Josh hatte an alles gedacht. An das Geländer geklammert, arbeitete er sich langsam Stufe für Stufe emp or, bis dorthin, wo Welly, völlig durchnässt, zusammengekauert neben dem Ruderhaus hockte.
Der Fluss beschrieb eine Krümmung nach Osten, dem Zentrum des Pantanal entgegen. Als sie ihr folgten, erfasste der Sturm das Boot von der Seite, so dass Nate und Welly hart gegen die Reling geschleudert wurden. Jevy stemmte sich mit den Füssen gegen die Tür des Ruderhauses, hielt sich mit den muskulösen Armen am Steuerrad fest und hatte alles unter Kontrolle.
In Abständen von wenigen Sekunden kamen die Windstöße, einer nach dem anderen, erbarmungslos. Die Santa Loura machte keinerlei Fahrt mehr, sondern wurde vom Sturm in Richtung auf das Ufer geschoben. Die riesigen Tropfen des strömenden Regens fühlten sich kalt und hart an. Jevy fand in einem Kasten neben dem Steuerrad eine große Stablampe und gab sie Welly.
»Such das Ufer!« schrie er, bemüht, den heulenden Wind und das Geprassel des Regens zu übertönen.
Nate hangelte sich an der Reling entlang neben Welly, weil auch er gern sehen wollte, wohin die Fahrt ging.
Aber der Lichtstrahl zeigte nichts als Regen, der so dicht war, dass es aussah, als wirbelte Nebel über dem Wasser.
Dann kamen ihnen ein Blitz zu Hilfe. Mit einem Mal sahen sie das dichtbewachsene Ufer genau vor sich. Der Sturm schob sie unaufhaltsam darauf zu. Welly schrie etwas, und Jevy schrie etwas zurück. Im selben Augenblick prallte eine weitere Bö gegen das Boot und warf es heftig auf die Steuerbordseite. Der plötzliche Ruck riss Welly die Taschenlampe aus der Hand, und sie sahen nur noch, wie sie im Wasser verschwand.
Während sie durchnässt und zitternd am Bootsrand hockten und die Reling mit beiden Händen umklammerten, begriff Nate, dass nur zweierlei geschehen konnte, und auf keins von beiden hatten sie Einfluss. Entweder würde das Boot kentern, oder sie würden ans Ufer geschoben, in den Sumpf, wo die Reptilien hausten. Er hatte kaum Angst. Dann aber fielen ihm die Papiere ein.
Sie durften unter keinen Umständen verloren gehen. Mit einem Mal richtete er sich auf, gerade als das Boot erneut soweit krängte, dass er fast über die Reling ins Wasser gefallen wäre. »Ich muss runter!« schrie er Jevy zu, der das Steuerrad umklammert hielt. Auch der Bootsführer hatte Angst.
Mit dem Rücken zum Wind schob sich Nate Stufe für Stufe nach unten. Das Deck war schmierig und glatt von Dieseltreibstoff. Ein Fass war umgestürzt und leckte. Er versuchte es wieder hinzustellen, dazu aber waren wohl zwei Männer nötig. Gebückt trat er in die Kajüte, schleuderte sein Regencape in eine Ecke und holte die Aktentasche unter der Matratze hervor. Der Sturm schüttelte das Boot erneut, gerade als sich Nate nicht festhielt. Er stürzte hart zu Boden, und seine Füße strampelten hilflos in der Luft.
Zwei Dinge durfte er auf keinen Fall verlieren: die Papiere und das Satellitentelefon. Beide befanden sich in der Aktentasche, die zwar neu und schön, aber wohl auf keinen Fall wasserdicht war. Er drückte sie an die Brust und legte sich auf seine Koje, während das Unwetter die Santa Loura beutelte.
Das Motorgeräusch hörte auf. Er hoffte, dass Jevy die Maschine abgestellt hatte. Er konnte die Schritte der beiden unmittelbar über sich hören. Gleich knallen wir aufs Ufer, fuhr es ihm durch den Kopf, und da ist es besser, wenn die Schraube sich nicht dreht. Ein Motorschaden war es sicher nicht.
Das Licht ging aus. Nichts war mehr zu sehen.
Während Nate in der Finsternis dalag, sein Körper den Bewegungen des Bootes folgte und er darauf wartete, dass die Santa Loura ans Ufer geworfen wurde, kam ihm ein entsetzlicher Gedanke. Sofern sich diese Frau weigerte zu unterschreiben, dass sie vom Testament Kenntnis erlangt hatte, oder das Erbe nicht antreten wollte, war es unter Umständen nötig, die Reise noch einmal zu unternehmen. Monate, wenn nicht Jahre später würde jemand, vermutlich er selbst, erneut den Paraguay empor fahren müssen, um die reichste Missionarin der Welt davon in Kenntnis zu setzen, dass alle Formalitäten erledigt waren und das Geld endgültig ihr gehörte.
Читать дальше