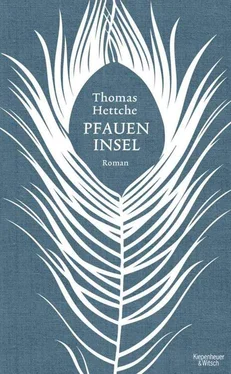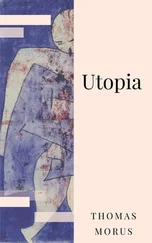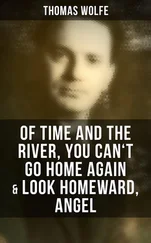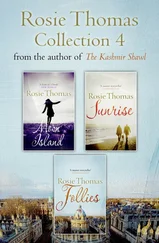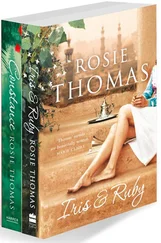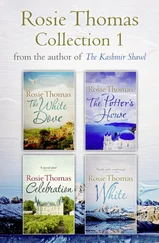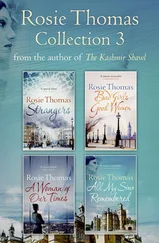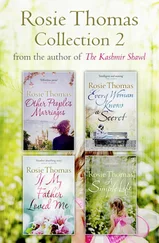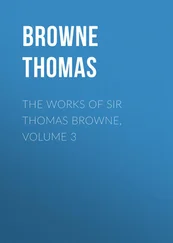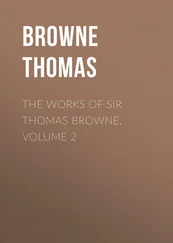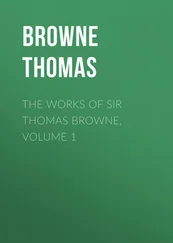Einen Moment noch starrte Fintelmann zu dem flackernden Licht hinüber, dann nahm er den Stapel mit der Korrespondenz und den Rechnungen vom Tisch und legte ihn, bevor er hinüberging, in der Kammer zu den anderen Akten des Jahres 1810.
Zweites Kapitel. Ein rotes Glas
Wir sagen: Die Zeit vergeht. Dabei sind wir es, die verschwinden. Und sie? Ist vielleicht nur so etwas wie eine Temperatur der Dinge, eine Färbung, die alles durchdringt, ein Schleier, der alles bedeckt, alles, von dem man sagt, daß es einmal war. Und in Wirklichkeit ist alles noch da, und auch wir sind alle noch da, nur nicht im Jetzt, sondern zugedeckt von ihr, der Zeit, im Setzkasten der Ewigkeit. Denn zwar stirbt alles, doch es bleibt etwas dort, wo etwas war. Zunächst sind es die Orte, die länger bleiben als wir. Was tut die Zeit mit ihnen?
Niemand, der die Flossenschläge des Inselfisches in der Havel gehört hätte. Dann aber Klingen und Abschläge aus Feuerstein, Überbleibsel mesolithischer Jäger, die hier rasten, zum ersten Mal der Geruch von Feuer. Jemand, der die Erde aufreißt, mit Händen und Hacke, eilig, schon zur Flucht gewendet, und bronzene Ringe und Armspiralen in einem groben Topf aus Ton vergräbt, kaum einen halben Meter tief im Boden. In der Bronzezeit dann erstmals ein Netz von Siedlungen im ganzen Berliner Raum, Scherben und weitere Bronzeringe, ein Ringopfer, wie überall in Norddeutschland von den Germanen praktiziert, dann wieder Stille. Tausend Jahre Stille. Dann die kärglichen Reste einer Siedlung der Heveller. Immer ist es das Feuer, das sich in die Erde gräbt und in ihr seine Zeichen hinterläßt, feindlich den Pflanzen, die es erst verdorrt und dann verzehrt.
Marie stand auf der Schloßwiese und drehte sich im Kreis, immer schneller und immer schneller, und trommelte mit ihren neuen Stiefelchen dabei immer heftiger auf den gefrorenen Boden, bis ihr die kalte Winterluft in der Nase stach. Ihr wurde schwindelig. Sie ließ die Arme herabsinken, wurde langsamer, blieb, außer Atem, stehen. Peitschenkreisel, Triesel, Tanzknopfmarie, dachte sie. Vor einigen Tagen hatte sie zum ersten Mal geblutet und war weinend zur Tante gelaufen. Doch alles war gut. Sie horchte auf die Rufe der Pfauen, die ganz so klangen wie kleine Kinder.

Der König schloß die Augen und lehnte die Stirn an die kalte Scheibe. In allem das Gegenteil seines Vaters, schmal und groß, die Augen klein und wäßrig, helle Wimpern, die man kaum sah, schienen die dünnen Haare an seinem langen Schädel zu kleben, der Mund zu karpfenhaftem Schweigen geschürzt. Er erinnerte sich noch genau daran, wie er nach dem Tod des Vaters im Winter 1797 hier, an diesem Fenster des gerade fertiggestellten Schlößchens, gestanden und auf den Park hinabgesehen hatte. Fast anderthalb Jahrzehnte war das jetzt her, er war noch keine dreißig gewesen, und für einen Moment hatte er damals tatsächlich geglaubt, die Geisterstimme Alexanders zu hören, seines Bruders, des toten Bastards, den sein Vater mit der Konkubine gehabt hatte, die er der Mutter vorzog.
Der Vater hatte die verwilderte Insel als junger Mann entdeckt und sich mit der zu Beginn erst dreizehnjährigen Wilhelmine Encke, Tochter eines Hornisten im Königlichen Orchester, oft hierher übersetzen lassen. Kaum war er König, ließ er die Pfaueninsel dem Waisenhaus abkaufen, dem sie gehörte, und veranstaltete romantische Feste auf ihr. Mit Gondeln ruderte man herüber, orientalische Zelte, kostbare Geschenke des Sultans, wurden ausgespannt, es gab Musik und Tanz, und erst mit der untergehenden Sonne kehrte man ins Marmorpalais nach Potsdam zurück. Wilhelmine war fünfzehn, als sie das erste Mal Mutter wurde. Es heißt, sie sei hier sehr glücklich gewesen. Eine Scheinheirat machte sie erst zu Madame Ritz und der König sie schließlich zur Gräfin Lichtenau. Kaum war das Schloß fertig, das er ihr hier bauen ließ, starb er.
Die Frau von der Insel zu jagen, die in den Stunden seines Todes beim Vater gewesen war und mit einem Tuch die Ströme des Blutes aufgefangen hatte, das er kotzte bis zuletzt, war beinahe das erste, was Friedrich Wilhelm III. tat, als er seinerseits König geworden war. Er ließ ihr den Prozeß machen und ihr Vermögen konfiszieren, und es sollte zehn Jahre dauern, bis Napoleon die schöne Wilhelmine, wie die Berliner sie nannten, rehabilitierte. Sie heiratete dann noch einmal, den viel jüngeren Theaterdichter Franz Ignaz Holbein von Holbeinsberg, doch die Ehe hielt nicht lange, die Gräfin blieb allein, starb 1820 und wurde in einer Gruft in der Hedwigskirche beigesetzt, ganz in der Nähe ihres Wohnhauses. 1943 räumte man die Gruft leer, um sie als Luftschutzkeller zu nutzen, und bettete ihre Überreste in einem schlichten Sarg auf den Hedwigskirchhof um. 1961 wurde sie dort wiederum exhumiert, weil ihr Grab nun im Todesstreifen der Mauer lag. Damit verliert sich die Spur ihres Körpers.
Der aber, der sie von der Insel vertrieben hatte, kehrte nur selten dorthin zurück. Meist, wie auch heute, am Todestag seiner Frau. Als er hörte, wie man die Flügeltüren des Saals öffnete und jemanden hereinließ, straffte er sich und blinzelte auf die neblige Havel hinunter. Der Hofgärtner Fintelmann hatte ihn bei seiner Ankunft darauf hingewiesen, eine Zwergin, die er selbst vor Jahren als königlichen Pflegling hierhergesetzt habe, bekleide nun formal das Amt eines Schloßfräuleins, und er hatte sich tatsächlich an das Kind erinnert, das ihm seinerzeit vorgeführt worden war, der Vater wohl im Felde gefallen, und befohlen, es solle ihm Gesellschaft leisten. Schritte trippelten über das Parkett heran, er drehte sich um, und Marie fiel in einen tadellosen Hofknicks. Der König nickte ihr zu, setzte sich in einen Sessel, den man ihm an eines der großen Fenster gerückt hatte, und starrte, ohne noch ein Wort an sie zu richten, hinaus in den Nebel.
Ein Ritual, das sich von nun an jedes Jahr wiederholen sollte. Außer, daß er ihr in seiner abgehackten Diktion, über die man sich allenthalben lustig machte, weil sie keine vollständigen Sätze kannte, kaum Verben und beinahe niemals ein Ich , hin und wieder eine Frage über die Insel stellte, wußte er nichts mit ihr anzufangen bei dem erstarrten Brüten, in das er in diesem Schloß unweigerlich verfiel. Nur, daß er sie gern im Blick hatte.
Er war schnell mit sich selbst dahingehend übereingekommen, bei seinen Besuchen hier auf der Insel handle es sich um seine Art der Trauer um Luise, die er so sehr geliebt hatte. Aber tatsächlich war es eher ein Warten. So, wie die Zwergin vor ihm neben dem Fenster stand und wartete, daß er etwas von ihr wolle, so wartete er selbst, und deshalb wohl auch mochte er, auf seine Weise, die kleine Person, von der er nichts wußte und auch nichts wissen wollte. Selbst den Gedanken, daß sie kleinwüchsig war, machte er sich nicht. Nur gelegentlich, wenn er sich an etwas erinnerte, was er nicht vergessen konnte, erzählte er Marie von seiner Königin.
»Zuletzt«, begann er etwa einmal, das war im zweiten Sommer nach ihrem Tod, »hatte meine Frau einen höchst seltsamen Traum. Glaubte mit mir auf einer angenehmen Wiese zu spazieren. Dann sich am Ufer eines Flusses zu befinden. Dann Friedrich II. in einem kleinen Boot zu bemerken. Auf sie zugesteuert gekommen und sie freundlich gewinkt. Aber totenbleich gewesen. Als sie darauf in den Nachen gestiegen, dieser so schnell vom Ufer abgestoßen, daß ich nicht mehr hinein hätte können. Habe mich immerzu gewunken, ihr nach zu kommen. Sei aber nicht möglich gewesen. Habe mir ihr Lebewohl gewinkt. Ihr sei immer leichter und wohler geworden, und endlich sei sie mit dem Nachen untergegangen.«
Marie sagte nichts.
»Meine Frau nichts weniger als abergläubisch. Und ließ doch zum Scherz sich Träume deuten. Des andern Morgens also zur Gräfin Tauentzien, weil diese die Reputation hatte, allerlei Mystisches auszulegen. Da nun aber dieser Traum nichts Gutes und jener dies wohl anzumerken war, fiel meine Frau gleich ihr in die Rede. Still, still, wenn es was Übles ist.«
Читать дальше