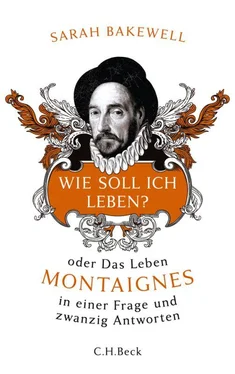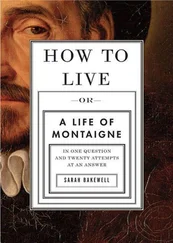Montaigne war nicht nur die formale Etikette, sondern auch langweiliger Smalltalk verhasst. Auch selbstbewusste Alleinunterhalter ödeten ihn an. Einige seiner Freunde konnten ihre Zuhörer stundenlang mit ihren Anekdoten in Bann ziehen, Montaigne bevorzugte das zwanglose Geben und Nehmen. Wenn bei offiziellen gesellschaftlichen Anlässen die Unterhaltung nur so dahinplätscherte, schweifte seine Aufmerksamkeit oft ab, und er hing seinen eigenen Gedanken nach. Wurde er dann angesprochen, gab er «wirres und lächerliches Zeug» von sich, «dessen sich sogar ein Kind schämen müsste». Er bedauerte dies, denn auch eine oberflächliche Konversation konnte zum Ausgangspunkt für einen intensiveren Gedankenaustausch und angenehmere Abende werden, wo man entspannt scherzen und lachen konnte.
Für Montaigne waren «Gelöstheit und geselliges Wesen» nützliche Eigenschaften im Umgang mit anderen. Sie waren aber auch eine wichtige Voraussetzung, um gut zu leben. Er versuchte eine, wie er es nannte, «fröhliche und gesellige Weisheit» zu kultivieren — eine Formulierung, die an Nietzsche erinnert, der die Philosophie als «fröhliche Wissenschaft» bezeichnete. Wie die Libertins war Nietzsche mit Montaigne vom Nutzen des geselligen Miteinanders überzeugt, auch wenn ihm, Nietzsche, dieses Miteinander überaus schwer fiel. Doch in einer anrührenden Passage in seinem frühen Werk Menschliches, Allzumenschliches schrieb er:
Unter die kleinen, aber zahllos häufigen und deshalb sehr wirkungsvollen Dinge, auf welche die Wissenschaft mehr achtzugeben hat als auf die großen seltenen Dinge, ist auch das Wohlwollen zu rechnen; ich meine jene Äußerungen freundlicher Gesinnung im Verkehr, jenes Lächeln des Auges, jene Händedrücke, jenes Behagen, von welchem für gewöhnlich fast alles menschliche Tun umsponnen ist. Jeder Lehrer, jeder Beamte bringt diese Zutat zu dem, was für ihn Pflicht ist, hinzu; es ist die fortwährende Betätigung der Menschlichkeit, gleichsam die Wellen ihres Lichts, in denen alles wächst […]. Die Gutmütigkeit, die Freundlichkeit, die Höflichkeit des Herzens […] haben viel mächtiger an der Kultur gebaut, als jene viel berühmteren Äußerungen desselben, die man Mitleiden, Barmherzigkeit und Aufopferung nennt.
Montaigne fiel es in der Regel nicht schwer, Freundlichkeit und Wohlwollen zu zeigen. Zum Glück, denn in seinem häuslichen, aber auch in seinem beruflichen Leben waren diese Eigenschaften unabdingbar: im Umgang mit den Kollegen in Bordeaux und später mit Diplomaten, Königen und mächtigen Kriegsherren; oft musste er mit Gegnern verhandeln, die von religiösem Fanatismus verblendet waren. Auch mit seinen Nachbarn musste er sich gutstellen, gleichfalls nicht immer eine leichte Aufgabe. Gelegentlich tauchen sie in den Essais auf, oft im Zusammenhang mit einprägsamen Geschichten: der knauserige Marquis de Trans aus der Familie de Foix, die in der Region großen Einfluss besaß; Jean de Lusignan, dessen heiratsfähige Kinder die Haushaltskasse mit ihren vielen Einladungen belasteten; François de La Rochefoucauld, der es als widerlich empfand, sich in ein Taschentuch zu schneuzen, und lieber die Hand benutzte. Hinzu kommen adlige Damen aus der Umgebung, denen er das eine oder andere Kapitel der Essais widmete: Diane de Foix, Comtesse de Gurson, Marguerite de Gramond und Mme d’Estissac, deren Sohn Montaigne später nach Italien begleitete. Vor allem aber schloss Montaigne Freundschaft mit der Mätresse Heinrichs von Navarra, des späteren Königs Heinrich IV.: Diane d’Andouins, Comtesse de Guiche et de Gramont, bekannt unter dem Namen Corisande, nach der Protagonistin einer der von ihr geschätzten Ritterromane.
Um mit all diesen Leuten den Kontakt zu pflegen, musste Montaigne an vielen gesellschaftlichen Anlässen teilnehmen, auch wenn er sie insgeheim verabscheute. Hatte er Gäste, veranstaltete er in seinem Wald eine Hirschjagd, obwohl er die Jagd hasste. Erfolgreicher mied er Turnierwettkämpfe, die er für gefährlich und sinnlos hielt. Auch Gesellschaftsspielen — Karten- und Ratespielen — suchte er sich möglichst zu entziehen, vielleicht weil er nach eigenem Bekunden nicht gut darin war.
Oft kamen umherziehende Akrobaten, Tänzer, Hundedresseure und menschliche «Monstren» auf sein Schloss, die sich mit ihren Vorführungen ihren Lebensunterhalt verdienten. Montaigne ließ sie gewähren, blieb aber unbeeindruckt von Darbietungen wie dem Auftritt jenes Mannes, der Hirsekörner durch ein Nadelöhr werfen konnte. Mehr interessierten ihn die brasilianischen Tupinambá-Eingeborenen, denen er in Rouen begegnete. Und er legte beträchtliche Entfernungen zurück, um Berichten über menschliche Abnormitäten auf den Grund zu gehen: beispielsweise über ein Kind, das mit einem anderen zusammengewachsen war, dem der Kopf fehlte. Er besuchte einen hermaphroditischen Hirten im Médoc und begegnete einem Mann ohne Arme, der mit seinen Füßen eine Pistole laden und abfeuern, eine Nadel einfädeln, nähen, schreiben, sich die Haare kämmen und Karten spielen konnte. Auch er verdiente sich mit seinen Darbietungen seinen Lebensunterhalt, aber Montaigne fand ihn interessanter als den Mann mit den Hirsekörnern. Die Leute sprechen von Monstren, schrieb er, aber diese Menschen seien «wider die Gewohnheit», nicht «wider die Natur». Wirklich abwegig war für ihn etwas anderes:
Dafür habe ich auf der ganzen Welt bisher kein ausgeprägteres Monster und Mirakel gesehn als mich selbst. Zeit und Gewöhnung machen einen mit allem Befremdlichen vertraut; je mehr ich aber mit mir Umgang pflege und mich kennenlerne, desto mehr frappiert mich meine Ungestalt, desto weniger werde ich aus mir klug.
Montaignes Landgut war also ein Tummelplatz für Menschen unterschiedlichster Art und Herkunft. Es herrschte eine Atmosphäre wie auf einem Dorf, weniger wie in einem Privathaus. Auch wenn er sich zum Schreiben in seinen Turm zurückzog, war es selten still um ihn herum. Überall wurde geredet und gearbeitet. Vor seinem Fenster wurden Pferde aus dem Stall heraus- oder hineingeführt, Hühner gackerten, Hunde bellten. Zur Zeit der Weinlese war die Luft erfüllt vom Klappern der Weinkeltern. Selbst mitten in den Kriegswirren pflegte Montaigne ein offeneres Haus als andere — ungewöhnlich in so gefährlichen Zeiten.
In mancher Hinsicht war Montaignes kleine Welt ein Universum mit einer ganz eigenen Werteordnung und einer freizügigen Atmosphäre. Sein Haus war keine Festung, wer ans Tor klopfte, war willkommen, auch wenn Montaigne sich der Gefahren bewusst war und zugab, dass er manchmal mit dem Gedanken zu Bett ging, er könne von einem umherstreifenden Soldaten oder einem Landstreicher im Schlaf ermordet werden. Aber ihm ging es ums Prinzip. Wenn Montaigne schrieb, es sei sein wesentlicher Charakterzug, «mich mitzuteilen und zu offenbaren», meinte er nicht nur geselliges Geplauder, sondern die freie, aufrichtige Kommunikation — selbst mit denen, die entschlossen schienen, ihn zu töten.
Offenheit, Gnade und Grausamkeit
Giovanni Botero, ein politischer Schriftsteller Italiens, der in den 1580er Jahren in Frankreich lebte, schrieb, die ländlichen Gebiete Frankreichs seien in jenem Jahrzehnt so voller Diebe und Mörder gewesen, dass jedes Haus «Wachposten in den Wein- und Obstgärten» hätte haben müssen, außerdem «Tore, Schlösser, Riegel und Mastiffs». Botero hatte offenkundig nicht Montaignes Anwesen besucht, denn dieses hatte als einzige Bewachung «nach altem Brauch einen Pförtner», wie Montaigne schrieb, «dessen Aufgabe es weniger ist, das Tor zu verteidigen, als es zuvorkommend und freundlich zu öffnen».
Montaigne wollte sich nicht einschüchtern und einsperren lassen, war aber zugleich überzeugt, dass diese Offenheit seiner Sicherheit diente. Schwer bewachte Häuser in dieser Gegend wurden häufiger überfallen als seines. Zur Erklärung zitierte er Seneca: «Verriegelte Türen locken den Einbrecher an, offne lässt er links liegen.» Schlösser erwecken den Eindruck, dass etwas Wertvolles zu holen sei, und ein Haus auszurauben, in dem man von einem älteren Pförtner willkommen geheißen wird, ist nicht gerade eine Ruhmestat. Auch waren in einem Bürgerkrieg die sonst üblichen Vorsichtsmaßnahmen sinnlos, denn da «kann der eigene Diener es mit der Partei halten, die man fürchtet». Gegen eine Bedrohung von innen konnte man sich nicht schützen, da war es besser, den Feind dadurch für sich zu gewinnen, dass man sich offen und aufrichtig zeigte.
Читать дальше