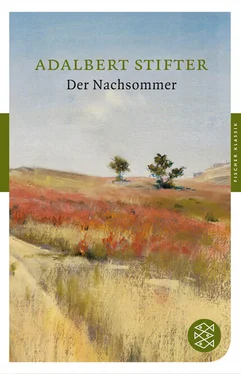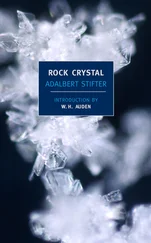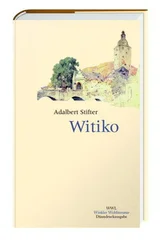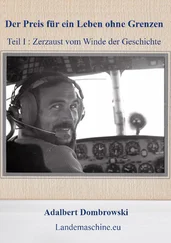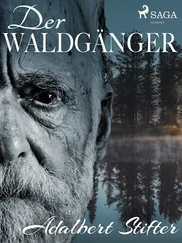Bei diesen Worten kam Gustav in den Saal. Die Dämmerung hatte schon stark zugenommen, es regnete aber noch immer nicht.
»Dieser steht noch auf demselben Stande, auf welchem ihr früher gestanden seid«, sagte mein Gastfreund auf Gustav weisend, der auf ihn zuging.
»Wie meinst du das, Vater?« fragte der Knabe.
»Wir redeten von Kunst«, antwortete mein Gastfreund, »und da behaupte ich, daß du noch nicht in der Lage bist, Kunstwerke so erkennen und beurteilen zu können wie unser Gast hier.«
»Wohl, das behaupte ich selber«, sagte Gustav, »er ist darum auch teilweise mein Lehrer, und wenn er in der Erkenntnis der Kunst dir und Eustach und der Mutter nachstrebt, so werde ich meines Teils ihm wieder nachstreben.«
»Das ist gut«, sagte mein Gastfreund, »aber das ist es nicht so ganz, wovon wir sprachen, allein es tut nichts zur Sache und gehört auch nicht zur Wesenheit.«
Mit diesen Worten, gleichsam um ferneren Fragen vorzubeugen, trat er an ein Fenster und wir mit ihm.
Wir betrachteten eine Weile die Erscheinung vor uns, die über dem immer dunkler werdenden Gefilde immer großartiger wurde, und gingen dann, da der Abend beinahe in Finsternis übergehen wollte und die Stunde des Abendessens gekommen war, über die Marmortreppe in das Speisezimmer hinunter.
Das Gewitter war in der Nacht ausgebrochen, hatte einen Teil derselben mit Donnern und einen Teil mit bloßem Regen erfüllt und machte dann einem sehr schönen und heiteren Morgen Platz.
Das Erste, was ich an diesem Tage tat, war, daß ich zu dem marmornen Standbilde ging. Ich hatte es gestern, da wir über die Treppe hinabstiegen, nicht mehr deutlich und nur von einem Blitze oberflächlich beleuchtet gesehen. Die Finsternis war auf der Treppe schon zu groß gewesen. Heute stand es in der ruhigen und klaren Helle des Tages, welche das Glasdach auf die Treppe sendete, schmucklos und einfach da. Ich hatte nicht gedacht, daß das Bild so groß sei. Ich stellte mich ihm gegenüber und betrachtete es lange. Mein Gastfreund hatte Recht, ich konnte keine eigentliche einzelne Schönheit entdecken, was wir im neuen Sinne Schönheit heißen, und ich erinnerte mich auf der Treppe sogar, daß ich oft von einem Buche oder von einem Schauspiele, ja von einem Bilde sagen gehört hatte, es sei voller Schönheiten, und dem Standbilde gegenüber fiel mir ein, wie unrecht entweder ein solcher Spruch sei oder, wenn er berechtigt ist, wie arm ein Werk sei, das nur Schönheiten hat, selbst dann, wenn es voll von ihnen ist und das nicht selber eine Schönheit ist; denn ein großes Werk, das sah ich jetzt ein, hat keine Schönheiten und um so weniger, je einheitlicher und einziger es ist. Ich geriet sogar auf den Gedanken und auf die Erfahrung, die ich mir nie klar gemacht hatte, daß, wenn man sagt, dieser Mann, diese Frau habe eine schöne Stimme, schöne Augen, einen schönen Mund, eben damit zuleich gesagt ist, das andere sei nicht so schön; denn sonst würde man nicht Einzelnes herausheben. Was bei einem lebenden Menschen gilt, dachte ich, gilt bei einem Kunstwerke nicht, bei welchem alle Teile gleich schön sein müssen, so daß keiner auffällt, sonst ist es eben als Kunstwerk nicht rein und ist im strengsten Sinne genommen keines. Dessenohngeachtet, daß ich, oder vielmehr eben darum, weil ich keine einzelnen Schönheiten an dem Standbilde zu entdecken vermochte, machte es, wie ich mir jetzt ganz klar bewußt war, wieder einen außerordentlichen Eindruck auf mich. Der Eindruck war aber nicht einer, wie ich ihn öfter vor schönen Sachen hatte, ja selbst vor Dichtungen, sondern er war, wenn ich den Ausdruck gebrauchen darf, allgemeiner, geheimer, unenträtselbarer, er wirkte eindringlicher und gewaltiger; aber seine Ursache lag auch in höheren Fernen, und mir wurde begreiflich, ein welch hohes Ding die Schönheit sei, wie schwerer sie zu erfassen und zu bringen sei als einzelne Dinge, die die Menschen erfreuen und wie sie in dem großen Gemüte liege und von da auf die Mitmenschen hinausgehe, um Großes zu stiften und zu erzeugen. Ich empfand, daß ich in diesen Tagen in mir um Vieles weiter gerückt werde.
In der nächsten Zeit sprach ich auch mit Eustach über das Standbild. Er war sehr erfreut darüber, daß ich es als so schön erkannte, und sagte, daß er sich schon lange darnach gesehnt habe, mit mir über dieses Werk zu sprechen; allein es sei unmöglich gewesen, da ich selber nie davon geredet habe und eine Zwiesprache nur dann ersprießlich werde, wenn man beiderseitig von einem Gegenstande durchdrungen sei. Wir betrachteten nun miteinander das Bildwerk und machten uns wechselseitig auf Dinge aufmerksam, die wir an demselben zu erkennen glaubten. Besonders war es Eustach, der über das Marmorbild, so sehr es sich in seiner Einfachheit und seiner täglich sich vor mir immer staunenswerter entwickelnden Natürlichkeit jeder Einzelverhandlung zu entziehen schien, doch über sein Entstehen, über die Art seiner Verhältnisse, über seine Gesetzmäßigkeit und über das Geheimnis seiner Wirkung sachkundig zu sprechen wußte. Ich hörte begierig zu und empfand, daß es wahr sei, was er sprach, obgleich ich ihn nicht immer so genau verstand wie meinen Gastfreund, da er nicht so klar und einfach zu sprechen wußte wie dieser. Ich schritt in der Erkenntnis des Bildes vor, und es war mir, als ob es nach seinen Worten immer näher an mich heran gerückt würde.
Er suchte viele Zeichnungen hervor, auf denen sich Abbildungen von Standbildern oder andern geschnitzten oder auf anderem Wege hervorgebrachten Gestalten des Mittelalters befanden. Wir verglichen diese Gestalten mit der aus dem Griechentume stammenden. Auch wirkliche Gestaltungen von kleinen Engeln, Heiligen oder anderen Personen, die sich in dem Rosenhause oder in der Nähe befanden, suchte er zur Vergleichung herbei zu bringen. Es zeigte sich hier für meine Augen, daß das wahr sei, was mein Gastfreund über griechische und mittelalterliche Kunst gesagt hatte. Es war mir wie ein jugendlicher und doch männlich gereifter Sinn voll Maß und Besonnenheit sowie voll herrlicher Sinnfälligkeit, der aus dem Griechenwerke sprach. In den mittelalterlichen Gebilden war es mir ein liebes, einfaches, argloses Gemüt, das gläubig und innig nach Mitteln griff, sich auszusprechen, der Mittel nicht völlig Herr wurde, dies nicht wußte und doch Wirkungen hervorbrachte, die noch jetzt ihre Macht auf uns äußern und uns mit Staunen erfüllen. Eis ist die Seele, die da spricht und in ihrer Reinheit und in ihrem Ernste uns mit Bewunderung erfüllt, während spätere Zeiten, von denen Eustach zahlreiche Abbildungen von Bildwerken vorlegte, trotz ihrer Einsicht, ihrer Aufgeklärtheit und ihrer Kenntnis der Kunstmittel nur frostige Gestalten in unwahren Flattergewändern und übertriebenen Gebärden hervorbrachten, die keine Glut und keine Innigkeit haben, weil sie der Künstler nicht hatte, und die nicht einmal irgend eine Seele zeigen, weil der Künstler nicht mit der Seele arbeitete, sondern mit irgend einer Überlegung nach eben herrschenden Gestaltungsansichten, weshalb er das, was ihm an Gefühl abging, durch Unruhe und Heftigkeit des Werkes zu ersetzen suchte. Was die Sinnfälligkeit anlangt, so schien mir das Mittelalter nicht nach Vollendung in derselben gestrebt zu haben. Neben einem Haupte, das in seiner Einfachheit und Gegenständlichkeit trefflich und tadellos war, befinden sich wieder Bildungen und Gliederungen, die beinahe unmöglich sind. Der Künstler sah dies nicht; denn er fand den Zustand seines Gemütes in dem Ausdrucke seines Werkes, mehr hatte er nicht beabsichtigt, und nach Verschmelzung des Sinnentumes strebte er nicht, weil es ihm, wenigstens in seiner Kunsttätigkeit ferne lag und er einen Mangel nicht empfand. Darum stellt sich auch bei uns die Wirkung der Innerlichkeit ein, obgleich wir, unähnlich dem schaffenden Künstler des Mittelalters, die sinnlichen Mängel des Werkes empfinden. Dies spricht um so mehr für die Trefflichkeit der damaligen Arbeiten. Es waren recht schöne Tage, die ich mit Eustach in diesen Vergleichungen und diesen Bestrebungen hinbrachte.
Читать дальше