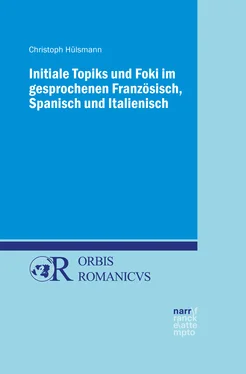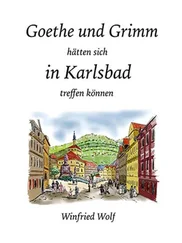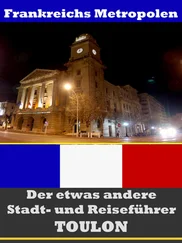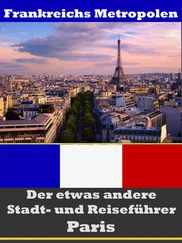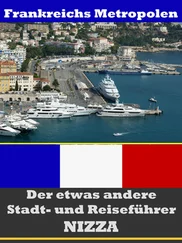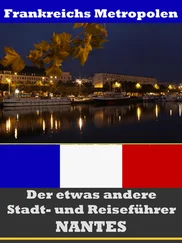Féry und Krifka (2008) zufolge sind es universale Prinzipien, nach denen Informationsstruktur kodiert wird. Die Tendenz, dass eine Prominenz bei fokalisierten, nicht aber bei gegebenen Elementen zu beobachten ist, kann durch den effort code erklärt werden. Höherer oder niedriger prosodischer Aufwand reflektiert demnach die Relevanz von Konstituenten (bzw. deren Referenten) für die Kommunikation.2 (cf. Féry/Krifka 2008, 12) Dem entspricht auch Givóns code quantity principle : „The less predictable/accessible a referent is, the more phonological material will be used to code it.“ (Givón 1988, 249) Dass sich auch Topiks prosodisch vom restlichen Teil der Äußerung abheben (und an erster Position stehen), kann auf die Optimierung des Informationsflusses zurückgeführt werden. (cf. Féry/Krifka 2008, 12) Neben der Markierung des Satzmodus bzw. der Sprechakte sowie der Einstellungen der Sprecher erfüllt die Prosodie aus informationsstruktureller Sicht damit zwei zentrale Funktionen. Zum einen liefert sie dem Hörer Indizien, die ihm die Segmentierung der sprachlichen Einheiten erleichtern, zum anderen kann sie einzelne, besonders wichtige Elemente einer Äußerung durch eine Akzentuierung salient machen. (cf. Lacheret 2013, 230–231)
Nicht zu vernachlässigen sind jedoch Unterschiede zwischen den Sprachen bei der Markierung der Informationsstruktur. (cf. Féry/Krifka 2008, 12) So kann in einigen Sprachen, wie beispielsweise im Englischen, jedes Element unabhängig von seiner Position prosodisch fokalisiert werden. In Satz (9) wird etwa das initiale Subjekt als Fokus markiert. Andere Sprachen, wie das Spanische, greifen bevorzugt auf eine syntaktische Umstellung zurück und realisieren den Fokus in finaler Position (10). (cf. Casielles-Suárez 1999, 357–359)
| (9) |
en. |
(Who followed Ralph into the bedroom?) – LAURIE followed Ralph into the bedroom. (Casielles-Suárez 1999, 357) |
| (10) |
sp. |
(¿Quién llamó a los niños?) – A los niños los llamó JUAN. (Casielles-Suárez 1999, 359) |
Um zu einem besseren Verständnis des Zusammenspiels von Informationsstruktur und Prosodie zu gelangen, ist es zunächst erforderlich einige grundlegende Termini der suprasegmentalen Ebene zu klären.
Die drei wichtigsten Dimensionen der Prosodie umfassen die Zeit, die Frequenz und die Intensität.3 (cf. Rossi 1999, 7) Die akustischen Merkmale bestimmen jeweils die auditiven Merkmale, auch wenn – wie folgendes Schema von Rabanus illustriert – immer auch gegenseitige Wechselwirkungen angenommen werden müssen.4 (cf. Moroni 2010, 64–65)
Abb. 11: Artikulatorischer Zusammenhang (Rabanus 2001, 6)
Der Ton ist eine phonologische Kategorie, die sich auf Variationen der Grundfrequenz (F 0) bezieht.5 In Tonsprachen dient er dazu, lexikalische und grammatikalische Bedeutungen zu unterscheiden. (cf. Hartmann 2007, 222) Zur Markierung der Informationsstruktur setzen diese Sprachen vor allem syntaktische und morphologische Strategien ein. (cf. Hartmann 2007, 233) Intonationssprachen hingegen, zu denen auch die in dieser Arbeit untersuchten romanischen Sprachen zählen, verwenden den Ton als einen der „suprasegmental phonetic features to convey ‚postlexical‘ or sentence-level pragmatic meanings in a linguistically structured way“.6 (Ladd 1996, 6)
In der nicht-linearen Phonologie, die heute als gängigster Ansatz innerhalb der Intonationsforschung gelten kann7, werden in der Regel zwei Arten von Tönen unterschieden. Level tones zeichnen sich durch eine konstante Höhe aus. Innerhalb der level tones werden wiederum zwei Töne differenziert, ein Hoch- (H für high ) und ein Tiefton (L für low ).8 Contour tones sind Kombinationen aus level tones . Steigende Töne kombinieren L und H, fallende Töne H und L. (cf. Hartmann 2007, 222) Der Tonhöhenverlauf wird als Intonation bezeichnet.9 (cf. Peters 2014, 1) Intonationskonturen sind all jene Tonhöhenverläufe, „die in einer gegebenen Sprache die gleichen sprachlichen Funktionen erfüllen“.10 (Peters 2014, 2) Aus rein prosodischer Sicht kann ein Satz dementsprechend durch das Vorhandensein einer (einzelnen) terminalen Intonationskontur definiert werden.11 (cf. Wunderli 1990, 41)
Der Ton wird zur suprasegmentalen Ebene der Sprache gerechnet, die grundsätzlich als von der segmentalen Ebene unabhängig gesehen wird, aber insofern mit ihr in Verbindung steht, als der Ton mit einem Silbenkern, d.h. mit Vokalen oder silbischen Konsonanten, assoziiert.12 (cf. Hartmann 2007, 223) Voraussetzung für die Verbindung der prosodischen mit der segmentalen Ebene ist die Eruierung von metrisch starken Silben in der jeweils zu analysierenden Sprache. Im Spanischen und Italienischen etwa sind die metrisch starken Silben durch das Lexikon (Wortakzent) vorgegeben. (cf. Gabriel 2007, 179)
Töne, die einen Akzent markieren, werden Akzenttöne (oder Pitch-Akzente ) genannt und in autosegmentalen Zugängen mithilfe eines Sterns (*) markiert. (cf. Peters 2014, 29) Akzenttöne assoziieren mit den metrisch starken Silben nun entweder in monotonaler (L*, H*) oder in bitonaler (L*H, LH*, H*L, HL*) Form.13 (cf. Gabriel 2007, 179) Im Gegensatz zu Akzent ist stress ein abstrakter Begriff, der sich auf eine relative Prominenz bezieht und der starken Silbe eines prosodischen Fußes zugeordnet wird.14 Auf phonetischer Ebene manifestiert sich stress oft durch größere Dauer, Lautstärke oder Tonbewegungen.15 (cf. Hartmann 2007, 224)
Unbedingt von der Assoziierung zu unterscheiden ist die Alignierung von Tönen. In den Beispielsätzen (11)–(12) etwa assoziieren die Akzenttöne jeweils mit der metrisch starken Silbe von María . Dass sie eine unterschiedliche Alignierung aufweisen, zeigt Abbildung 12. (cf. Gabriel 2007, 179)
| (11) |
(Was ist los?) – sp. MaRÍa le da el diario a su herMAno. |
| (12) |
(Julia gibt ihrem Bruder die Zeitung, nicht wahr?) – sp. MaRÍa le da el diario a su hermano. |
Abb. 12: Unterschiedliche Alignierung (Gabriel 2007, 179)
Die Position des Asterisks gibt hier an, „ob der Tonhöhengipfel im ‚zeitlichen Rahmen‘ der Silbe erreicht wird (LH*, early rise ) oder ob er sich aus dem durch die Dauer der Silbe vorgegebenen Zeitfenster heraus nach rechts verschiebt (L*H, late rise )“.16 (Gabriel 2007, 178) Phrasen- und Grenztöne (H-, L- bzw. H%, L%) assoziieren mit den Grenzen hierarchisch höherer prosodischer Ebenen, ihre Alignierung bezieht sich „jedoch auf die mit der betreffenden Grenze adjazente(n) Silbe(n) […], da jede phonetische Materialisierung von Tönen notwendigerweise lautliches Material voraussetzt“.17 (Gabriel 2007, 183)
Die Position von Pitch-Akzenten erklärt man sich heute unter anderem durch pragmatische, d.h. informationsstrukturelle Faktoren.18 Das Topik weist für Hetland und Molnár (2001, 624) eine große prosodische Variation auf, und zwar nicht nur sprachenübergreifend, sondern auch innerhalb einer Sprache. Moroni (2010, 32–33) zufolge wird es nur dann akzentuiert, wenn seine Erkennbarkeit erleichtert werden soll.19 Fokus hingegen markieren die meisten Sprachen mit dem fallenden Pitch-Akzent H*L. Umgekehrt bedeutet dies jedoch nicht, dass auch jede H*L-Kontur Fokus markiert.20 (cf. Hartmann 2007, 225–226) Der Pitch-Akzent, der Fokus markiert und demnach auch als Fokusakzent bezeichnet wird21, kombiniert die fallende Tonhöhe zusätzlich meist mit einer Dehnung. Er wird einer Silbe zugeordnet, die einen Wortakzent trägt.22 Diese Silbe wird in der Literatur meist Fokusexponent genannt.23 (cf. Musan 2010, 46) Andere Silben sind deutlich weniger dazu geeignet, den Fokusakzent zu tragen. Dazu zählen insbesondere Reduktionssilben, d.h. Silben, die ein Schwa enthalten. (cf. Musan 2010, 47)
Читать дальше