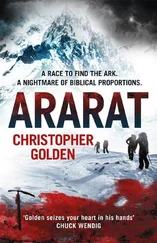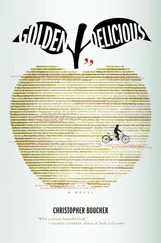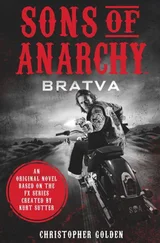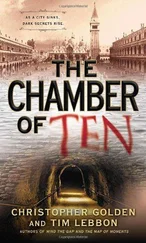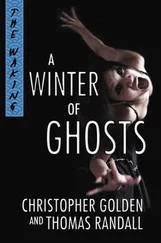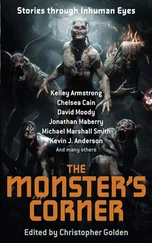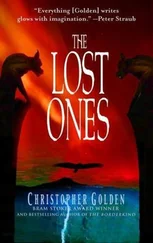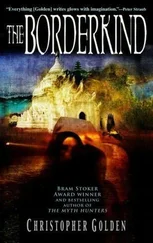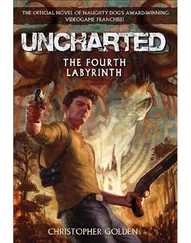Elisa biss sich auf die Unterlippe. Sie hätte ihn ja gerne darauf hingewiesen, dass sie wohl leichter einen Unterschlupf finden würden, wenn er nicht ausnahmslos alle Farmer in der Umgebung übers Ohr gehauen hätte, verkniff sich die Bemerkung jedoch und betrachtete stattdessen die hohen Wolkenberge am Himmel. Schon musste sie die ersten Staubkörner aus den Augen blinzeln. Sie umklammerte Jeremiah an ihrer Brust noch fester. Ihm zuliebe war es das alles wert. Sogar die Betrügereien.
Sich darüber zu ärgern war sinnlos, und doch stieg Wut in ihr auf. Sie stammte aus einer Roma-Familie, die in genau solchen Wagen durch ganz Europa gezogen war. Das war allerdings schon drei Generationen her, und sie wollte nicht mehr so leben wie ihre Vorfahren. Sie war auf die Schule gegangen und hatte sich – mit den Worten ihrer Mutter – zivilisieren lassen. Das war bei Gott nicht das Leben, das sie sich wünschte.
Alles, was Stefan tat, tat er um der Familie willen. Sogar wenn er sein Gebräu aus Kampfer und Alkohol mit den absurdesten Versprechen unter die Leute brachte, tat er dies um der Familie willen. Das konnte sie ihm verzeihen. Doch ohne seine verdammte Rastlosigkeit, die sie überhaupt erst in diesen gottverfluchten Landstrich geführt hatte, wären diese Lügen gar nicht erst notwendig gewesen. Als Fischverkäufer in Boston war er zwar nicht reich geworden, doch sie hatten ihr Auskommen gehabt und in einem richtigen Haus gewohnt. Stefan dagegen war jedoch nach wie vor der festen Überzeugung, dass er es als fahrender Händler zu Wohlstand bringen und ihnen ein besseres Leben ermöglichen konnte.
Der dem Sturm vorauseilende Wind peitschte Elisa dicke, lockige Haarsträhnen ins Gesicht, die sich aus ihrem Pferdeschwanz gelöst hatten. Der Staub tanzte in geisterhaften Wolken auf dem viel befahrenen Weg.
Stefan zog an den Zügeln und rief den Pferden etwas zu. Der Wagen hielt an.
»Elisa! Bring Jeremiah nach hinten!«
Seine Stimme klang angespannt. Nicht aus Wut. Sondern aus Furcht.
Dichte Wolken rollten wie eine dunkle Flutwelle langsam auf sie zu. Schwarze Finger streckten sich aus dem Himmel nach dem Boden aus. Sie hatte selbstverständlich schon Tornados gesehen, war ihnen aber noch nie so nahe gekommen. Vier dünne Säulen aus Staub und Schmutz stoben in alle vier Himmelsrichtungen davon, und wo sie die trockene Erde berührten, hinterließen sie eine Spur von Tod und Zerstörung.
Der Sturm heulte. Elisa stieg mit Jeremiah an der Brust vom Kutschbock, umrundete den Wagen, schlug die Segeltuchplane vor dem hinteren Einstieg zurück und kletterte hinein. Stefan rief den Pferden etwas zu. Sie setzten sich wieder in Bewegung, und er lenkte den Wagen von der Straße auf ein brachliegendes Feld.
Eilig zurrte sie die wenigen Gegenstände fest, die noch nicht gesichert waren. Stefans Elixiere dagegen hätte sie am liebsten aus dem Wagen geworfen. Die vielen Kruzifixe, die er auf seinen Reisen gesammelt hatte, baumelten an Ketten und Haken von der Decke und den Wänden. Durch das kleine Fenster war ein wild tanzender Mann zu sehen, der mit rudernden Armen im Kreis lief.
Jeremiah nahm den Mund von ihrer Brustwarze, machte ein Bäuerchen und sah sie mit so viel Vertrauen und Liebe an, dass sie unweigerlich lächeln musste, bevor sie erneut den Kopf hob und aus dem Fenster blickte. Der tanzende Wahnsinnige taumelte direkt auf den Wagen zu. Der Schrei, der auf Elisas Lippen lag, verwandelte sich in ein erleichtertes Seufzen, als sie merkte, dass es sich nur um eine Vogelscheuche handelte, die der Wind aus dem Boden gerissen hatte. Das Leinwandgesicht wurde gegen die Scheibe gedrückt. Einen Augenblick lang starrten zwei schwarze Knopfaugen in den Wagen, dann forderte der Wind seinen Tanzpartner zurück.
Elisa musste das Kind mit beiden Händen festhalten, als der Wagen ins Schlingern geriet und sich gefährlich nach links neigte. Durch das Fenster erhaschte sie einen Blick auf ein Farmhaus, das im nächsten Moment von einem gewaltigen schwarzen Tornado dem Erdboden gleichgemacht wurde.
Stefan hatte die Zügel fest umklammert und schrie den ängstlich wiehernden Pferden einige saftige Flüche zu. Er musste seine Familie in Sicherheit bringen. Elisa schloss die Augen und hielt den Atem an. Lose Bretter und Dachpappe wurden durch die Luft geschleudert – mehr war von dem Haus, das der Wut des Sturms zum Opfer gefallen war, nicht geblieben.
Elisa legte sich flach auf den Boden des Wagens und schützte ihren Sohn mit ihrem Körper. Sie glaubte nicht an Gott – doch genauso wenig glaubte sie, dass es das Schicksal ihrer Familie war, diese beschwerliche Reise auf sich genommen zu haben, nur um auf einem verödeten Acker zu sterben.
Ein Schauer aus Trümmerteilen, Steinen und Staub prasselte auf den Wagen nieder. Sie hörte Stefan beten. »Lieber Gott«, rief er in den heulenden Sturm, »bitte gib auf Elisa und Jeremiah acht. Schütze uns und halte deine Hand über uns und errette uns vor dieser und allen Gefahren. Amen.«
Elisa würde nicht beten.
Trichterwolken versperrten ihnen den Weg, schienen sie förmlich zu umzingeln. Doch sie würde nicht beten.
Wenn es denn einen Gott gab, dann war er sicher vor langer Zeit taub geworden.
Vier
Gayle Franklin schluckte den heißen Staub auf ihrer Zunge herunter und blickte mit großen Augen zum Himmel auf. Noch war es windstill. Durch das Fenster sah sie, dass der sich setzende Staub so dicht wie Mitternachtsnebel in der Luft hing.
Der Sturm kam direkt auf sie zu. Die gewaltige Wand aus wirbelndem Staub und Wind in Hurrikanstärke drohte sie zu verschlingen. Sie musste von hier weg, doch ihre Beine wollten ihr nicht gehorchen. Ihr Vater rannte so schnell, wie er konnte, durch das Feld auf das Haus zu. Dabei hielt er sich ein Taschentuch vors Gesicht, damit er inmitten der dichten grauen Schleier überhaupt Luft bekam. Jeder seiner Schritte wirbelte eine kleine Staubwolke auf. Gayle sah seine vor Entsetzen aufgerissenen Augen.
»Pa …«, rief sie mit zitternder Stimme.
Früher war er groß und stark gewesen, jetzt nur noch so klapperdürr wie die Vogelscheuche, die der Wind mitgerissen hatte. Der Sturm hatte Beute gewittert und war ihrem Vater auf den Fersen. Wieder rief sie nach ihm, ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern.
Die mitternachtschwarzen Wolken näherten sich. Noch bevor sie den Boden berührten, schienen schattenhafte Gestalten daraus aufzusteigen, doch das war natürlich Einbildung. Oder hatte sie etwa Fieber? Jedes Kind – zumindest jedes Kind, das in Kansas aufgewachsen war – wusste, dass ein Tornado nichts mit sich reißen konnte, wenn er den Boden noch nicht berührt hatte.
»Lauf, Pa … schneller …« Gayle legte eine Hand auf die Fensterscheibe. Gerade eben war sie noch warm gewesen, jetzt fühlte sie sich eiskalt an. Sie sah von ihrem Vater, der jetzt schon viel näher gekommen war und mit wirbelnden Beinen auf das Haus zurannte, zur Farm von Lorenzo und Enid Yancey hinüber. Die beiden hatten ebenso hart gearbeitet wie Gayles Eltern, wenn auch mit weniger Erfolg. Plötzlich fuhr der Tornado wie der Finger Gottes auf das Dach des ihr so vertrauten Gebäudes nieder.
Starr vor Schreck trat Gayle vom Fenster zurück. Die Yancey-Farm löste sich einfach auf, wurde vom Tornado verschluckt. Das gerade noch so dünne Ende der Windhose hatte sich in einen wirbelnden Derwisch verwandelt, der brüllend und zuckend das Heim der Yanceys dem Erdboden gleichmachte.
Gayle sah zum Himmel auf und rechnete halb damit, in eine wütende Fratze mit einem abscheulichen Mund und Augen aus Blitzen zu blicken, aber in den schwarzen Wolken war nichts zu erkennen. Das war nur ein schwacher Trost. Dass der rasende Sturm kein Gesicht hatte, machte es auf gewisse Weise sogar noch schlimmer.
Die Haustür wurde aufgerissen. Der Wind knallte sie wieder und wieder gegen die Wand. Dumpfe Trommelschläge, die ihr beinahe ebenso große Angst machten wie das Gebrüll des Tornados.
Читать дальше