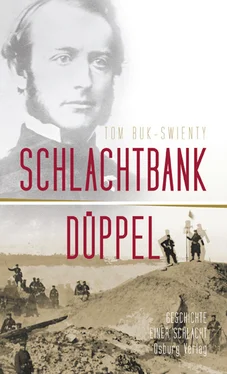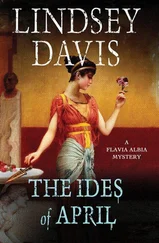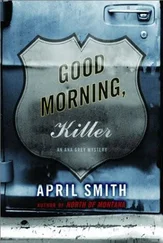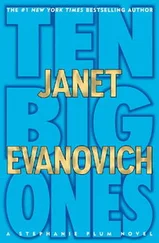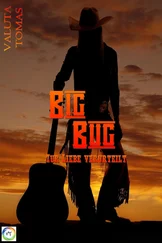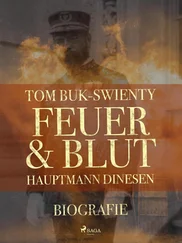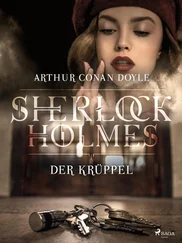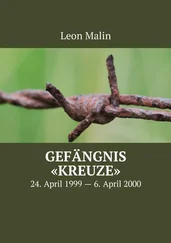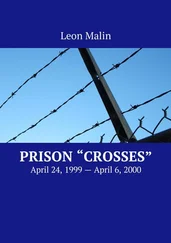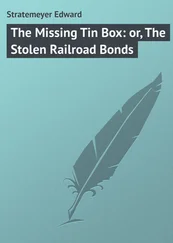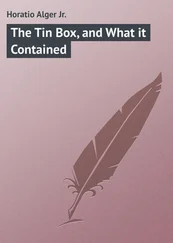Sollte er, sollte er nicht? Es herrschte Uneinigkeit unter den preußischen Generälen, vor allem der aufbrausende und temperamentvolle Blumenthal regte sich auf. Auch er war deutlich nervös und voller Zweifel, doch andererseits ertrug er die Wankelmütigkeit seines Vorgesetzten nicht. Er wollte das Ganze überstanden wissen. Abmarsch und kurzer Prozess. Er beschimpfte den Prinzen bei den Treffen des Generalstabs. Die anderen Generäle hörten staunend zu, als der Oberst brüllte: »So tun Sie doch etwas! Angriff!«
Friedrich Karl indes unternahm nichts. Am 1. April zog ein schweres Unwetter auf. Die Wellen türmten sich meterhoch im Sund, und Friedrich Karl betrachtete es als ein Eingreifen des Herrgotts, der ihm ein Zeichen gab. Die Überfahrt nach Alsen wurde ad acta gelegt und stattdessen beschlossen, die Stellungen bei Düppel durch einen Frontalangriff zu nehmen.
Allerdings waren die Strategen der Ansicht, die Schanzen wären zu stark, um sie lediglich anzugreifen, ohne sie zuvor unter systematischen Beschuss genommen zu haben. Friedrich Karl und die preußischen Generäle spürten gleichzeitig, dass die Zeit gegen sie arbeitete. In Berlin wuchs die Ungeduld. Wo blieb der große Sieg? Es musste bald etwas Entscheidendes geschehen auf dem Kriegsschauplatz im hohen Norden.
Und genau das – etwas Entscheidendes – wollte der Prinz am 17. April zustande bringen. Er und seine Offiziere hatten einen sinnreichen Schlachtplan ausgearbeitet; eine organisatorische Kraftanstrengung, bei der nichts dem Zufall überlassen bleiben sollte.
Seinen Generälen und den anderen hochrangigen Offizieren im Hvilhøj Kro gab er ganz spezielle Befehle, wie die Schlacht um die Düppeler Schanzen am nächsten Tag geschlagen werden sollte. Die Instruktionen lauteten:
In der Nacht zum 18. April rückt die erste Hälfte der Angriffstruppen um 1.30 Uhr bis Bøffelkobbel vor und bezieht von dort aus im Schutz der Dunkelheit und so lautlos wie möglich die preußischen Schützengräben (Parallelen) vor den Schanzen. Um 2.00 Uhr folgt die nächste Angriffskolonne. In den Parallelen legen sich die Truppen auf den Boden und bleiben so still wie möglich liegen – gleichzeitig wird das auf diesem Feldzug heftigste Artilleriefeuer auf die dänischen Schanzen eröffnet. 102 Kanonen werden mit unerhörter Vehemenz und Geschwindigkeit Feuer speien – Granaten und Brandbomben. Sechs Stunden soll dieses Inferno dauern. Um 10.00 Uhr wird der Beschuss der Artillerie für einen Augenblick unterbrochen, die Kanonen werden auf die dänischen Truppen hinter den Schanzen gerichtet. In dem Moment, in dem die Kanonen schweigen – Punkt 10.00 Uhr –, geht es los.
Die Generäle hörten zu. Sie waren bereit. Mehrere Tage hatten Pioniereinheiten den Sturmlauf auf Kopien der dänischen Schanzen trainiert, die man auf Broager und bei Nybøl nachgebaut hatte. Die Angriffstruppen waren aufmarschiert, alle Batterien in Stellung gebracht, die letzte Parallele gegraben.
»Noch Fragen, meine Herren?«, kam es vom Prinzen.

Abb. 7: Preußischer Artilleriepark bei Düppel.
Zunächst Schweigen. Dann durchdrang eine laute, selbstsichere Stimme den Kreis der Offiziere, die Friedrich Karl in einem Halbkreis umstanden. Adjutant von Geisler hielt die Begebenheit fest. Der Ton der Stimme, so von Geisler, war »so ruhig und geschäftsmäßig, als handle es sich um eine Frage nach der Aufnahme der Richtung. Wenn die vorderste Kolonne stutzt, Königliche Hoheit, so darf doch von hinten auf sie geschossen werden [um sie voran zu treiben]? Alles sah nach dem Sprecher hin, einem langen, hageren General mit eigentümlich spitzem Kopf, einer Brille auf der Nase und dem Habitus eines Schulmeisters. Es war Goeben. Der Prinz selbst schien einen Augenblick betroffen, doch bald erwiderte er: ›Das wird nicht vorkommen!‹ Und gleich darauf nochmals mit einer Handbewegung: ›Das wird nicht vorkommen.‹«
Nach der Besprechung der Offiziere im Hvilhøj Kro und ungefähr zur gleichen Zeit, als Wilhelm Gather seinen Eltern schrieb, ritt der Rote Prinz mit seinem Stab auf der breiten Sønderborg-Chaussee zur Front bei Düppel. Einen Kilometer westlich der dänischen Schanzen erreichte er den höchsten Punkt der Gegend, den Avnbjerg, von dem er eine vorzügliche Aussicht über die Landschaft hatte. »Ich kam mir vor wie jener König, der mit vergnügten Sinnen auf das beherrschte Samos blickte«, schrieb Prinz Friedrich Karl später über diesen Moment.
Er sah Buchten, Meer und Hügel. Auf der Halbinsel Broager sah der Prinz die großen Batterien bei Gammelmark, die Granaten über den Vemmingbund auf die dänischen Stellungen schossen. Diese Batterien waren die Trumpfkarte des Prinzen. Sie bestanden aus modernen, gezogenen Hinterladerkanonen, die den südlichen Teil des dänischen Verteidigungswerks, die linke Flanke, effektiv beschossen. Seit Anfang April hatten sich die Dänen auf das Duell mit den Batterien von Gammelmark eingelassen. Vor allem Schanze 2, eine der südlichen Schanzwerke, die am höchsten lag, hatte den Beschuss erwidert. Sie wurde geführt von den beiden kaltblütigen Leutnants Ancker und Castenskjold, die für ihre Männer eine Legende waren und hohen Respekt beim Feind gewannen. Aber die Düppeler Stellungen waren nicht dafür gebaut, das Feuer aus Broager zu erwidern, sondern primär, um gegen einen Feind zu kämpfen, der vor den Schanzen stand – in dem eigentlichen Schanzwerk war nur Platz für relativ wenige Kanonen, die sich auf ein Duell mit den preußischen Batterien einlassen konnten.
Dennoch waren die Kämpfe zwischen Schanze 2 und den Broager-Batterien im März und Anfang April nicht weniger heftig gewesen. Im Laufe des April jedoch wurde die Überlegenheit der Preußen immer größer, und am 17. April war die dänische Artillerie so gut wie zum Schweigen gebracht.
Die Batterien von Gammelmark waren lediglich ein Teil der zahlreichen Artilleriestellungen, über die die Preußen verfügten: Ganze 33 Batterien auf die Dänen gerichtete Geschütze hatte man vor den Schanzen eingegraben, und egal, ob Friedrich Karl seinen Blick in Richtung Westen, Osten oder Norden richtete, sah er dunkle Kanonenrohre, deren Mündungen grimmig in die Luft ragten. Er sah den Rauch von ihren Schüssen, und er hörte das dumpfe Dröhnen, das die Landschaft erzittern ließ. Und er sah die Granaten – die Dänen nannten sie ›Broager‹, ›Feldhühner‹ oder ›Störche‹ –, über das ausgedehnte preußische Laufgrabensystem fliegen. Die Laufgräben führten jetzt fast bis an die Schanzen heran – als würden sie den Hals ausstrecken, um den dänischen Stellungen den Todeskuss zu geben. Der Prinz konnte den Bahnen der Granaten folgen und ihre Einschläge in den Schanzen beobachten, die ausgebrannt und beinahe wie in den Boden geduckt vor ihm lagen.
Der viel besungene und weit geschwungene Hügelkamm, die Düppeler Höhe, hatte sich in eine graue und schartige Landschaft verwandelt. Die Höfe der Gegend waren zusammengeschossen. Das Dorf Düppel westlich der Frontlinie gleich hinter dem Avnbjerg bestand ebenfalls nur noch aus einem Haufen Ruinen, dasselbe galt für das Dorf Ragebøl im Nordwesten. Große Teile von Sønderborg im Osten existierten nicht mehr, und auch gegenüber von Sundeved gab es auf der anderen Seite des Sunds Zerstörungen (allerdings kann man vom Avnbjerg bis dorthin nicht sehen). Auf der Düppeler Seite waren die Bäume verschwunden, nur wenige verkohlte Büsche ragten noch aus der nackten Erde.
Der Ort war der Vorhof der Hölle, obwohl die dänischen Soldaten eine eher prosaische Bezeichnung für ihre Stellungen hatten: Sie nannten sie ganz einfach ›Schlachtbank Düppel‹. Ein makabrer Name. Und vielleicht noch demoralisierender war die unfassbare Trostlosigkeit des Ortes. Es sah aus, als würde sich die ganze Landschaft aus Solidarität mit den hart geprüften Truppen vor Schmerzen winden.
Читать дальше