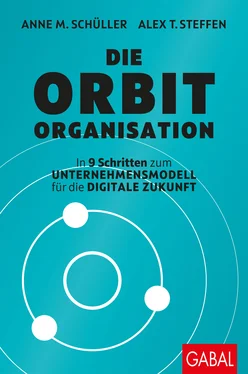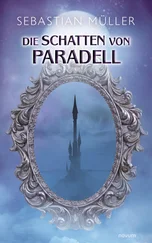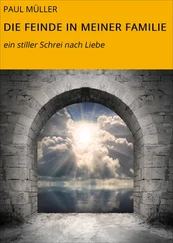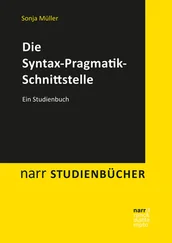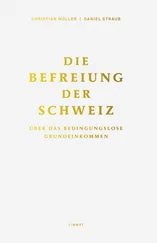Die meisten Unternehmen agieren selbstbezogen und effizienzgetrieben. Tunlichst sollen sich die Kunden in die von den Anbietern vorgedachten Abläufe fügen, umständliche Formalien akzeptieren und im Takt der altersschwachen Unternehmenssoftware ticken. Heißt: Die Klientel soll ackern, damit man selbst nicht so viel Arbeit hat. Manche Unternehmen sind richtig gut darin, Vorgehensweisen mühsam zu machen, einem die Zeit zu stehlen und schlechte Gefühle zu verbreiten. Niemand glaube doch bitte im Ernst, dass die Leute so was noch lange erdulden! Längst liegt die Macht bei den Kunden. Mit ihren Aktionen, bei denen sie sich zu virtuellen Schwärmen verbinden, können sie über Leben und Tod eines Anbieters entscheiden. Das geht heute ruckzuck.
Während sich also draußen alles vernetzt, agieren klassische Organisationen noch immer in »Silos«. Aufgaben werden entlang von internen Berichtslinien organisiert. Zukunftsunternehmen hingegen strukturieren sich entlang der Kundenaufgaben. Aus Kundensicht müssen Prozesse crossfunktional ablaufen und sich reibungslos miteinander verzahnen. Wer Prozesse zwar optimiert, aber nicht auf die Kundenbedürfnisse abstimmt, wird immer besser darin, das Falsche zu tun. Wirklich kundenorientiert ist nur der, der sämtliche möglichen Ärgernisse vom Kunden zum Anbieter verschiebt, sodass aufseiten des Kunden nur noch positive Erlebnisse übrig bleiben. Und das ist mehr als ein feiner Unterschied. Denn jede einzelne kundenrelevante Unannehmlichkeit ist ein Einfallstor für Disruptoren. Also gilt:
Erst der Kunde, dann die interne Effizienz. Erst der Kunde, dann das Produkt, die Lösung, die Technologie.
Eine kundenzentrierte Organisationsentwicklung ist unabdingbar. Unternehmen werden heute von den Kundenwünschen gesteuert. Was den Kunden nervt oder ihn kalt lässt, fällt von jetzt auf gleich durch. Schonungslos. Nur wenn es den Kunden gut geht, geht es auch dem Unternehmen gut. Zahlungsbereite Menschen, Toptalente und auch die Gesellschaft erwarten zudem längst, dass ein Unternehmen hehrere Ziele verfolgt als Marktführerschaft und Maximalrenditen. Sie wollen wissen, welchen Nutzwert ein Anbieter den Menschen bietet. Dieser Nutzwert, der Daseinssinn, das Warum heißt im Englischen »Purpose«. Er bestimmt die Identität eines Unternehmens, erzeugt qualitatives Wachstum und macht Wettbewerbsvorsprünge sehr wahrscheinlich.
Im besten Fall ist dieser Purpose ein MTP: ein massiv transformativer Purpose. 4Er ist sinnstiftend, inspirierend, vorausschauend, kühn, verändernd und zugleich so attraktiv, dass er sowohl Kunden als auch Toptalente magisch anzieht. Er erzeugt pulsierenden Tatendrang, ein Treibhausklima für Spitzenleistungen, ein Biotop für brillante Ideen. Den Unternehmen, die das nicht haben, gehen bald drei Dinge aus: die Innovationen, die Leistungsträger und die Einnahmenbringer. In Kapitel eins dazu mehr.
Company-Redesign: Aufbruch in die Erneuerung
Ein Company-Redesign ist, wie in unserem gemeinsamen Buch Fit für die Next Economy bereits angerissen, längst unumgänglich, um mit der anrollenden Hochgeschwindigkeitszukunft Schritt halten zu können. So propagieren wir den konsequenten Übergang von einer aus der Zeit gefallenen pyramidalen zu einer zirkulären Unternehmensorganisation. Wir beschreiben den Weg von einer auf Effizienz getrimmten Arbeitswelt hin zu einer lebendigen Innovationskultur und zugleich den Wandel von einer Wettbewerbs- zu einer Kooperationskultur.
Das Ziel? Eine Organisation, die nicht länger hierarchisch, also kraft formell verliehener Macht, von oben nach unten und von innen nach außen agiert, sondern eine, die sich dezentralisiert und weitgehend selbstorganisiert auf das Kundenwohl fokussiert.
Gibt es Patentrezepte dafür? Nein, gibt es nicht. Businesssituationen sind verschieden, also müssen es auch die Methoden sein. Jede Firma muss ihren eigenen Weg für sich finden, experimentieren und ausprobieren. Wenn es Blaupausen gäbe, dann wäre ein Business irrelevant, denn jeder würde einfach der Blaupause folgen und alle würden ein identisches Resultat erzielen. Standardrezepte sind sogar höchst gefährlich. Denn keine zwei Unternehmen sind gleich. Branchen und Märkte sind genauso individuell wie Geschäftsmodelle und Kundenstrukturen. Die Unternehmensgröße spielt eine Rolle. Landestypische Gegebenheiten und kulturelle Besonderheiten sind zu beachten. Restriktionen, die einem Unternehmen durch Gesetze, Behörden, Börsenvorschriften, Investoren und Anteilseigner auferlegt werden, müssen berücksichtigt werden.
Die Führungsspitze muss sich ausdrücklich zum Wandel bekennen.
Der größte Fehler: Fix-und-fertig-Lösungen einzukaufen und der Organisation einfach überzustülpen. Die gebrauchsanweisungssüchtigen Manager von früher sind obsolet. Damit Akzeptanz, gepaart mit hohem Engagement, entsteht, muss in einem geschützten Raum von Versuch und Irrtum eine ureigene Form entwickelt werden. Natürlich ergibt es Sinn, sich von externen Profis inspirieren zu lassen. Außerdem können Pioniere wertvolle Denkanstöße liefern. Doch gedankenlos nacheifern darf man ihnen nicht. Was bei dem einen großartig funktioniert, kann anderswo grandios scheitern.
Eins braucht es allerdings in jedem Fall: den Grundsatzentscheid, den Umbau als solchen loszutreten. Denn ohne einen ausdrücklich bekundeten Willen, der von der Führungsspitze ausgehen muss, wird jede organisationale Metamorphose zum Rohrkrepierer. Zudem hat die oberste Stelle die strikte Obliegenheit, das Umbauprojekt zu schützen, zu unterstützen und zu begleiten. In Kapitel neun dazu mehr.
Doch kann der organisationale Erneuerungsschalter in einem Ruck umgelegt werden? In wenigen Einzelfällen ist das sicher möglich. Doch normalerweise, das sagen alle, die Transformationsprozesse hinter sich haben, sollte das Pendel nicht zu überhastet oder zu hart in Richtung Hierarchiefreiheit und Selbstorganisation schwingen. Wer alle Wände gleichzeitig einreißt, dem fällt das Dach auf den Kopf. Nur ganz wenige meinen, man müsse zunächst einen Radikalschnitt machen. Das sind wohl in erster Linie die, die an Lizenzen oder Beratungsmandaten verdienen. Utopien sind zwar schön, doch praxistaugliche Vorgehensweisen sind besser. Eine entscheidende Frage ist damit diese:
Was ist die minimal notwendige Machthierarchie, die minimal notwendige Ordnungsstruktur und die maximal mögliche Form der Selbstorganisation?
Anstatt sich in monströsen Transformationsprojekten zu vertrödeln, die ewig dauern, obwohl doch eigentlich niemand noch länger warten kann, empfehlen wir, mit einzelnen Trittsteinen rasch zu beginnen. Viele der im Verlauf dieses Buches vorgestellten Maßnahmen lassen sich für einen schrittweisen Übergang nutzen, ohne dass gleich alles komplett über Bord gehen muss. Denn wir Menschen sind von Natur aus auf schnelle Ergebnisse aus. Kleine, schnell umsetzbare Schritte kommen dieser Neigung entgegen. Außerdem machen Erfolgsstorys zügig die Runde – und dann Hunger auf mehr.
Wenn man so vorgeht, werden zentrale Instanzen zwar aufgebrochen, Führung ist aber noch vorhanden, vor allem da, wo es um strategische Entscheidungen geht. Wer versucht, Hierarchien mit Gewalt einzuebnen, sorgt für ein Vakuum, in dem sogleich wieder Machthierarchien entstehen. Denn Gemeinschaften brauchen ein Ordnungssystem – und genügend Struktur, um die unerlässliche Qualität sicherzustellen und Abwege möglichst frühzeitig auszuschließen. Das muss auch jedes Start-up lernen, sobald es größer wird.
Doch niemand braucht einen Wasserkopf. Klassische Managementformationen sind die meiste Zeit mit sich selbst beschäftigt. Sie unterhalten ausufernde Planungs-, Kontroll- und Reportingstrukturen. Sie verlieren sich in endlosen Abstimmungsschleifen und verirren sich im eigenen Vorschriftengeflecht. Binnenorientierte Bürokratie kostet unglaublich viel Kraft, weil alles in starren Vorgehensweisen und politischen Spielchen versinkt. Massenhaft wird geklagt, dass für die eigentliche Arbeit höchstens die Hälfte der Zeit übrig bleibt, ein Großteil gehe für »Organisation« drauf, das ganze ärgerliche Drumherum. Das ist doch der helle Wahnsinn! Pure Ressourcenverschwendung, die nur kostet, aber zu keinerlei Wertschöpfung führt!
Читать дальше