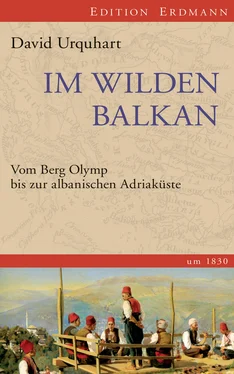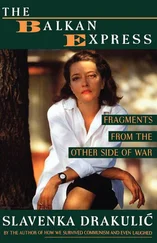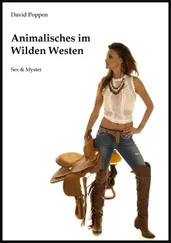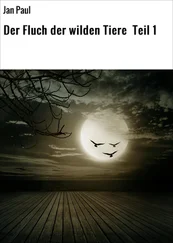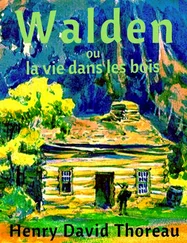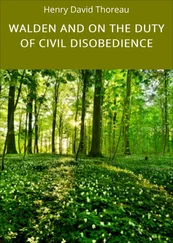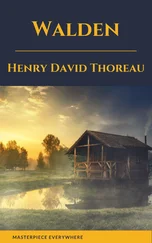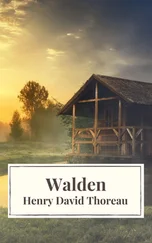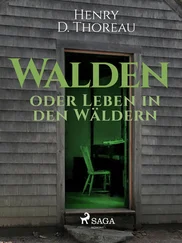Urquhart erhielt daraufhin den Auftrag, sich von der tatsächlichen Lage der Dinge ein Bild zu machen. Er brach also auf dem Landweg nach Italien auf, setzte bei Otranto nach Korfu über, das damals unter britischer Herrschaft stand, um in einer Nacht- und Nebelaktion und unter Vermeidung der offiziellen Fährpassagen die albanische Küste zu erreichen. Den türkischen Statthalter von Hagía Saránda, dem modernen Sarandë in Südalbanien, der ihn den allgemeinen Vorschriften gemäß unter Quarantäne stellen wollte, ignorierte Urquhart, um sich möglichst rasch auf den Weg nach Skutari/Skodra im heutigen Nordalbanien zu begeben, das ein übergeordneter Verwaltungssitz und zugleich das Zentrum des albanischen Aufstands gewesen war. Urquhart beschreibt dabei die Städte, durch die er kam, berichtet von den großen Schwierigkeiten, die ihm überall begegneten, bestand so manches Abenteuer, doch auch die Schilderungen von eindrucksvollen Landschaften und auffälligen geologischen Formationen kommen nicht zu kurz. Dasselbe gilt für die größeren historischen Zusammenhänge, die er – natürlich aus seiner Sicht als ausgewiesener Türkenfreund – nicht verschweigt. Schließlich trifft er zu jenem Zeitpunkt in Skutari ein, als die Aufständischen kapituliert hatten und die das Land und die Städte bislang so sehr prägenden albanischen Festungen dem abgeschlossenen Friedensvertrag gemäß bereits geschliffen wurden.
Die Reise sollte Urquhart noch bis nach Konstantinopel führen, doch bricht er den Bericht in Skutari ab. Die Gründe, die er dafür angibt, sind nicht unbedingt plausibel, denn nach drei langen Kapiteln mit Überlegungen zu türkischen Institutionen und zur türkischen Lebensweise, die auch anderswo ihren Platz hätten finden können und die spätere Aufenthalte im Osmanischen Reich voraussetzen, endet der Band. Die Seitenzahl, die ihm sein Verleger zugebilligt hätte, sei ausgefüllt, und die weiteren Ereignisse und Stationen der Reise könne er allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt zu Papier bringen. Eher wird man jedoch davon ausgehen können, dass ab Skutari der offizielle Teil seiner diplomatischen Mission begann, die den Fragen der Grenzregulierungen gewidmet war und die in die bereits oben erwähnte zweite Londoner Konvention einflossen, also Themenkreise, die nicht unbedingt einem größeren Publikum offen gelegt werden durften. Zerstreuen konnte Urquhart jedenfalls die Befürchtungen der europäischen Großmächte, dass nach dem Erfolg der Griechen in Albanien ein neuer Krisenherd entstanden sei, der sich zu einer großen Gefahr für den Fortbestand des Osmanischen Reichs hätte entwickeln können. Andererseits war es für ihn jedoch kaum einsehbar, warum die europäische Politik den Griechen die Unabhängigkeit zugestanden hatte, während man dasselbe den Albanern verweigerte, die nun ihrerseits ganz ähnliche Ansprüche erhoben hatten. Urquhart erwähnt diesen Widerspruch sehr wohl, wenn er auch der Meinung ist, dass nicht das Vorgehen gegen die Albaner, sondern die Zugeständnisse an die Griechen der entscheidende Fehler in der internationalen Politik gewesen sei.
Als überzeugter Tory ist er der Ansicht, dass man an den bestehenden Verhältnissen nicht allzu viel verändern solle – und wenn, dann nur ganz behutsam. Auch dürfe sich der Staat nicht über Gebühr in die Lebensverhältnisse seiner Bürger einmischen – wie sehr hätte er da wohl unter der allgemeinen Reglementierungswut unserer Tage zu leiden! –, und gerade in dieser Hinsicht wäre die Lebensweise der Türken für ganz Europa vorbildlich. Er argumentiert dabei so, dass der Familienverband und in Abhängigkeit davon eine gemeinschaftlich organisierte ländliche Verwaltungsstruktur die Keimzelle eines jeden funktionierenden Staatswesens darstellen müsse. Denn Ruhe und Zufriedenheit im kleineren Bereich seien auf Dauer die einzigen Garanten dafür, dass ein Staat aus sich heraus existieren und diese Verhältnisse in seinem Territorium sichern könne. Urquharts Landschaftsschilderungen zielen daher auch meist darauf ab, die Vorzüge einer bestimmten Gegend herauszustellen und darauf hinzuweisen, dass ein Dorf oder eine ganze Region aufgrund der vorhandenen Ressourcen sehr gut lebensfähig wären – man müsse die Menschen eben nur gewähren lassen und dürfe sie vor allem nicht zur politischen Agitation verführen. Die Ergebnisse wären in Griechenland wie in Albanien die gleichen: Zerstörte Landschaften, brachliegende und verwilderte Felder, Entvölkerung, eine hohe Kriminalität und Verfall der allgemeinen Sitten. Und es bedürfte großer Anstrengungen mit ungewissem Ausgang, die einmal verlorenen Strukturen wieder aufzubauen. Der geordnete Hausstand mit intakten Regeln ist für Urquhart diejenige Institution, die über dem Recht des Staates auf den Einzelnen stehen muss, und nach seiner Überzeugung traf gerade dies im sogenannten Konzert der Großmächte nur auf das Osmanische Reich zu.
Mit solchen Überzeugungen gab sich Urquhart natürlich als Sozialromantiker und damit auch wieder als ein typischer Vertreter seiner Zeit zu erkennen. Dem kann man auch entnehmen, warum er sich beim besten Willen nicht mit Karl Marx verstehen konnte. Denn diesem schwebte nach einer Zerschlagung der bestehenden Verhältnisse ein allumfassendes System vor, das zwar gut gemeint gewesen sein mochte, das aber mit seinem weltumspannenden Anspruch alle Menschen in die engsten aller nur denkbaren Fesseln gelegt hätte. Urquhart stellte dagegen die Freiheit des Individuums in den Mittelpunkt seiner Interessen, auch wenn dies gerade in seinem Fall zu allerlei skurrilen Ausprägungen führen sollte.
Vor diesem Hintergrund haben auch die eher theoretischen Abschlusskapitel durchaus ihre Berechtigung, denn gerade darin lässt sich der Autor darüber aus, was für ihn den osmanischen Staat ausmachte: Ausführlich beschreibt er das türkische Familienleben, äußert sich über den Harem, über den in Europa seiner Überzeugung nach nur krankhafte Phantasien im Umlauf waren, schreibt ausführlich über die häusliche und schulische Erziehung, aber auch über die Stellung der türkischen Frau, die erheblich mehr Rechte besaß als eine Westeuropäerin jener Tage, und die in Wirklichkeit an der Spitze der Familienverbände gestanden habe. Gerade diese Ausführungen Urquharts verleihen dem Band auch in unserer Zeit eine sehr große Aktualität, in der allenthalben über die Integrationswilligkeit oder -fähigkeit ausländischer Bevölkerungsgruppen räsonniert wird. Denn viele jener Merkmale, die er als wesentlich für den türkischen Charakter beschreibt, treffen wirklich zu und verdeutlichen die grundsätzlichen Unterschiede zwischen der westeuropäischen und der türkisch-orientalischen Wesensart. Somit erschließt es sich einem Leser sehr rasch, dass zwar ein Miteinander, jedoch keine Integration möglich ist. Und will man letztere erzwingen, führt dies notwendigerweise zu Spannungen und Konflikten, weil beide Seiten verlieren: Auch dafür nennt Urquhart in seinem Buch einige Beispiele.
Übrigens gab es einen deutschen Autor, der Urquharts orientalische Bücher allesamt kannte und in seinen eigenen Werken verarbeitete: der aus Radebeul bei Dresden stammende Karl May. Urqhuarts Reisen durch den Orient waren für ihn das Vorbild für die so lange Reise seines Kara ben Nemsi durch das unermesslich große Reich des Padischahs. Zahlreiche Motive wie etwa bestimmte Überfälle fanden sich schon bei Urquhart, und dass Karl Mays skurriler britischer Reisegefährte den Vornamen David trug, ist kein Zufall. Sogar Karas treuer Diener Hadschi tritt bereits in der literarischen Vorlage auf.
Den Text schrieb Urquhart in einem gefälligen, wenn auch nicht ganz einfachen Englisch mit oftmals sehr langen Sätzen, die man in der deutschen Syntax und Grammatik meist nicht übernehmen kann. In der 1838 erschienen Übersetzung wurde diese Satzstruktur jedoch in der Regel nachgeahmt, was den Text an vielen Stellen unverständlich macht und nicht selten sogar zu Sinnentstellungen führt. Diese Mängel wurden in der vorliegenden Ausgabe weitestgehend behoben. Darüber hinaus wurde die bisweilen sehr schwerfällige Sprache des 19. Jahrhunderts an den modernen Sprachgebrauch angepasst. Dies gilt umso mehr für Worte und Formulierungen, die man heute nicht mehr ohne weiteres versteht. Dennoch sollte ganz bewusst keine Übertragung in ein modernes Deutsch erfolgen, weil dies dem zugrunde liegenden, für uns heute oft komplizierten Englisch keinesfalls entsprochen hätte. Sicherlich hätte man den gesamten Text noch viel weiter glätten können, aber damit hätte man ihn auch aus seiner Entstehungszeit gerissen. Da aber Inhalt und sprachliche Form eine Einheit bilden sollen, rechtfertigt dies eine eher behutsame Umwandlung in ein Deutsch, das einerseits mögliche Missverständnisse vermeidet, das sich andererseits aber auch als Sprache des 19. Jahrhunderts zu erkennen gibt. Solche Texte noch mehr zu schönen und an den jeweils herrschenden Zeitgeschmack anzupassen, wäre mehr als nur unseriös. Zum Zeitpunkt der Entstehung der ersten Übersetzung war man in Sachen der Orthographie ja noch relativ frei, das heißt, es gab noch keine allgemein verbindlichen Rechtschreiberegeln. In dieser Hinsicht wurde der Text jedoch im Wesentlichen an die heutigen Lesegewohnheiten angepasst, auch wenn Inhalt und Sprachgebrauch eine strikte Anwendung der neuen deutschen Rechtschreibung nicht zulassen. Somit bestand bisweilen die Notwendigkeit zu Kompromissen, aber die Bemühungen zielten auf ein insgesamt einheitliches Bild der verwendeten Orthographie ab.
Читать дальше