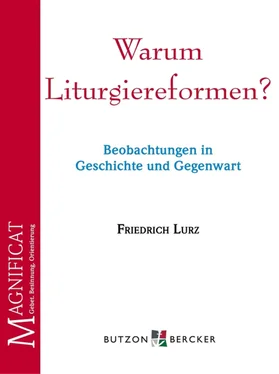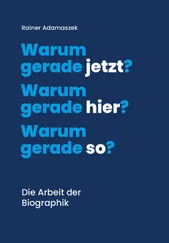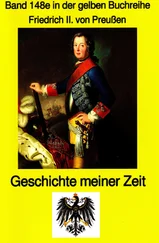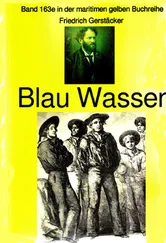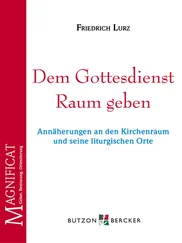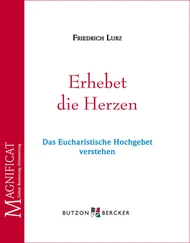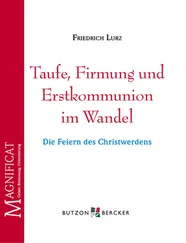Die Überlieferung vom Letzten Abendmahl Jesu (1 Kor 11, 23–25, Lk 22, 19f. und Mk 14, 22–25, Mt 26, 26–29) wurde in der Folge grundlegend für die Gestalt und das Verständnis dieser Feiern, die als Verwirklichung von Jesu eigenem Auftrag „Tut dies zu meinem Gedächtnis“ (1 Kor 11, 24f.) verstanden wurden. Auch wenn viel dafür spricht, dass dieses letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern ein Pessachmahl war, so sind die aus den Einsetzungsberichten ableitbaren Elemente solche, die in jedem jüdischen Festmahl dieser Zeit anzutreffen waren. Es war durch mehrere Weinbecher gegliedert, die gemeinsam getrunken wurden. Dieses zeitgenössische jüdische Festmahl bildete den allseits bekannten Verstehenshorizont, der erst das spezifisch Christliche der Feier erkennen ließ. Denn Jesus selbst gab einzelnen Elementen einen neuen Sinn. Sie zeigte sich in den Worten „Das ist mein Leib für euch“ (1 Kor 11, 24) und „Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut“ (1 Kor 11, 25), mit denen er seinen bevorstehenden Tod als Lebenshingabe für die Seinen deutete. In der Erfüllung des Wiederholungsauftrags, wie ihn Paulus formulierte: „Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt“ (1 Kor 11, 26), erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gemeinschaft mit Jesus, dem Christus, der bis zur endgültigen Durchsetzung der Gottesherrschaft sowohl als abwesend als auch als pneumatisch-sakramental anwesend erfahren wurde.
Während die Liturgiewissenschaft aus diesen Erkenntnissen bislang abgeleitet hatte, dass das eigentliche Sättigungsmahl zwischen Brotbrechen zu Beginn und Becher mit Segensgebet zum Abschluss schon in neutestamentlicher Zeit aus der Eucharistiefeier ausgelagert wurde, gibt es in jüngerer Zeit Forschungsansätze, die die Mahlzeiten der frühen Christenheit aus den hellenistischen (d. h. den hellenisierten jüdischen) Mahlfeiern in Form des Symposions ableiten. Die Zuordnung, d. h. das Ineinander von Sättigungsmahl und Eucharistie, ließe sich besser erklären wie auch der in 1 Kor 11 aufscheinende Konflikt. Weiterhin würden aber Brotsegen und Brotbrechen konstitutive Elemente der frühen christlichen Mähler sein, die aus dieser hellenistischen Form nicht herzuleiten wären.
Auch das Eucharistische Hochgebet, das die Sinngestalt der Feier prägt, aber textlich erst in späteren Jahrhunderten greifbar ist, kann bislang nur aus jüdischen Formen abgeleitet werden: dem Gebet nach dem Essen beim jüdischen Festmahl (Birkat ha-mazon) und dem davon unabhängigen Dankopfergebet (Toda).
Trotz bruchstückhafter Quellenlage wird an dieser zentralen Feier schon deutlich, dass christlicher Gottesdienst an jüdische liturgische Formen anknüpfte, selbst wenn sie hellenistisch beeinflusst waren. Zugleich war das Christus-Ereignis, die Erfahrung der Auferweckung Jesu, die die Besiegelung des Anbruchs der Gottesherrschaft darstellte, von solch prägender Kraft, dass Umformungen und Ergänzungen zu einer eigenständigen Sinngestalt führten, die für die zeitgenössische jüdische Umwelt nicht mehr akzeptabel waren.
Beispiel: Der Wortgottesdienst der Eucharistiefeier
Auch auf anderen Gebieten erweist sich der frühe christliche Gottesdienst sowohl als Anknüpfung an jüdische Vorbilder als auch als Neuschöpfung bzw. Herausbildung eigener liturgischer Formen. Die Schwierigkeit, konkrete Aussagen zu machen, liegt oftmals darin begründet, dass uns allein Quellen aus späteren Jahrhunderten vorliegen, bei denen man im Einzelnen abschätzen muss, inwieweit sie etwas beschreiben, das schon zuvor üblich war. Es gab zunächst ja keine Autorität, die „Liturgische Bücher“ herausgegeben oder den Gottesdienst schriftlich festgelegt hätte. Wir haben es mit einer überwiegend mündlichen Tradierung zu tun, die erst allmählich zu einer Verschriftlichung tendierte – z. B. als Reaktion auf bestimmte Auseinandersetzungen.
So ging man lange davon aus, dass der Wortgottesdienst der Messe eine Fortentwicklung aus dem entfalteten Wortgottesdienst der Synagoge war – nur eben unter Hinzunahme der neutestamentlichen Schriften, deren Entstehung von der Mitte des ersten bis mindestens Anfang des zweiten Jahrhunderts reichte. Heute weiß man, dass die jüdischen Quellen, die man dazu heranzog, überhaupt nicht bis in die Zeit des frühen Christentums zurückdatiert werden können – manches darin Fassbare dürfte sich sogar dadurch entwickelt haben, dass sich die Judenheit nach der Tempelzerstörung neu konstituieren musste und dabei von den jungen Christengemeinden abgrenzte.
Sicher lebten Juden wie Christen geistlich zu einem erheblichen Grad aus den Heiligen Schriften, während der Gottesglaube im Christentum durch die Person Jesu Christi eine eigene Gestalt erlangte. Eine These (und weiter als bis zu Thesen gelangt man nicht) für die Entstehung unseres Wortgottesdienstes ist, dass man wie beim Pessachmahl mit der Pessachhaggada, der großen Erzählung vom Auszug Israels aus Ägypten, auch bei den frühen Herrenmählern erzählte und verkündete, was grundlegend für den eigenen Glauben und das aktuelle gottesdienstliche Handeln war. Eine andere Wurzel wäre in den Gebetsgottesdiensten zu sehen, die am Morgen und Abend gehalten wurden und auch Schriftlesungen enthalten konnten, gerade wenn die Gebetsgottesdienste vor dem Sonntag zu Lesegottesdiensten in der Nacht (Vigilien) ausgebaut wurden. Von einer überall gleichen Entwicklung in den verstreuten kleinen Christengemeinden dürfen wir ohnehin nicht ausgehen.
Erstmals greifbar ist ein sonntäglicher Wortgottesdienst in einem Zeugnis des Justin aus der Mitte des zweiten Jahrhunderts. Zu Beginn stand eine Lesung aus den Evangelien oder den „Propheten“, der eine Predigt folgte. Daran schlossen sich Gebet und Fürbitten sowie der Friedensgruß an, um anschließend mit dem Herbeibringen der Gaben in den eucharistischen Teil überzugehen.
In den sogenannten Apostolischen Konstitutionen war bereits die Abfolge: Lesungen – Antwortgesang – Evangelium – Predigt – Allgemeines Gebet (Fürbitten) dokumentiert. Dennoch ist weiterhin von regionalen Unterschieden auszugehen. Im Osten, vor allem in der syrischsprachigen Liturgie, kommt dem Alten Testament mit einer Lesung jeweils aus dem Gesetz (Tora) und den Propheten eine hohe Stellung zu. Darin dürfte sich der noch länger bestehende intensive Kontakt zum Judentum widerspiegeln. Hingegen las man im lateinischen Westen höchstens eine alttestamentliche Lesung, wie wir aus liturgischen Zeugnissen aus Mailand und Nordafrika erfahren.
Überall war gerade am Lesegottesdienst der Messe noch ein anderes Konstitutivum der frühen Liturgie zu erkennen, nämlich eine große gestalterische Freiheit. Denn was konkret aus der Heiligen Schrift gelesen und worüber gepredigt wurde, schien nur an hohen Festtagen festzustehen, ansonsten oblag die Auswahl dem Zelebranten. Zu ausgebildeten Leserordnungen fanden die einzelnen Liturgiefamilien erst später: Im Osten war die erste im Armenischen Lektionar für Jerusalem vom Anfang des 5. Jahrhunderts, im Westen waren Zeugnisse erst im 7./8. Jahrhundert greifbar. Eine solche liturgische Freiheit wurde anscheinend nicht als Willkür aufgefasst, sondern man ging davon aus, dass die für den Gottesdienst zuständigen Amtsinhaber nicht nur das Charisma, sondern auch die Kompetenz besaßen, mit dieser Freiheit sachgemäß umzugehen. Erste Formen von Leseordnungen bestanden aus Bahnlesungen, dem Lesen eines biblischen Buchs über längere Zeit, nicht aber im Herausgreifen einzelner, inhaltlich passender Abschnitte, wie wir dies von späteren Perikopenordnungen kennen.
Beispiel: Die Taufe
Wenn wir die Anfänge christlichen Gottesdienstes betrachten, gilt es, die Taufe besonders in den Blick zu nehmen. Denn es gab keine „tauflose Anfangszeit“; bereits die neutestamentlichen Schriften berichten mehrfach von der Taufe. Hier dürfte weniger das Judentum den Anknüpfungspunkt bilden, das zwar schon im AT rituelle Reinigungsbäder (Lev 11–15, Num 19) kannte, nie aber als Eingliederung in die Glaubensgemeinschaft. Für spätere Zeiten ist die „Proselytentaufe“ bezeugt, wenn Heiden zum Judentum konvertierten; diese kann aber nicht einfach in die Zeit Jesu zurückdatiert werden und beinhaltete auch nicht das Moment der Sündenvergebung. Außerdem war bei Männern immer die Beschneidung der eigentliche Ritus der Aufnahme in die jüdische Glaubensgemeinschaft.
Читать дальше