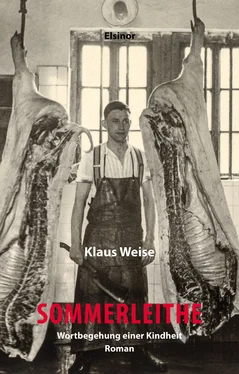Also Rudi; er war der Letzte, der seinen wöchentlichen Lohn bekam. Doch das hatte neben dem Vorteil, am meisten zu verdienen, auch einen nicht zu unterschätzenden Nachteil. Denn er musste, nachdem ein Geselle nach dem anderen vor ihm aus dem Büro getreten war, in den Gesichtern lesen, ob der Chef heute spendabel oder geizig sei. Und das war nicht ganz einfach. Manchmal strahlten die Gesichter, manchmal waren sie betrübt. Oder schienen so. Denn oft machten sich die Gesellen einen Spaß daraus, Rudi, den Vielverdiener und beneideten Cabriolet-Fahrer, auflaufen zu lassen, indem sie die Enttäuschung über den verweigerten Zuschlag auf dem Rückweg in die Küche mit einem Lächeln quittierten oder die Freude über einen zusätzlichen Geldschein mit schlechtgelaunter Miene. Gänzlich überfordert war Rudi, wenn sich im stirnrunzelnden Lächeln eines Kollegen Freude und Enttäuschung zu vermischen schienen. Aus Rache für Rudis schnittiges Cabriolet hatten sich die Gesellen im Lauf der Zeit zu wahren Meistern der mimetischen Verstellung perfektioniert, und wenn es die Arbeit erlaubte, hielten auch Mutti und die Verkäuferinnen sich unter irgendeinem Vorwand in der Küche auf, um dieser Freitagnachmittagskomödie als Publikum beizuwohnen.
Ob die Prämie, wenn es eine gab, unterschiedlich hoch oder bei jedem gleich hoch ausfiel – mit Ausnahme des Lehrjungen natürlich –, blieb das ewige Geheimnis meines Vaters. Er wollte keinen Zank unter den Gesellen, und außerdem, so meinte er, würden sie sich mehr anstrengen, wenn sie nicht wüssten, wie viel genau, mit oder ohne Zuschlag, jeder verdiene.
Wie auch immer. Rudi und sein Augapfel von silbergrünem VW-Cabrio waren versorgt mit frischem Geld für Arbeit und gute Dienste in der alten Woche, und endlich konnte die Fahrt ins Wochenende beginnen. Jedoch kostete es Rudi mehr Zeit, das große Hoftor zu öffnen, den Wagen auf die Straße zu fahren, auszusteigen, das Hoftor von innen zu schließen, durch ein kleines hölzernes Tor auf die Straße zu gelangen, erneut in den Wagen einzusteigen, als, saß er endlich darin, zur Stätte des samstagabendlichen Vergnügens zu fahren. War er dann etwa fünfzehn Sekunden später am Ziel angekommen, parkte er den Wagen möglichst direkt vor dem Eingang, stieg stolz aus, zündete sich eine HB an und schaute sich um, denn er wollte wissen, wer ihn gesehen und bewundert hatte bei seiner Ankunft mit dem im ganzen Stadtteil einzigartigen Schlitten. Manchmal würdigte er auch uns eines Blickes, hob zum Zeichen, dass er uns gesehen hatte, die Hand und verschwand anschließend im Paradiso , dem bunten Karussell der Hormone – die, wie ich erst später erlebte, nach ihrer eigenen Musik tanzen und nicht ausschließlich zum Takt der jeweiligen Musik und der sie intensivierenden Lichteffekte.
Rudi war nun für uns unsichtbar – wie er vermutlich meinte. Doch dies war ein Irrtum. Ein großer Irrtum. Denn er konnte ja nicht wissen, dass wir ihn im bunten und trotz aller Lichteffekte, die die 60er Jahre hergaben, irgendwie hilflos-spießig wirkenden Licht dieser Zeit immer noch beobachteten. Mit dem Fernglas unseres Vaters. Es erlaubte uns Einblicke in eine Welt, die für meine Schwester und ihre Freundin so aufregend wie erregend sein musste. Nicht anders konnte ich die aufsteigende Röte unter der Schminke ihrer Wangen deuten und die Tatsache, dass ich nur selten den Feldstecher benutzen durfte, insbesondere bei langsamer Musik. «Und dein Herz – wie es schlägt, wenn er sagt, dass ihm nichts so gut wie dein Mund gefällt …» Mir erschien diese Welt interessant, aber nicht ganz verständlich. «Doch nimm das alles nur nicht so schwer und denke stets daran: Mit siebzehn fängt das Leben erst an!» Wieso erst mit siebzehn? Lebe ich etwa nicht? Ich verstehe das nicht. Wieso siebzehn? Denn so ein Cabriolet fahren wie Rudi, das darf man erst mit achtzehn!
Im Grunde unverständlich, der Text. So unverständlich wie die schwarzen Haare, die eines Samstagabends aus Monikas leicht gespreizten Beinen zwischen der Innenseite ihres rechten Oberschenkels und dem gepufferten Saum des Babydoll-Höschens herausschauten und mich irgendwie entsetzt und doch fasziniert zurückschauen ließen. So viele schwarze Haare! Woher kamen die? Wo gab es diesen Haarwuchs? Zwischen den Beinen eines Mädchens? Einer jungen Frau? Nein. Monika war kein dem Zoo entlaufenes Affenweibchen, auch wenn sie schielte, denn dann hätte sie ja überall Haare haben müssen. Auch nicht die abnorm behaarte Frau mit langem Bart aus dem Zirkus. Nein, Monika war Monika, ein ganz normales Mädchen. Aber die dunklen Haare zwischen ihren Beinen, so etwas hatte ich noch nie gesehen. Ich musste hinschauen. Ob ich wollte oder nicht. Ich konnte den Blick nicht abwenden. Klar, da unten rum waren dunkle Haare, schwarz bei Vati und braun bei Mutti. Aber doch nicht bei uns, bei uns Kindern. Und als Monika meinen verstört-faszinierten Blick bemerkte – der mich bannte und festhielt wie der gefrorene Metallmast der Straßenlaterne im Winter, den wir als Mutprobe vorsichtig mit der Zungenspitze berührten und an dem wir festklebten und von dem wir uns nur schmerzhaft befreien konnten, indem wir versuchten, ihn mit unserem Atem aufzutauen –, als Monika also diesen Blick bemerkte, spreizte sie die Beine ein wenig weiter auseinander, ganz so, als genieße sie die Überlegenheit, mir etwas zu zeigen und gleichzeitig etwas anderes vor mir verbergen zu können.
Doch damit nicht genug. Sie war stolz darauf und ließ mich das spüren, etwas zwischen ihren Beinen zu haben, wovon ich in meinem Alter, wie sie vermutlich meinte, nur träumen konnte. Aber weder träumte ich davon, noch verspürte ich Lust, davon zu träumen. Im Freibad, wenn wir auf der Wiese lagen, hatte ich schon oft den Mädchen zwischen die Beine geschaut, denn ich wusste, dass da etwas anders sein musste als bei mir. Doch ich konnte das andere nicht sehen; denn es gab nichts zu sehen. Außer dem schmalen Stoffstreifen des Badeanzugs zwischen den Beinen, hinter dem sich unmöglich irgendetwas Großartiges verbergen konnte. Und doch war mir klar, dass auch sie da was haben mussten, nur wusste ich nicht genau, was. Dass etwas fehlte und gleichzeitig etwas anderes da sein sollte, ohne dass man es sehen konnte, blieb ein tiefes, nicht aufzuklärendes Geheimnis. Unter Wasser hatte ich den Mädchen gelegentlich zwischen die Beine gefasst, um herauszufinden, was da wohl sei, denn was man nicht sieht, kann man ja vielleicht fühlen. Aber es gab nichts zu fühlen. Außer dem nassen Stoff des Badeanzugs. So beschloss ich, dass das Ganze – den Mädchen unter Wasser dorthin zu fassen, wo es nichts zu fassen gibt – eine Mutprobe unter uns Jungens war, bei der ich mittat, um vor den anderen nicht als Feigling dazustehen.
Aber so etwas wie bei Monika hatte ich noch nie gesehen, und nie hätte ich vermutet, dass da unten so etwas wachsen könne. Wachstum ist nur möglich, wo die Sonne scheint, und dass bei Monika da unten die Sonne scheinen sollte, das konnte ich mir nicht vorstellen. Andererseits: Auch Champignons wachsen im Dunkeln. Ich war machtlos: Ich konnte den Blick zwischen Monikas Schenkel nicht abwenden – und entdeckte zu spät, dass sie mich längst im Visier hatte. Ich war mir unsicher, ob sie mich, weil ich ja nach links schaute, also dorthin, wo rechts zwischen Haut und Babydoll der schwarze Haarstrunk hervorlugte, also zu der Seite, auf der ihr rechtes Auge nach rechts außen wegschaute, ob sie also mit ihrem gebrochenen Blick wirklich sehen konnte, wohin genau ich schaute, so wie ich mir auch im Unklaren darüber war, ob sie, wenn sie durch den Feldstecher sah, sah, was Renate und ich sahen, oder ob sie mit dem rechten Auge nach außen um die Ecke gucken und etwas meiner Schwester und mir Verborgenes erspähen konnte. Als ich die Augen hob, rannte mein Blick in den ihren, und mir schien, als lächelte Monika und genoss, was sie in mir verursacht hatte und wovon ich, im Gegensatz zu ihr, bestenfalls den Anflug einer Ahnung hatte, die zu benennen mir die Worte fehlten.
Читать дальше