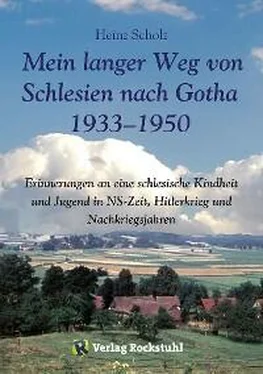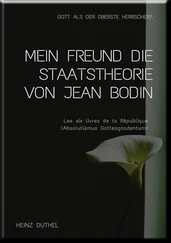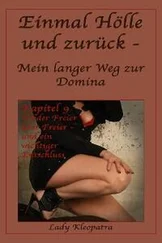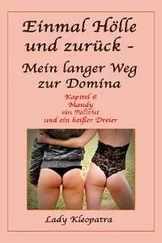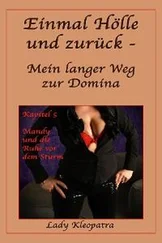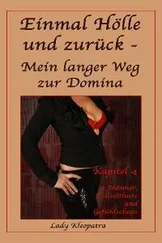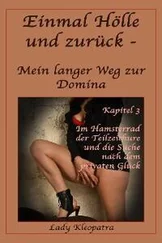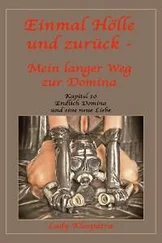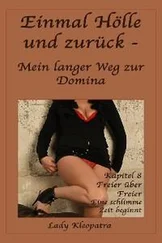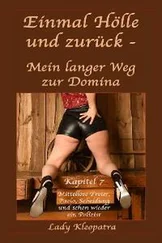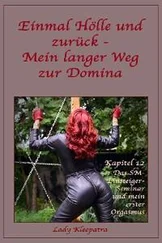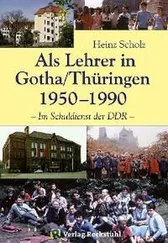Eins hat mir und anderen Mitschülern nicht gefallen: der Spucknapf im Klassenzimmer. Dieser eigens dem Lehrer vorbehaltene Spucknapf, ein schüsselförmiger, weiß emaillierter Napf, stand neben dem dreibeinigen Waschschüsselständer in der Nische hinter dem Lehrmittelschrank. Wenn der Lehrer ihn benutzte und – wie er den Gebrauch vor aller Augen praktizierte, das verursachte mir eine Pein, die sich selbst über jahrelange Gewohnheit nicht mindern ließ. Dann sehe ich noch, wie eines der größeren Mädchen gemäß ihren Aufgaben als Ordnungsdienst den Spucknapf, weit von sich haltend, mit verzogenem, abgewandtem Gesicht, hinaustrug um diesen draußen zu entleeren und zu reinigen.
Und da war noch etwas, was mich gestört hat: Unser Lehrer nannte bzw. rief uns mit unseren Spitznamen. Er war aber nicht konsequent; es traf nicht alle, einige ließ er aus. Andererseits förderte er mit ironischen Kommentaren oder gar Vorschlägen die Erfindung und den Gebrauch von Spitznamen, manchmal unschöner auf das Äußere hinzielender wie z. B. „Muppe“ oder „Schimpanse“. Mich nannte er, wie schon gesagt, in den unteren Schuljahren „Bahner“. Das war seine Erfindung. Später war ich der „große Kiebitz“, dieweil mein jüngerer Bruder Helmut „kleiner Kiebitz“ genannt wurde. Spitznamen können nett sein und freundschaftlich wirken, manche aber können verletzen oder auf Dauer schmerzen. Kaum einer kann sich dagegen wehren. – Ich bin für das Anreden und Rufen mit Vornamen. Wie gesagt: Was ein Lehrer sich gegenüber seinen Zöglingen leisten kann, woran er sich halten darf oder halten muss, das erlaubt ihm die Gesellschaft, oder der Staat schreibt es ihm vor. Zwar lässt sich manches, wenn einer Manns genug ist, auf ein vernünftiges menschliches Maß bringen. Und ich denke, dass sich diesbezüglich auch unser Lehrer ernsthaft seine Gedanken gemacht hat. Er muss wohl, denn er war ja trotz einiger Unarten kein schlechter Lehrer. Ob ihn seine gesellschaftliche Stellung im Dorf und seine Macht auch selbstherrlich werden ließ – ich glaub’ nicht. Immerhin gehörte er zu den wenigen Honoratioren unseres Dorfes, mit ihm der Bürgermeister Robert Förster und der Gutsbesitzer Richard Dunkel, mit denen er sich einmal in der Woche im Dorfgasthaus bei „Hübners“ zum Skat traf. Da wird man sich neben dem Spielgeschäft noch mehr zu sagen gehabt haben: vielleicht das Neueste aus der Gemeinde, aus der Schule, aus Wald und Feld, aus der Politik und gewiss auch aus der nahen Kreisstadt, die der Gutsbesitzer – als einziger Autobesitzer im Dorf – mit seinem „Opel P4“ schnell erreichen konnte. Nein, halt, da war noch einer mit Auto, der Major Freitag, ein Pensionär, der ziemlich abgeschieden in der „Villa“ (die eigentlich gar keine war) am Ortsausgang zur Stadt hin wohnte.
Und das war schon die ganze Prominenz im Dorfe.
Einen Pfarrer im Dorf gab’s nicht, da wir auch keine Kirche hatten. Bis auf wenige Katholiken gehörten alle Bewohner des Dorfes zur evangelischen Kirchgemeinde unserer 3 km entfernten Kreisstadt Löwenberg. Schade, denke ich heute. Ob ein Pfarrer mit Kirche im Dorf bei uns hätte etwas mehr ausrichten können? Auch bei uns Kindern? Gerade in der Hitlerzeit!? So blieb es für uns, für mich, bei dem pflichtgemäßen Konfirmandenunterricht durch Pastor Frenzel oder bei einem langweiligen Vikar in der Kreisstadt. Diese Männer in ihrer schwarzen Kleidung waren weit weg von mir. Sie gaben mir nichts. Sie forderten ein Lernpensum, und alles blieb für mich im luftleeren Raum. Keine dieser Autoritäten, weder Lehrer, Pfarrer noch sonst wer, ist nahe an mich herangekommen. Kinder brauchen Nähe und Zutrauen. Dies zu spüren hätte auch mir sicherlich gut getan.
Was den Bürgermeister betrifft, so sei noch Folgendes gesagt: Er wohnte vier Häuser weiter von uns in seinem kleinen, aber schmucken, mit schönen Blumen garnierten Haus, kinderlos, mit seiner gütigen Frau, er kriegsverletzt und gehbehindert, mit Sachs-Motorrad und bescheidener Kohlenhandlung nebenbei. Uns Jungen war er halb zugetan. Wir durften, wenn wir nicht über die Stränge schlugen, hinter seiner Gartenlaube neben hohen Stauden und Büschen unsere Spielecke einrichten, auch uns mal in seiner Hängematte wiegen. Und als wir schon „größer“ waren, lieh er uns sein Luftgewehr, mit dem wir mittels Bolzen auf eine aufgehängte Scheibe am Scheunentor schießen durften. Er zeigte auf diese Weise Verständnis für uns Jungen. Aber wir merkten, dass er uns irgendwie auch erziehen wollte. So stand er ab und zu frühmorgens vor seiner Haustür, wenn wir an ihm vorbei, ordentlich grüßend, zur Schule gingen, und prüfte uns mit gezieltem Blick. „Deine Schuhe sind wieder nicht richtig geputzt!“ mahnte er streng. Einmal hat er mich zurückgeschickt. Ich bin verschämt heim und hab’ schnell die Schuhbürste aus dem Kasten geholt … . Hier muss ich einflechten: Schuhkontrollen dieser Art waren nur im Winterhalbjahr möglich; im Sommer gingen wir in den frühen Dreißiger Jahren noch barfuß zur Schule oder in Holzpantoffeln.
Unter den Honoratioren, im Kreise seiner Skatbrüder, war unser Otto vielleicht der Gebildetste, wenn man Kenntnisse und Erfahrungen in der Ökonomie absetzt. Andererseits war er wahrscheinlich der Ärmste unter ihnen. So an die 330,—Mark monatlicher Gehaltsüberweisung glaube ich gelesen zu haben, als ich irgendwann für ihn Geld von der Stadtsparkasse holen musste. Seine drei Kinder – die gescheite Tochter studierte, der jüngste Sohn quälte sich auf dem Gymnasium, der erwachsene Älteste war irgendwo – mussten versorgt oder unterstützt werden. Da blieb wohl nicht viel Geld übrig. Der Garten vor und neben dem Schulhaus, den teilweise wir Schüler bearbeiten mussten, brachte Zusätzliches für die Küche der Lehrerfamilie. Die schönen roten Erdbeeren stachen uns Kindern in die Augen. Vor seinen Bienen, die zu etwa 20 Völkern in gestaffelter Reihe auf dem Hang oberhalb des Gemüsegartens ihren festen Stand hatten, mussten wir bei aggressiver Flugzeit, wenn sie „schwärmten“, manchmal Reißaus nehmen. Wer gestochen wurde, durfte sich sofort von der „Frau Lehrer“ behandeln lassen. Es kam durchaus vor, im Sommer, dass die „Frau Lehrer“ plötzlich ins Klassenzimmer hereinplatzte und halblaut aber dringlich dem Manne zurief: „Die Bienen schwärmen!“ Das freute uns, denn darauf folgte stets eine willkommene Unterbrechung des Unterrichts. Der Lehrer musste sogleich hinaus, sehen, wohin sich der Schwarm bewegte, wo er sich niederließ, wie man ihn wieder einfangen könne. Zeigte sich Ungewöhnliches, holte er uns heraus, damit wir draußen beobachten und miterleben konnten, was da an Besonderem passierte. Mit der Zeit kannten wir uns in der Welt der Bienen ganz gut aus. Wenn unser Lehrer sonntags Honig geschleudert hatte, durften wir montags vom Resthonig kosten, der noch an Waben oder Gerätschaften haftete. So bezog er uns ein in seine Bienen- und Gartenwirtschaft, um uns praktisch zu unterweisen, vor allem aber, um uns gleichzeitig als Helfer zu seinem Nutzen zu gebrauchen.
Das alles war für uns Kinder wie für die Erwachsenen im Dorf selbstverständlich. Das durfte der Lehrer! Und warum auch nicht. So begütert war er nicht; und man sagte auch, manche Bauern trügen ihm in der Dunkelheit Geschlachtetes in die Wohnung. Aus Dankbarkeit – oder aus Berechnung? – Wie auch immer, für meine Eltern kam so was auf Grund eigenen Mangels gar nicht in Frage, und ich brauchte das nicht.
Unser Lehrer Otto L. – ich sehe ihn vor mir – er fuhr kein Auto, keine Pferdekutsche wie die besser gestellten Bauern, auch kein Fahrrad wie wir Dreizehnjährigen – er lief zu Fuß! Überall hin, auch wenn es sein musste, in die nah gelegene Kreisstadt, immer mit dem Stock in der Hand, hustend und prustend und eilig drauflos. Zu beliebigen Besorgungen schickte er gelegentlich den einen oder anderen älteren Schüler. Ich erinnere mich, dass ich für ihn auf die Sparkasse im Rathaus gehen und einmal auch einen neuen Rohrstock in der Papierhandlung Hubrig kaufen musste. Ich weiß noch: Der Verkäufer hatte mir den Stock grinsend vor’s Gesicht gehalten und mich gefragt: „Ist das der Richtige?“
Читать дальше