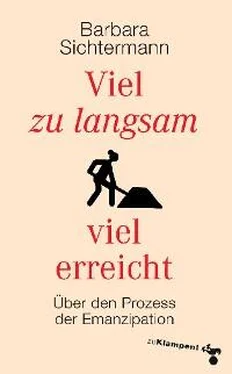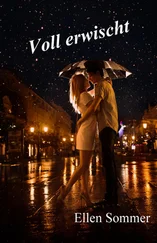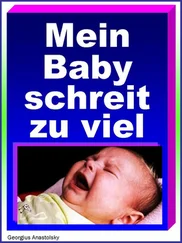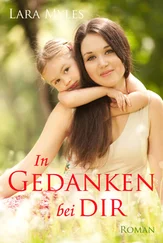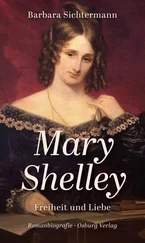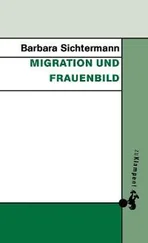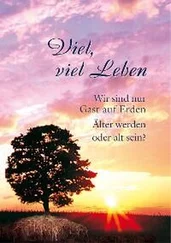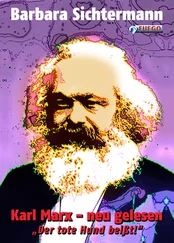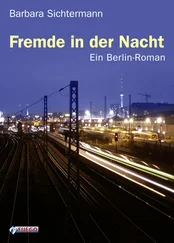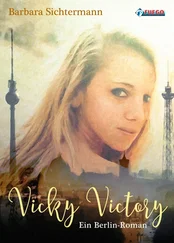Zur Neunzig-zu-zehn-Aufteilung der Räume muss noch gesagt werden, dass der den Frauen zur Verfügung stehende Binnenraum ebenfalls unter der Oberherrschaft ihrer Männer stand. Sie hatten also, genau besehen, nicht einen zehnprozentigen Restraum für sich, sondern gar keinen. Sie lebten quasi zur Untermiete in einem Haus, das den Männern gehörte, auch wenn die fast nie dort waren, und aus dem sie, die Frauen, jederzeit rausgeworfen werden konnten, so bei Untreue oder wenn der Mann ihrer überdrüssig war. Es ist eine Ironie der Wortwahl, dass die »Hausfrau«, die es ja heute noch gibt und die konservative Kräfte in Deutschland als Existenzform gerne aufwerten möchten, dass die Hausfrau das »Haus«, in dem zu leben und zu wirtschaften angeblich ihre Bestimmung oder wenigstens eine erfreuliche Daseinsform sei, nicht einmal besessen hat. Es gab zwar auch begüterte Frauen. Doch das Vermögen einer Frau gehörte nach der Eheschließung von Rechts wegen dem Mann.
Was die Räume betrifft, so kommen wir zu dem ernüchternden Schluss, dass Frauen nicht nur auf den sieben Meeren nicht vorkamen – alter Seemannsspruch: »Frauen und Blumen an Bord bringen Unglück« –, dass sie nicht nur an der territorialen Erschließung unseres Planeten unbeteiligt waren und dass sie die Räume des Wissens nicht mit eingerichtet haben, sondern dass selbst im Nahraum des Hauses, in dem sie ihr Dasein fristeten, auch noch der Mann von Rechts wegen als Bestimmer über ihnen stand. Der »Stichentscheid des Haushaltsvorstandes«, der bei schwierigen Fragen zum Beispiel in Sachen Kindererziehung noch vor einer (!) Generation die Debatte schließen konnte, wurde, historisch gesehen, erst gestern abgeschafft. Ebenfalls zu nennen wäre in diesem Zusammenhang das gern zitierte Verbot, das ein Ehemann über seine Frau verhängen konnte, wenn sie arbeiten gehen wollte und er das nicht gut fand. Auch das eigene Konto einer Frau ist eine junge Errungenschaft. Alles in allem: Die nach der festen Überzeugung vor allem des bürgerlichen Zeitalters »ureigene Sphäre« des weiblichen Wirkens, das Haus, war nie ihre eigene Sphäre. Es war immer ein Herrschaftsbereich der Männer. Für Frauen war es der Ort, an dem sie die Dienstleistungen erbrachten, die für den Sinn ihres Daseins standen.
Die Konsequenzen, die jene Raumfülle für die Männer und die Raumlosigkeit für die Frauen hatte und hat, sind gewaltig. Schauen wir uns noch einmal die Lebenswege der Männer an. Diese Wege führten sie zuweilen in weite Ferne – auch Männer aus dem Volk kamen als Soldaten, als Matrosen und als Handelsreisende weit herum. Auch wenn sie, beispielsweise als Landmann oder als Pastor, im Wesentlichen auf ihrer Scholle oder in ihrem Kirchspiel blieben, hatten sie doch eine gehörige Weltbegegnung, sei es als Verhandler von Geschäftsbedingungen, als Geistlicher auf einem Konzil, als Soldat im Feindesland, als Lehrer vor Buben, als Zimmermann auf dem Bau. Sie trafen dort ihresgleichen, aber auch Vertreter anderer Stände, sie trafen – Männer. Die Einhegung der Frauen im Hause bedeutete ja, dass Männer in ihrem Berufsleben, auf ihren Feldzügen, auf ihren Handelswegen oder in ihren Werkstätten ausschließlich mit anderen Männern verkehrten. Dort, wo die Geschlechtersegregation von alters her besonders konsequent durchgeführt wurde oder wo Männerbündelei den Zugang streng kontrollierte wie beispielsweise in englischen Clubs, beim katholischen Klerus, bei der Armee oder in Geheimbünden wie den Freimaurern, ist das heute noch so: Männer sitzen oder arbeiten zusammen mit anderen Männern, sie verleben den Feierabend mit anderen Männern, sie wetteifern mit anderen Männern, sie kooperieren und sie verschwören sich mit anderen Männern. Sie leben ihr soziales Leben mit Menschen ihres eigenen Geschlechts. Was heißt das für sie?
Es heißt, dass sie einander ziemlich gut kennenlernen. Dass sich ihre libidinösen Energien, soweit solche auch neben den erotischen Zielen und Zwecken in ihren Herzen wohnen, auf Männer richten. Respekt, Ehrfurcht, Sympathie, Anerkennung und Einvernehmen sowie deren Entzug und sodann Beleidigung, Böswilligkeit, Rufmord und Keilerei erleben sie vor allem unter ihresgleichen. Dazu gehört, dass sie es lernen, miteinander auszukommen. Dass sie Person und Sache trennen. Männer können sich als politische oder sportliche Gegner nach Herzenslust attackieren und hinterher miteinander anstoßen. Ihre überlegene Fähigkeit, sich aufeinander zu beziehen, sich nicht nur zu fordern, sondern auch zu fördern, kurz: Seilschaften zu bilden, die einiges aushalten, erwächst aus dieser Geschichte: Männer leben ihr interessantes Leben mit anderen Männern.
Nicht mit Frauen? Nun ja. Zu Hause ist es eher langweilig. Man kennt den Typus Ehemann, der seinen Feierabend lieber in der Kneipe mit den Kollegen verbringt, weil er da mehr Spaß hat. Aber manchmal sind Männer auch zu Hause, und dann freuen sie sich, wenn ihre Frauen sie liebevoll empfangen. Oder sie ärgern sich, wenn das nicht so ist. Allgemein gilt: Männer erlebten früher das andere Geschlecht als das fremde, das ihnen nicht ganz geheuer und das zu beherrschen ihnen aufgegeben war, weshalb sie es gewohnheitsmäßig abwerteten oder aber mystifizierten – das weibliche ist als »das andere« auch das mindere. Diese lange Vorgeschichte der Emanzipation ist noch nicht ganz vergangen. In alten Zeiten haben Männer gerne betont, dass sie die Frauen verehrten, es gab im Hochmittelalter in den höheren Ständen ja sogar die »Verehrung der Frau« als Kunst- und Lebensform. Theodor W. Adorno hat dazu gesagt: »Der Affekt, der zur Praxis der Unterdrückung passt, ist Verachtung, nicht Verehrung«, wodurch er wohl einiges richtiggestellt hat. Ungezählt sind die Mystifizierungen der Frau als die in der Natur tiefer Verhaftete, die Rätselvolle, die Triebhafte, die Sündhafte, das Tier. Solche Zuschreibungen sind Folgen eines Geschlechterrollen-Entwurfs, der keine Räume öffnet für eine nicht-erotische Begegnung der Geschlechter im Medium des Wettbewerbs oder der Kooperation, Räume, die von beiden Geschlechtern gleichermaßen befahren, erobert oder verteidigt oder als Räume des Wissens, der Vorstellung und der Zukunft entworfen und beschrieben werden können. Erst unsere Epoche hat eine solche Begegnung möglich gemacht, dieses Verdienst ist außerordentlich. Denn es erneuert das Fundament für Gleichheit, was die Chancen der Lebensführung betrifft, und es lehrt beide Geschlechter, was es heißt oder heißen könnte, die alte Raumaufteilung nach der Neunzig-zehn-Regel zu suspendieren und Frauen in die großen, weiten Räume der Außenwelt zu entlassen. Es bedeutet, dass mit der Herrschaft des männlichen Geschlechts über das weibliche das Dispositiv »Herrschaft« überhaupt als sozial strukturierendes Modell in die Defensive gerät. Es bedeutet viel mehr , als dass Männer und Frauen aufhören, einander als Agenten einer Hierarchie mit festgelegten Oben-Unten-Strukturen zu begegnen – es bedeutet, dass Herrschaft als soziales Instrument eo ipso fragwürdig wird. Es bedeutet, dass alle Hierarchien in eine Legitimitätskrise geraten.
Dabei hat aber die Herrschaft der Männer über die Frauen zu lange bestanden, um einfach so abgeschüttelt werden zu können, sie hat das Verhalten, die Eigenschaften, die Erwartungen, die Umgangsstile und den individuellen Ausdruck der Menschen derart geprägt und gefärbt, dass ein langer Übergang vonnöten sein wird, bis es selbstverständlich geworden ist, dass die Geschlechter einander auf Augenhöhe begegnen. Ja, man kann sagen: Die Umsetzung der Idee der Gleichheit in Bezug auf die Geschlechter kommt, was die Lebenswirklichkeit betrifft, einer kopernikanischen Wende gleich. Alles muss anders angesehen werden und anders werden, nachdem sich herumgesprochen hat, dass sich nicht die Sonne um die Erde dreht, sondern die Erde um die Sonne … Also: alles muss anders angesehen werden, wenn sich herumgesprochen hat, dass das Verhältnis der Geschlechter kein selbstverständliches Oben-Unten mehr einschließt. Irgendwann wird es womöglich so kommen, Menschen werden einander als Männer und Frauen in all ihrer individuellen Sonderbarkeit gelten lassen, sie müssen sich dann nicht mehr einer über die andere erheben oder eine dem anderen sich unterordnen, sie können nebeneinander mit gleichen Rechten, Aussichten und Chancen, dabei mit ganz verschiedenen Hintergründen, Ansichten und Zielen ihre Wege suchen und gehen. Männer können arbeiten und leben mit und neben Frauen, ohne den Anspruch, es besser zu wissen und die Entscheidungen zu treffen, und Frauen können arbeiten und leben neben Männern, ohne die Bereitschaft, sich zurückzunehmen und bloß zu folgen. Das geht. Es ist jedoch noch nicht so weit. Unsere Arbeitswelt wie auch unsere privaten Lebensräume müssen erst entsprechend umgestaltet werden. Aber die Tradition der obsoleten Raumaufteilung wirkt immer noch mächtig nach. Das wissen Männer, die eine solche Tradition loswerden wollen, genauso gut wie Frauen, die überkommene Verhaltensweisen abgeschüttelt haben. Das ahnen sogar Männer und Frauen, die in altfränkischen Umgangsstilen festsitzen und es trotz besseren Wissens nicht schaffen, sie abzulegen. Sie sind die Verlierer der Emanzipation. Sie müssen uns nicht leidtun. In manchen Weltgegenden rotten sie sich zu einer Art Gegenrevolution zusammen. Es sind inzwischen, da Amerika diesen Weg möglicherweise mitgeht, ziemlich viele. Also: Achtung!
Читать дальше