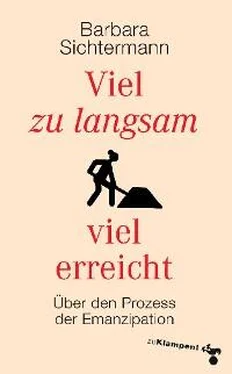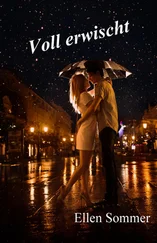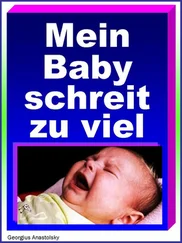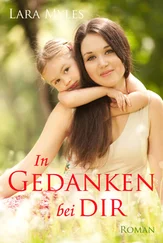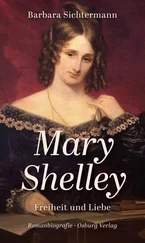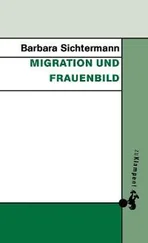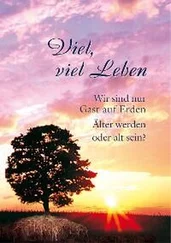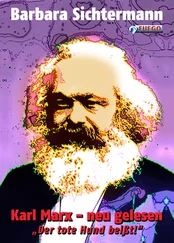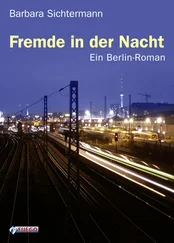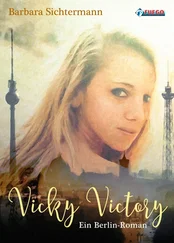Frauen sollten in Innenräumen verbleiben, dort, wo man sie nicht sah und wo sie ihrerseits nichts Neues sehen und erleben konnten. Die raumgreifenden Schritte waren den Männern vorbehalten. Frauen trippelten. In China verwehrte man ihren Füßen durch Einbinden das natürliche Wachstum, sodass sie nur zu Trippelschritten fähig waren. Lassen wir die Schuhmode unserer Zeit beiseite. Die Modi der Verhinderung, mit denen man Frauen in Binnenbereichen hielt und sie vom Erkennen, Beschreiten und Erobern der Außenräume, gedanklicher und gegenständlich-irdischer, abhielt, waren vielfältig. Hier interessieren erst mal Räume im Sinn von Territorien. Schauen wir den Männern zu, wie sie sich die Erde untertan gemacht haben.
Der Welthandel und die Kriegskunst waren die großen Bewährungsfelder, auf denen junge und reife Männer seit der Antike ihre Kräfte und Fähigkeiten entwickelten, einsetzten und aneinander maßen. Es ging immer darum, Räume zu erschließen, zu erobern und zu sichern. Dafür wurden fantastische Leistungen erbracht. Die Schifffahrt in der Antike, der Vorstoß nach Afrika und Asien, schon der Bau der großen Segler und Ruderboote, das waren gewaltige Abenteuer und berauschende Erfahrungen. Von den Seeschlachten mit ihren unermesslichen Opfern an Menschen und Material berichten die Historiker schaudernd. Die Kriege des Mittelalters und der Neuzeit, die Kreuzzüge, die Religionskriege, die Kabinettskriege, die Weltkriege, sie wollten weiterhin Räume besetzen, aneignen, aufteilen, bebauen, sie entfesselten eine sich steigernde Gewalt, sie erschütterten die Menschheit und stifteten sie an zu epochalen Werken in der Theorie, der Philosophie und Dichtkunst, Werke, in denen man darum rang, die eigene menschliche Natur und ihr schöpferisches Vermögen ebenso wie ihren Zerstörungsdrang zu verstehen und Werte zu entwickeln, an denen gemessen das menschliche Zusammenleben stabiler werden könne. Derweil bearbeitete auch das zivile Leben mit Landwirtschaft, Handwerk und Städtebau die irdischen Räume. Es gab ferner die Epoche der großen Entdeckungen: Auf dem Seeweg nach Indien stieß man auf Amerika, und so ging es weiter, bis die Umrisse der Pole und der letzten unbekannten Inseln die Landkarte der Erde vervollkommneten. Sie ist ein grandioses Epos, die Eroberung, Besetzung, Aufteilung und Nutzung des irdischen Raumes.
Und sie ist eine Erzählung ganz ohne weibliche Autoren. Abgesehen von der Kleinlandwirtschaft, in der Frauen tätig waren, soweit der Zustand ihrer Füße es ihnen erlaubte, waren sie an der Aneignung des Raumes, so wie er die Menschheitsgeschichte bis ins vorletzte Jahrhundert hinein geprägt hat, nicht beteiligt. Was bedeutet das für ihre Psychen, für ihr Selbstbewusstsein, für ihr Tun und Lassen? Und was hat ihre Rolle als Entdecker und Krieger aus den Männern gemacht? Die Tatsache, dass die großen Feldzüge, Erkundungszüge, Eroberungszüge, Welthandelskompanien und Städtebauarbeiten eine rein männliche Angelegenheit waren, muss etwas heißen für die Entwicklung der Geschlechter. Man befindet heute, dass weibliche Gehirne in Bezug auf räumliches Vorstellungsvermögen deutlich weniger leistungsfähig seien als männliche. Zur Erklärung verweist man auf den unterschiedlichen Zustand neuronaler Vernetzungen. Ein Blick in die Geschichte lehrt, woher dieser Unterschied stammt.
Junge Männer mussten, um Schiffbauer oder Soldat zu werden, eine Ausbildung auf einer Werft oder als Rekrut bei der Truppe machen – beides war Frauen verwehrt. Es gab für sie bis ins 19. Jahrhundert hinein nicht einmal Schulen und auch dann erst mal nur Schrumpfformen jener Institute, an denen die männliche Jugend lernte und studierte. Das war überall auf der Welt so. Das vor-aufgeklärte Weltbild mit den ihm entsprechenden Geschlechterrollen kannte keine Frauen, die eine Ausbildung gemacht oder studiert hätten, um Expertenwissen zu erwerben und einen Beruf auszuüben (von raren Ausnahmen abgesehen). Der Sinn eines Frauenlebens bestand in seinem Dienst an der männlichen Menschheit. Weibliche Menschen sollten Kinder auf die Welt bringen und großziehen, um so das Geschlecht des Mannes fortzupflanzen, und sie sollten hausnahe Tätigkeiten ausführen, etwa gärtnern, spinnen, brauen, backen, kochen und das Kleinvieh versorgen. Kenntnisse, die dafür nützlich waren, durften sie sich aneignen. In den Oberschichten gehörten Musik, Tanz und Lyrik dazu, während Spinnen und Backen weniger galten, dies wurde von Mägden erledigt. Jede weitere Bildung aber war überflüssig und wurde gar für schädlich befunden. Irgendwann aber tat sich der Raum des Wissens auch für Frauen auf. Nicht einfach so, sondern weil Frauen ihn unter Missachtung ihrer beschränkten Zukunftsaussichten ertrotzten.
Zum Beispiel in Zürich in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Universität dort war eine junge Gründung, und die weitblickenden Herren, die ihr Lehrprogramm ausarbeiteten, spürten, dass etwas in der Luft lag: der Wunsch junger Frauen aus besseren Kreisen, mehr über die Welt zu wissen als Geburtshilfe und Kochrezepte. Das Kalkül ging auf. Aus vielen europäischen Ländern kamen höhere Töchter in die Schweiz, um dort ihren Wissensdurst zu stillen. Sie beziehungsweise ihre Familien zahlten bereitwillig die saftigen Gebühren. Niemand traute den Mädchen viel zu, weder ihre Eltern noch die Professoren, erst recht nicht die Kommilitonen. Studentinnen wurden regelrecht gemobbt. Aber sie setzten sich durch und die akademische Welt in Erstaunen. Franziska Tiburtius, Anita Augspurg, Ricarda Huch und Rosa Luxemburg gehörten damals zu ihnen. Jetzt war Wut gerechtfertigt, wenn es weitere Hemmnisse gab, die Frauen den Eintritt in die Räume des Wissens verwehrten. Die akademische Welt, in der die Männer so lange unter sich gewesen waren, hielt mächtig gegen die Aspirationen der Frauen. Man betrachtete ihre Studien als eine Art Accessoire, als Zusatzqualifikation für den Small Talk im Salon, den eine kluge Ehefrau an der Seite eines Mannes von Stand führen könnte. Einen akademischen Abschluss brauchten sie dafür nicht, also wurde er verweigert. Dann, als das nicht mehr ging – die Gleichheit als politische Kategorie drängte mit Macht in die Praxis –, verbot man ihnen eine Karriere als Ärztin, Professorin, Anwältin oder Pfarrerin. Sie durften sich, weil sie Frauen waren, nicht niederlassen oder eine Approbation erwerben. Bis sie es dann endlich doch konnten, mussten viele weitere Kämpfe durchgefochten werden.
Warum leisteten Männer in der großen Mehrheit einen solch rigorosen Widerstand, als erstmals Frauen in die akademischen Räume vorstießen? Es hat zu tun mit Weltbildern, die gelten sollten. Die Aufteilung der Geschlechter auf die Räume des Lebens, auf Territorien wie auch auf die Räume des Wissens mit ihren historischen Schätzen und möglichen Neuerungen war tradiert worden und hatte in den Vorstellungen der Menschen eine die Lebenswege vorzeichnende Tiefenwirkung. Für eine Frau war es wichtig, dass sie einen Mann fand, der ihr seinen Namen gab, dessen Kinder sie zur Welt bringen würde und der ihr dafür seinen Schutz und eine begrenzte Teilhabe an seinem Vermögen angedeihen ließ. Alles andere zählte nicht. Für einen Mann war es wichtig, dass er seine Fähigkeiten entwickelte und ein würdiger Nachfolger seines Vaters als Bauer, Hufschmied, Gelehrter oder Aristokrat wurde. Ob und wann er eine Frau fände, mit der er sein häusliches und Gattungsleben führen könnte, war vergleichsweise weniger wichtig. In diesem Weltbild mit dem entsprechenden Verhältnis der Geschlechter gehörte die Erde den Männern, die sie sich, wie Gott es gewollt hatte, untertan und urbar machten. Frauen waren von dieser Weltaneignung ausgeschlossen, sie lebten in Innenräumen und betraten die Außenwelt nur insoweit, als ihr männlicher Vormund es gestattete.
Eine Frau, die studieren ging, rüttelte an diesem Weltbild. Eine Jurastudentin, die Richterin werden wollte, machte die Aufteilung von Räumen, die schätzungsweise auf neunzig zu zehn hinauslief – wobei der Löwenanteil von neunzig den Männern und die Restgröße von zehn den Frauen zukam –, zunichte. Das durfte nicht sein. Die Macht der Tradition liegt in ihrem Ewigkeitsanspruch. Sie will immer weiter gelten. Die Männer, die in Zürich und anderswo während der 1860er bis 1890er Jahre verbissen gegen Studentinnen der Rechte, der Theologie, der Medizin oder der schönen Künste kämpften und ihr Weltbild mit der Neunzig-zu-zehn-Aufteilung der Räume verteidigten, sahen sich nicht als Frauenfeinde oder -verächter, und sie waren es subjektiv auch nicht. Sie wollten den Frauen ihre Komfortzone erhalten: Die sollten mal schön bei Mann und Kindern zu Hause bleiben, anstatt sich den rauen Wettern der Wissenschaften, der Juristerei, der Heilkunst oder den Streitereien der verschiedenen philosophischen Schulen auszusetzen. Natürlich waren so gut wie alle Männer davon überzeugt, dass Frauen für die Wissenschaften ungeeignet seien. Sie erfanden die bizarrsten Indizien, angefangen bei der weiblichen Kopfform bis hin zur angeborenen Scham (eine Frau in der Anatomie – nicht auszudenken!), mit denen sie belegen zu können glaubten, dass eine Frau nicht in die Universität gehöre. Es gab strenge Verbote. Aber Zürich wies dann doch den Weg. Und Frauen beschritten ihn, nachdem die Schranken gefallen waren, in großer Zahl. Heute lacht man über die Vorwände, unter denen man einst weibliche Studienanfänger draußen vor der Tür der Alma Mater gehalten hat. Damals war es nicht zum Lachen, weder für die Frauen, die als erste raumgreifende Schritte ins Reich des Wissens machten, noch für die Männer, die sie aufhalten wollten. Für beide ging es um ein Weltbild. Die einen wollten es erhalten, die anderen es umstoßen.
Читать дальше