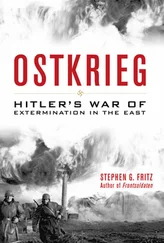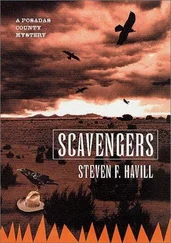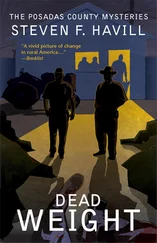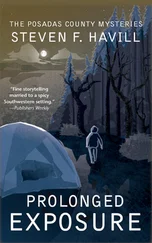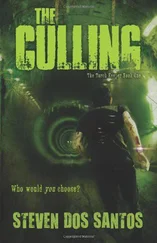Aber stimmt das wirklich?
Behalten Sie diesen Gedanken einmal kurz im Kopf.
Ich habe eine – zugegebenermaßen ziemlich seltsame – Phobie.
Ich habe Angst, Leute, die ein Baby erwarten, zu fragen, wie ihr Nachwuchs heißen soll. Woran das liegt? Ich glaube daran, dass – wie sage ich das jetzt am besten? – die Menschen immer „kreativer“ werden bei der Namensgebung.
Natürlich ist es das gute Recht von Eltern, ihren Kindern genau den Namen zu geben, den sie für richtig halten, das ist mir schon klar. Der Grund, weshalb ich nicht fragen mag, ist der Umstand, dass ich einfach nicht in der Lage bin, mich bei der Reaktion auf ihre Antwort zu verstellen.
Wenn ich frage: „Und, wie soll es denn heißen?“, und sie nennen einen Namen, für den ihr Kind spätestens in der Mittelstufe gemobbt werden wird, dann reagiere ich mit großer Wahrscheinlichkeit mit einem erstaunten: „Aha …“, und das ist in aller Regel nicht die Reaktion, die sich werdende Eltern wünschen. Deshalb stelle ich die Frage einfach nicht mehr. Es hängt einfach zu viel Verantwortung daran. Ich erfahre den Namen lieber schriftlich, wenn niemand dabei ist und ich reagieren kann, ohne die Gefühle von jemandem zu verletzen.
Nur fürs Protokoll: Mein erster Vorname ist gar nicht Steven, sondern Larry. Mein korrekter, offizieller Name ist also Larry Stevens Furtick Jr. Dass ich mit zweitem Vornamen Steven heiße, liegt daran, dass der zweite Vorname meines Vaters auf seiner Geburtsurkunde falsch geschrieben war. Statt das zu ändern, hat der Gute den Fehler bei der Beurkundung meiner Geburt einfach übernommen. Vielen Dank auch, Dad.
Es hätte aber auch noch schlimmer kommen können, denn ursprünglich wollte mein Vater mich Clem nennen, und schon allein der Gedanke daran lässt mich schaudern. Meine Großmutter hat nämlich an der Clemson University in South Carolina ihren Abschluss gemacht, und mein Vater fand es unglaublich geistreich, mich später einmal „Clem! Son! Komm mal her, Clem, Son!“ rufen zu können.
Zum Glück konnte meine Mutter diesen Wahnsinn gerade noch rechtzeitig verhindern.
Aber es gibt noch schlimmere Namen. Vor kurzem hat mir ein Mitarbeiter aus der Gemeinde von jemandem erzählt, der sein Kind La-a genannt hat. (Das wird genau so ausgesprochen, wie man es schreibt.)
Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für Gedanken mir durch den Kopf gingen, als ich das hörte. Du tust mir so leid, La-a, wo auch immer du gerade bist. Wir beten für dich. Ganz besonders beten wir dafür, dass die Engel deinen Namen richtig buchstabieren, wenn sie ihn ins Buch des Lebens schreiben.
Zum Glück für die Clems und La-as dieser Welt werden wir zwar mit unserem Namen gerufen, aber unser Name bestimmt nicht, wer wir sind. Er beschreibt nicht unsere Persönlichkeit. Unser Name sagt nichts darüber aus, wer wir wirklich sind, nichts über unsere Träume, unsere Gefühle, unser Potenzial und das, wofür wir uns begeistern.
Ich glaube, die meisten Menschen wissen, dass sie mehr sind als ihr Name, aber wie viel Mühe setzen wir ein, um herauszufinden und zu verstehen, was uns antreibt und wovon wir uns bestimmen lassen?
Wenn wir eine verzerrte Wahrnehmung davon haben, wer wir wirklich sind, dann leidet unser seelisches Gleichgewicht darunter, und deshalb tut es auch so weh, wenn wir scheitern oder hinter den Erwartungen zurückbleiben. Unsere Defizite scheinen der Beweis dafür zu sein, dass wir von Grund auf fehlerhaft sind, und das lässt uns an unserem Wert und unserer Identität zweifeln.
Aber wie ich ja bereits im vergangenen Kapitel festgestellt habe, sieht Gott uns nicht so, wie wir selbst uns sehen. Sein Maßstab und seine Beurteilungskriterien sind anders als unsere, doch solange wir nicht wissen, wie er denkt und uns sieht, werden wir unsere Erfolge und Niederlagen als einzige Indikatoren für unseren Wert betrachten. Das wiederum führt unweigerlich zu übertriebenen, immer wieder anderen Schlussfolgerungen darüber, ob wir fähig und qualifiziert sind oder nicht. Und eine Identität, die auf Gefühlen der Unzulänglichkeit beruht, ist etwas ziemlich Gefährliches.
Ich möchte, dass wir uns im Folgenden einmal selbst anschauen in Bezug auf unsere Identität, und, was vielleicht noch wichtiger ist, ich möchte, dass wir uns mit unserer eigenen Interpretation unserer Identität beschäftigen. Wissen wir eigentlich, wer wir wirklich sind? Und stimmt unser Bild von uns selbst mit dem überein, was Gott darüber sagt, wer wir sind? Und was tun wir, wenn die beiden Vorstellungen nicht übereinstimmen? Wie gehen wir mit der Diskrepanz um?
Das ist kompliziert, weil wir kompliziert sind, aber zum Glück sieht die Bibel diese Komplikationen voraus.
Vor fast viertausend Jahren berief Gott aus einem brennenden Dornbusch heraus einen Mann namens Mose. Die Geschichte ist im 2. Mose Kapitel 3 nachzulesen, und wenn Sie schon länger mit Glauben und Kirche zu tun haben, dann haben Sie sie bestimmt schon einmal gehört. Hier noch einmal kurz die Geschichte, gewürzt mit ein paar Details, die meiner Phantasie entsprungen sind.
Gott trifft Mose mitten in der Wüste und präsentiert ihm einen umwerfenden Plan. Er will, dass Mose nach Ägypten – die damals mächtigste Nation der Welt – geht und den Pharao dort auffordert, die Millionen israelitischen Sklaven freizulassen, die für ihn arbeiten. Das verschlägt Mose wirklich die Sprache, allerdings nicht im positiven Sinn. Schon allein bei der Vorstellung fängt er an zu schwitzen und zu stottern und zu hyperventilieren.
Also fragt Mose Gott erst einmal, wie er denn überhaupt heißt, in dem verzweifelten Versuch, irgendetwas zu finden, das ihm dabei helfen könnte, den Israeliten diesen unglaublichen Plan plausibel zu machen.
Instinktiv ist Mose klar, dass das Allerwichtigste in diesem Moment die Frage ist, mit wem er es hier überhaupt zu tun hat. Wer da aus dem brennenden Busch heraus zu ihm spricht, ist viel wichtiger als seine eigenen Fähigkeiten, sein Bildungsstand und sein Lebenslauf und auch wichtiger als die Macht des Pharaos oder die Politik, die Ägypten verfolgt, oder wie er es anstellen soll, von jetzt auf gleich ein Gegner der Sklaverei zu werden.
Und Gott ist bereit, Mose zu sagen, wer er ist, und ihm seinen Namen zu nennen.
„Mose, mein Name ist … Der Ich bin.“
Es folgt eine lange, unbehagliche Pause, in der sich Mose vorbeugt und lauscht, ob der Busch sein Geheimnis preisgibt: Sprich weiter, ich höre zu. Du bist … was? Ja, wer denn nun? … Moment … ist das etwa alles? Einfach nur „Der ich bin“? Da fehlt doch was.
Aber mehr sagt Gott nicht. Dafür, dass er ein vollkommener Gott ist, hat er offenbar eklatante Probleme mit der Grammatik. Weiß er denn nicht, dass da noch ein Nomen kommen muss, weil sonst die Aussage unvollständig ist?
Vielleicht ist in dieser Aussage eine Botschaft für Mose – und für uns alle – enthalten: nicht das Ich bin einfach überspringen. Füllen Sie nicht leichtfertig in die Lücke ein, wer Sie sind.
Denken Sie einmal über diese beiden Worte nach: Ich bin. Nur zwei kleine Silben, aber die stärkste, ja, umwälzendste Aussage, die man machen kann. Darin steckt eine Kraft, die von der Vergangenheit befreien, durch die Gegenwart lotsen und den Rahmen für die Zukunft stecken kann.
Ich bin hier nicht irgendwie mystisch, sondern es handelt sich um etwas sehr Konkretes und Praktisches. Gott hat genau diesen Ausdruck gewählt, um sich selbst präzise zu beschreiben, weil Identität und Selbstbild grundlegende Lebensprinzipien sind. Das ist ein ganz wesentlicher und großer Aspekt der „Ich bin“ -Offenbarung Mose gegenüber.
Dennoch braucht der Name Gottes kein weiteres Wort, weil Gott alles und jeder ist, was er im Moment gerade sein muss. Er ist die Fülle, er ist die Vollendung, er ist die Erfüllung jedes Bedürfnisses und jedes nur denkbaren Verlangens. Man könnte beliebig Superlative aneinanderreihen und würde damit Gott nicht einmal annähernd gerecht, aber Sie und ich, wir Menschen, wir brauchen noch ein weiteres, ein drittes Wort. Wir müssen unsere Identität an konkreten, greifbaren und beschreibenden Begriffen festmachen. Wir müssen die Aussage vervollständigen, und das tun wir auch ständig, ob es uns bewusst ist oder nicht.
Читать дальше