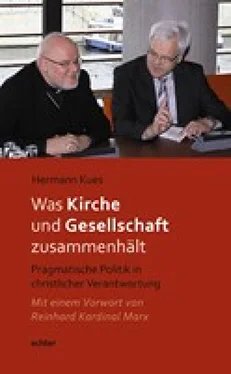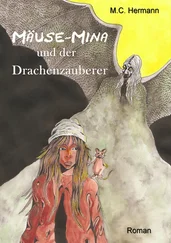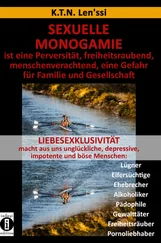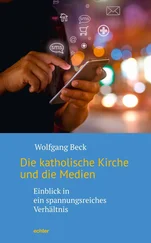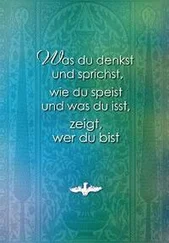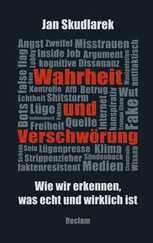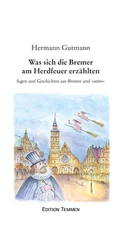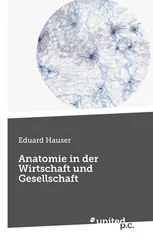Wertorientierte Familienpolitik sollte deshalb ‚asketisch‘ sein. Sie tut gut daran, nicht dem einen oder anderen Lebensmodell den Vorrang zu geben, sondern die Wahlfreiheit ganz oben anzusetzen. Sie hat schon eine Menge erreicht, wenn sie Chancen eröffnet und junge Leute dazu ermutigt, sich für Partnerschaft und Familie zu entscheiden. Wie sie die dann ausgestalten, sollte ihre eigene Sache sein. „Wir werden es“, haben CDU und CSU 2009 als ihr Leitziel formuliert, „Familien leichter machen, so zu leben, wie sie es selbst wollen.“ Anders gesagt: Der Staat hat den Menschen nicht vorzuschreiben, wie sie leben sollen, sondern muss ihnen helfen, dass sie so leben können, wie sie wollen.
In dem Zusammenhang – und wenn man sich nach den tatsächlich gelebten Werten fragt – ist das Votum der Kinder ganz interessant. Der Kinderwerte-Monitor 2010 weist nämlich aus, dass die Kinder selbst der Berufstätigkeit ihrer Mütter und Väter durchweg positiv gegenüberstehen. Sie sehen die damit verbundene finanzielle und materielle Sicherheit, traurig sind sie allerdings über Zeitstress und Ungeduld der Eltern als Schattenseite der doppelten Belastung. Ein deutliches Defizit: Die Väter haben immer noch zu wenig Zeit für ihre Kinder. Aus Sicht der Kinder nehmen sich Mütter unter der Woche zu 80 Prozent viel Zeit, die Väter fallen mit 44 Prozent weit ab (vgl. Familienreport 2011,55).
Jenseits der Grundsatzdiskussionen um das ‚richtige‘ Familienmodell stellt sich die Zeitgestaltung als das zentrale Problem unserer Familien heraus. Zeit, so hat Bundesfamilienministerin Kristina Schröder prägnant formuliert, ist die „Leitwährung der Familienpolitik“. Der aktuelle Achte Familienbericht der Bundesregierung zeigt an vielen Beispielen, wie vertrackt die Situation sich immer noch darstellt: Teilzeitbeschäftigte Mütter würden gern länger arbeiten, finden aber keine passenden Arbeitszeitmodelle. Väter würden im Gegenzug gern reduzieren, arbeiten aber in Betrieben, die keine Teilzeitstellen anbieten. Zeitstress entsteht, weil Behörden geschlossen sind, wenn Eltern von der Arbeit kommen. 14 Wochen Schulferien bedeuten für viele Eltern ein Riesenproblem, würden da nicht die Großeltern einspringen. Gefragt sind familiengerechte Arbeitsplätze und nicht arbeitsplatzgerechte Familien.
Ein Reizthema ist der Ausbau der frühkindlichen Bildung und Betreuung geblieben. Die Katholische Kirche betont den Primat der Elternverantwortung, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken meint, die Kindertagesbetreuung könne „Erziehung und Bildung in der Familie jedoch sinnvoll ergänzen“ (ZdK 2008,23). Auch Franz-Xaver Kaufmann (2006) hat ins Feld geführt, dass Kinder in der Regel in den ersten zwei Lebensjahren am besten in der Familie aufgehoben sind.
Auf der anderen Seite: Jedes dritte Kind unter sechs Jahren hat eine Zuwanderungsgeschichte. Viele von ihnen benötigen Unterstützung, beispielsweise beim Erlernen der deutschen Sprache. 1,7 Mio. Kinder beziehen Hartz IV – in einigen Großstädten ist das jedes dritte Kind. Bildung kann der Vererbung der Armut entgegenwirken. Manche Eltern haben erhebliche Schwierigkeiten in der Erziehung. Und was nicht vernachlässigt werden darf: Kindern tut Gemeinschaft gut. Die klassischen Großfamilien oder nachbarschaftliche Spielgruppen werden weniger. Geschwister sind selten geworden.
Wir sollten deshalb die Spitzen aus der Diskussion nehmen. Wichtig ist aus meiner Sicht: In Kindertagesstätten geht es nicht um Betreuung, sondern um Förderung. Wer die Potenziale von Bildung in dieser Lebensphase unterschätzt, verbaut den Kindern ihre Chancen. Was hier versäumt wird, lässt sich später schwer nachholen. Nie wieder lernen Menschen im Lebenslauf so leicht, geradezu spielerisch, kann ihre Entdeckungsfreude kaum befriedigt werden, sind sie für alle möglichen Lernanregungen dankbar.
Oft wird in der Debatte angeführt, Kindertagesstätten seien mit diesen Aufgaben überfordert. Sie sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sichern, Versäumnisse familiärer Erziehung ausgleichen und die Kinder fit fürs Leben machen. Das sind tatsächlich hohe Anforderungen. Doch man tut den Erzieherinnen unrecht, wenn man ihnen nicht zutraut, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Ihr Beruf muss aufgewertet, ihre Professionalität erhöht werden. Es braucht sicher transparente Qualitätsstandards und entsprechende Fortbildungsmöglichkeiten, vielleicht sogar eine Akademisierung der Ausbildung. Mein allgemeiner Eindruck ist aber, dass der Bereich der frühkindlichen Bildung sich schon heute durch viel Kreativität und Engagement des Personals auszeichnet. Das wird mir bei Besuchen in Kindertagesstätten immer wieder bestätigt und zeigt sich auch in Umfragen unter Eltern.
Frühkindliche Förderung ohne Beteiligung der Eltern läuft ins Leere. Es muss ein Miteinander im Sinne einer echten Erziehungspartnerschaft geben. Erste Bildungseinrichtung bleibt die Familie. Kindertagesstätten haben geradezu ideale Möglichkeiten, gerade die Eltern anzusprechen, die sich sonst Angeboten von außen verschließen.
Ob man nun die frühkindliche Förderung oder das heftig umstrittene Betreuungsgeld, die Präimplantationsdiagnostik oder die Sonntagskultur, die Auslandseinsätze der Bundeswehr oder die Familienzeitpolitik debattiert – bei all diesen Themen sind explizit christliche Positionen gefragt. Sie bereichern unsere politische Kultur, aber sie sind nicht per se richtungweisend. Die Kirchen und ihre Vertreter müssen durch die besseren Argumente eine Gesellschaft überzeugen, die erst einmal skeptisch ist. Völlig neu ist diese Situation nicht. Die besten Vertreter christlich orientierter Politik haben sie erlebt und sich als Partner im gesellschaftlichen Dialog positioniert. Von ihnen bedeuten mir Ludwig Windthorst, Joseph Höffner und Werner Remmers besonders viel. Alle drei haben den politischen Streit nicht gescheut, sind oft angeeckt, mussten Spannungen aushalten und sind dabei nie verzweifelt, im Gegenteil: Man behält sie als gescheite und humorvolle, eben gelassene Menschen im Gedächtnis. An ihnen kann man ablesen, dass der Glaube tatsächlich politisch ist. Dazu mehr im folgenden Kapitel.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.