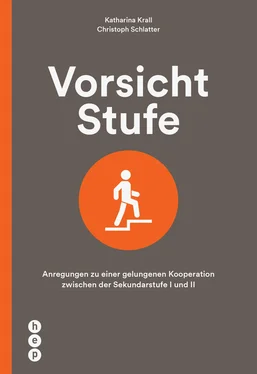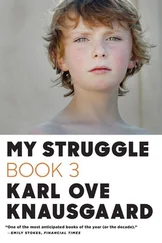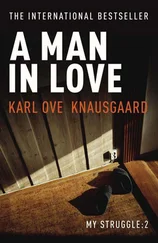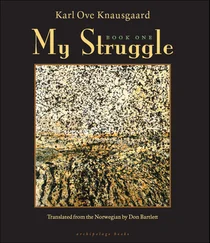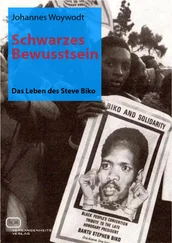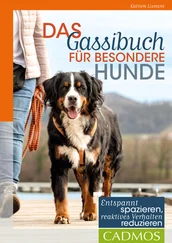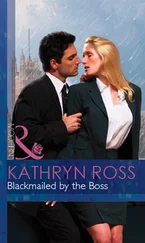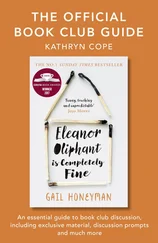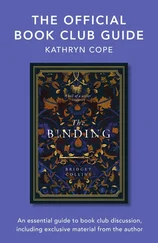1.2.3Wo liegen die Probleme? Ein Erklärungsversuch
Oftmals liegen zwischen den beiden Stufen die Sommerferien. Das Ende der Sekundarstufe I markiert auch das Ende der obligatorischen Schulzeit. Der Einstieg in die Berufswelt mit einer Berufsausbildung beginnt für viele Jugendliche unmittelbar nach der Sommerpause.
Dadurch, dass sich die Lernenden oftmals vorwiegend ein Bild über den berufspraktischen Teil der dualen Ausbildung verschafft haben – insbesondere durch Absolvierung einer Schnupperlehre oder eines Praktikums –, kommt es zur Problematik, dass die Lernenden zwar auf den praktischen Teil der Berufsbildung vorbereitet sind, nicht aber auf die Berufsfachschule. Die Berufsfachschule als Lernort wird bei den Vorbereitungen auf die Sekundarstufe II oftmals ausgeblendet. Dadurch verfügen viele Jugendliche über eine mangelhafte Vorstellung darüber, mit welchen Themen sie am Lernort Berufsfachschule konfrontiert werden. Darunter verstehen wir nicht nur die Inhalte der Bildungsverordnung, sondern auch die Unterschiede zwischen den bisherigen Rahmenbedingungen während der obligatorischen Schulzeit und den Bedingungen an einer Berufsfachschule. Dies führt dazu, dass sie entsprechend viel Zeit aufwenden müssen, den Übergang an dieser Schnittstelle zu bewerkstelligen. Dies wirkt sich wiederum auch auf den Lernort Schule aus.
Wir vertreten die Ansicht, und werden an anderer Stelle noch präziser darauf eingehen, dass die Berufsfachschulen bei der Unterstützung der Berufslernenden an der Schnittstelle den Fokus primär auf den fachlichen Bereich (Lerninhalte) legen. Wir möchten an dieser Stelle nicht missverstanden werden. Die Fokussierung auf die inhaltlichen Voraussetzungen der Betroffenen ist eminent wichtig und sollte auch beibehalten werden. Ja, die verschiedenen Massnahmen und Instrumente zur Früherfassung helfen dabei, die Jugendlichen adäquat zu unterstützen. Bei der Früherfassung geht es darum, herauszufinden, über welche Voraussetzungen die Lernenden bereits verfügen, um den gewählten Beruf erfolgreich zu erlernen (vgl. Grassi 2016, S. 50–62). Dabei verfügen die meisten Berufslernenden über die Fähigkeiten und Ressourcen, ohne zusätzliche unterstützende Massnahmen den gewählten Beruf zu erlernen. Ein Teil der Berufslernenden benötigt zusätzliche begleitende Massnahmen, die zu einem erfolgreichen Lehrabschluss führen. Diese Massnahmen sollten gemeinsam im Rahmen der Lernortkooperation erfolgen. Die letzte Gruppe erfüllt die Voraussetzungen für den Erwerb des gewählten Berufs nicht. Die Gründe dafür sind mannigfaltig und lassen sich oftmals nicht monokausal erklären.
Neben den schulischen Voraussetzungen kommen sprachliche und soziokulturelle Aspekte hinzu. Manchmal liegt es an der mangelnden intrinsischen Motivation, weil der gewählte Beruf nicht der Wunschausbildung entspricht oder eine Unter- oder Überforderung im Zentrum steht. Bei der Früherfassung sollten daher in Zukunft auch Aspekte berücksichtigt werden, die über theoretische Komponenten wie Deutsch und Mathematik hinausgehen. Der Lernort Berufsfachschule leistet zwar bereits einen wichtigen Beitrag, wenn es darum geht, die Berufslernenden an der Schnittstelle zur Berufsausbildung inhaltlich abzuholen und zu unterstützen. Wir vertreten aber die Ansicht, dass es noch weiterer Anstrengungen bedarf, damit der Übergang in die Berufsfachschule optimiert werden kann.
1.2.4Schwellen verleiten zum Stolpern
Wenn wir über eine Schwelle oder ein Hindernis schreiten, machen wir in der Regel Personen, die hinter uns gehen, darauf aufmerksam, damit sie behutsam weitergehen. Weshalb sollte dieses Prinzip an der Schwelle zum Übergang von der obligatorischen Schule zur Berufsfachschule seine Gültigkeit verlieren? Unserer Ansicht nach wird noch zu wenig unternommen, um die Berufslernenden auf Rahmenbedingungen an den Berufsfachschulen vorzubereiten. Zu diesen Rahmenbedingungen gehören für uns unter anderem:
•Schulstruktur
•Fächerkanon
•Schulkultur
•Verbindlichkeit
•Disziplinarwesen
•Absenzenwesen
Aus Sicht der mit den Abläufen einer Berufsfachschule vertrauten Akteure mag diese Auflistung trivial erscheinen. Hingegen können diese Rahmenbedingungen aus der Perspektive von Berufslernenden, die sich erstmals an einer Berufsfachschule zurechtfinden müssen, bereits eine Herausforderung darstellen. Diese Erfahrung haben wir jedenfalls bei den Versuchen mit unserem Konzept «Schnuppertage an der Berufsfachschule» gemacht.
Für die Jugendlichen ist der Eintritt in die Berufsfachschule mit verschiedenen Stolperfallen verbunden. Es stellt sich natürlich die berechtigte Frage, inwieweit es die Aufgabe der Berufsfachschulen ist, die Berufslernenden vor diesen Stolperfallen zu bewahren. Wie der Einstieg ins Erwachsenenalter birgt auch der Start in die Berufswelt gewisse Risiken. Die Konfrontation mit diesen Unsicherheiten gehört zum Prozess des Erwachsenwerdens dazu. Die damit verbundenen Erfahrungen, welche die jungen Menschen sammeln, sind von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Daher ist es unerlässlich, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen können. Wie sollen sie eigenständig in diese neuen Lebensabschnitte hineinwachsen, wenn ihnen bereits im Vorfeld die Chancen auf solche Erfahrungen genommen werden?
Ein gezieltes und strukturiertes Einstiegsarrangement in die Berufsfachschule soll eine eigenständige und selbstständige Entwicklung der Persönlichkeit der Jugendlichen fördern. Es geht dabei in erster Linie um eine Orientierung, Vorentlastung sowie eine Übersicht über die wesentlichen Unterschiede zu ihrem bisher gewohnten schulischen Kontext. Mit einer entsprechenden Planung wird der Übergang an der Schnittstelle kalkulierbarer, wovon die verschiedenen Akteure gleichermassen profitieren können. Die Berufslernenden finden sich im neuen schulischen Umfeld rascher zurecht, und die Beteiligten an der Berufsfachschule können sich bereits früh mit den eigentlichen Kernaufgaben befassen. Eine Möglichkeit beschreiten wir im Rahmen unseres Projekts, und weitere Vorgehensmöglichkeiten sind im Kapitel « Visionen» zu finden. Eine wichtige Forderung sollte nach unserem Dafürhalten eingehalten werden: «Keine Schnupperlehre ohne Kontakt zur entsprechenden Berufsfachschule». Darauf gehen wir im vierten Kapitel ein, indem wir darlegen, wie wir uns eine systematische Lernortkooperation zwischen Betrieb und Berufsfachschule vorstellen, die bei einer Schnupperlehre auch den theoretischen Teil der dualen Berufsausbildung berücksichtigt.
1.2.5 Sind wir nach unten offen?
An dieser Stelle könnte der (berechtigte) Einwand erfolgen, dass es allgemein zu den Aufgaben der Sekundarstufe I und im Speziellen zu den Aufgaben der Brückenangebote (bei denen es sich ja um nachobligatorische Schulen handelt) gehöre, die Jugendlichen auf die Sekundarstufe II vorzubereiten. Die Sekundarstufe II habe keine Möglichkeiten, ihre zukünftigen Berufslernenden auf die Berufsfachschule vorzubereiten. Folglich gehöre dies auch nicht zu ihren Aufgaben. Es sei uns hier verziehen, wenn wir aus dem Nähkästchen plaudern. Gerade in dieser Hinsicht hören wir dann von den Lehrpersonen der Berufsfachschulen, dass sie keinen Einfluss auf die Lernvoraussetzungen der Berufslernenden hätten und die Jugendlichen «nehmen» müssten, welche die Betriebe entsprechend selektioniert hätten. An dieser Stelle wäre die Erfüllung unserer Forderung «Keine Schnupperlehre ohne Kontakt zur entsprechenden Berufsfachschule» zielführend. Nicht etwa damit die Berufsfachschulen den Betrieben den Abschluss eines Lehrverhältnisses noch ausreden könnten. Vielmehr weil eine gezielte gegenseitige Vorbereitung aus genannten Gründen für beide Seiten vorteilhaft ist.
Die duale Berufsbildung propagiert die Durchlässigkeit sowohl nach oben als auch nach unten. Wenn wir dieses Faktum systemimmanent als Qualitätsmerkmal unserer Berufsausbildungen voraussetzen, wie kann es dann sein, dass wir die Vorbereitung für die Übergänge an den Schnittstellen einseitig angehen? Darunter verstehen wir, dass es in der Regel der tieferen Schulstufe vorbehalten ist, die Jugendlichen auf die nächsthöhere Stufe vorzubereiten. Damit liegt die Verantwortung für einen gelingenden Übertritt im Rahmen der Durchlässigkeit einseitig bei der Stufe, die sich unterhalb des anzustrebenden höheren Niveaus befindet. Die Durchlässigkeit ist zwar nach oben hin vorhanden, doch gibt es von oben her keine Haltegriffe oder eine unterstützende Leiter – niemand reicht den Berufslernenden von oben die Hand, damit sie ohne zu stolpern emporsteigen können.
Читать дальше