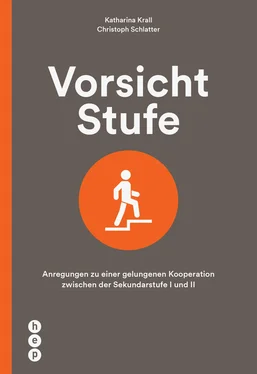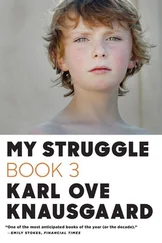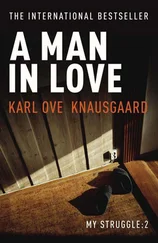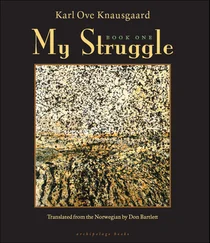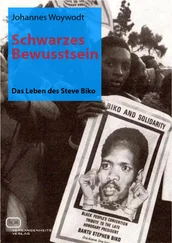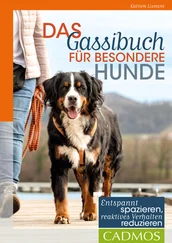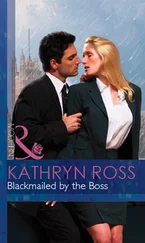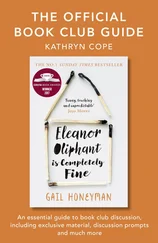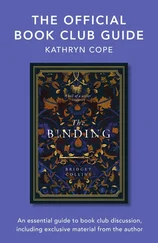Neben unserer persönlichen Betroffenheit und dem daraus resultierenden Bedürfnis, jene Schwachstelle zu beheben, erachten wir eine systematische Optimierung an den Schnittstellen auch als adäquate Massnahme, die Qualität des Ausbildungseinstiegs zu verbessern, denn es braucht unseres Erachtens mehr als nur ein niederschwelliges Projekt, das auf eine einzelne Berufsfachschule und ein Berufsvorbereitungsjahr beschränkt ist.
Im Jahr 2006 vereinbarten Bund, Kantone und Sozialpartner mit den Leitlinien zum Projekt «Nahtstelle» das Ziel, dass im Jahr 2015 95 Prozent der 25-Jährigen in der Schweiz über einen Abschluss auf Sekundarstufe II verfügen sollten (vgl. EDK 2006). Der Bildungsbericht 2018 geht davon aus, dass diese Zahl mittlerweile nahezu erreicht ist, immer abhängig von der Herkunft der Jugendlichen (vgl. SKBF 2018, S. 111). Mit unseren Anregungen zur Verbesserung der Schnittstellenproblematik möchten wir auch dazu beitragen, dass eine Abschlussquote von 95 Prozent in nächster Zukunft erreicht werden kann.
Unser Buch richtet sich einerseits an Lehrpersonen, die an dieser Schnittstelle tätig sind, und andererseits an Personen, die in Berufsberatungs- und Informationszentren (BIZ) oder als Ausbildungsverantwortliche in den Betrieben tätig sind. Daneben möchten wir auch betroffenen Eltern sowie weiteren am dualen Berufsbildungssystem interessierten Personen eine Übersicht über diese Schnittstellenproblematik vermitteln.
Uns ist bewusst, dass wir nicht die Ersten oder Einzigen sind, die sich zu diesem Thema Gedanken machen. Wir gehen davon aus, dass es andere, ähnliche Projekte gibt. Jedoch ist es nicht Ziel unseres Buchs, eine Auflistung dieser Projekte zu geben. Wir gehen davon aus, dass andere Akteure, ähnlich wie wir, ihre Projekte durchführen, ohne dass dies weit bekannt wäre. Vielleicht kann unser Buch aber ein Anstoss sein, solche Projekte zu sammeln, sich untereinander zu vernetzen und so vielen Jugendlichen den Übergang zu erleichtern (siehe Kapitel 6).
Im ersten Kapitel geht es um eine Begriffsklärung im Zusammenhang mit dem dualen Berufsbildungssystem der Schweiz. Wir konzentrieren uns dabei auf Begrifflichkeiten, die für das Verständnis unserer Ausführungen bedeutsam sind. Wir verzichten hingegen bewusst auf eine detaillierte Übersicht sowie einen geschichtlichen Abriss.
Im zweiten Kapitel möchten wir den Lesenden aufzeigen, wie wir die Situation an der besagten Schnittstelle wahrnehmen und erleben. Zum einen geht es darum, dass Lernende der Sekundarstufe I anscheinend nicht wirklich auf den Unterricht der Berufsfachschule vorbereitet sind. Dieses Problem lässt sich aber nicht allein an den Schulen lösen. Im dualen Berufsbildungssystem müssten die Lehrbetriebe ebenfalls davon überzeugt sein, dass der Unterricht an den Berufsfachschulen eine Herausforderung für die Lernenden darstellt. Deshalb sind wir der Ansicht, dass alle Lernenden im Rahmen einer Berufserkundung oder Schnupperlehre in einem Betrieb auch Kontakt mit der entsprechenden Berufsfachschule haben sollten, bevor sie eine Lehre beginnen. Unsere Forderung lautet also «Kein Lehrvertrag ohne Kontakt der oder des Lernenden zur entsprechenden Berufsfachschule».
Einen Überblick über unser Projekt geben wir im dritten Kapitel.
Im vierten Kapitel stellen wir ein Modell vor, das die verschiedenen Akteure an der Schnittstelle zwischen den beiden Sekundarstufen in ihrem Tun unterstützen soll.
Das fünfte Kapitel ist den Rahmenbedingungen für Kooperationen gewidmet. Darunter verstehen wir neben der Schulorganisation und den Rahmenlehrplänen zum Beispiel auch die persönlichen Kompetenzen der Lehrpersonen.
Das sechste Kapitel beinhaltet unsere Visionen (Methoden, Kooperationsmöglichkeiten und so weiter) darüber, wie der Übergang an der Schnittstelle gemeistert werden kann. Welche Möglichkeiten einer vertieften Kooperation zwischen den verschiedenen Akteuren gibt es? Ausserdem möchten wir alle beteiligten Akteure dazu aufrufen, sich an der qualitativen Verbesserung der Schnittstelle am Übergang der beiden Sekundarstufen zu beteiligen.
Wir möchten die beteiligten Akteure ermutigen, dass sie ihrerseits aktiv und kreativ nach weiteren Kooperationsmöglichkeiten Ausschau halten und diese ihren spezifischen Gegebenheiten anpassen. Vielleicht führt dies mittelfristig dazu, dass wir in einem zweiten Band, im Rahmen einer Art Methodensammlung, ein breites Repertoire an Kooperationsmöglichkeiten aufzeigen können.
Bei unserem Buchprojekt haben uns viele Personen unterstützt. Vor allem bei unseren Interviewpartnern und beim hep verlag möchten wir uns herzlich bedanken. Ohne diese Unterstützung wäre eine Realisierung nicht möglich gewesen.
1Durchlässigkeit, Schnittstellen und Übergänge von der obligatorischen Schulzeit in die Sekundarstufe II
In diesem Kapitel beschreiben wir mögliche Schwierigkeiten, vor denen die Lernenden stehen, wenn sie in die berufliche Grundbildung übertreten, und führen die wichtigsten Begriffe und Themen ein, die uns in diesem Buch beschäftigen.
1.1Auf ins schulische Paradies oder auf direktem Weg in die Lernhölle? Ein Beispiel aus dem Alltag der Autorin
Die Autorin berichtet: Am Ende meines ersten Jahres als Lehrerin im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) herrschte geschäftiges Treiben am letzten Schultag vor den Ferien. Es flossen noch ein paar Tränen zum Abschied, und dann sollte es ab in die Sommerferien und in die «richtige» Berufswelt gehen. Ein Jahr lang hatte ich die Lernenden auf ihrem Weg in die Berufswelt begleitet, mit ihnen Höhen und Tiefen erlebt, Bewerbungen geschrieben, Vorstellungsgespräche vorbereitet, mich mit ihnen über Absagen geärgert und mich letztlich aber auch mit ihnen über Zusagen im passenden Lehrbetrieb gefreut.
Die Schulzeit lag nach dem Schuljahr am BVJ vermeintlich endlich hinter den Lernenden, die Berufswelt wartete. Endlich durften die Jugendlichen sich beweisen, würden wie Erwachsene behandelt werden. Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Lernenden gut auf diesen Übergang vorbereitet hatte.
In diesem ersten Jahr kam ein Schüler am letzten Schultag zu mir und zeigte mir einen Brief von der Berufsfachschule, die er nach den Ferien besuchen sollte. Er – nicht in der Schweiz aufgewachsen, sondern erst mit 12 Jahren hierhergekommen – war vollkommen überrascht, dass er überhaupt nochmals in die Schule gehen sollte, für ihn war klar, dass er jetzt endlich arbeiten dürfe. Ich erinnerte ihn an den Lehrvertrag und die darin vermerkte Berufsfachschule, doch so genau hatte er sich den Vertrag nie angesehen.
Mit seinen Klassenkollegen entwickelte sich rasch eine heisse Diskussion: Zuerst wurde der Mitschüler ausgelacht, weil ihm nicht klar war, dass er einmal in der Woche würde zur Schule gehen müssen, aber dann kamen weitere Fragen auf: Na klar, die Berufsfachschule sei obligatorisch, aber wenn man am ersten Schultag noch in den Ferien sei, dann sei das doch nicht schlimm? Schliesslich sei das doch gar keine richtige Schule mehr, oder? Man lerne dort doch nur praktische Dinge, nicht? Man müsse sich auch gar keine Sorgen machen: Wenn im Betrieb alles laufe, dann spiele doch die Berufsfachschule gar keine Rolle, oder? Man könne gar nicht aus der Berufsfachschule fliegen und dort gebe es gar keine nervigen Fächer mehr wie Deutsch, Mathe oder Englisch. Man dürfe dort Kaugummi kauen und zu spät kommen, und es interessiere sowieso eigentlich niemanden so richtig, wie die Noten seien. Ob es dort überhaupt Noten gebe?
Woher diese ganzen Informationen stammten, wurde mir dann gleich mitgeteilt: Der «Kollege vom Kollegen vom Kollegen» sei im zweiten Lehrjahr zur Detailhandelsfachmann und verfüge damit über echtes Insiderwissen: Nirgends sei es so «chillig» wie an der Berufsfachschule.
Jetzt meldeten sich aber die Besorgten zu Wort: Die Cousine im ersten Lehrjahr zur Pharmaassistentin sei fast aus der Lehre geflogen, weil der Lehrbetrieb keine Noten unter 5.0 akzeptiere. Sie nehme einmal die Woche Nachhilfeunterricht, besuche den Stützkurs und sei aus sämtlichen Vereinen ausgetreten, um sich aufs Lernen konzentrieren zu können.
Читать дальше