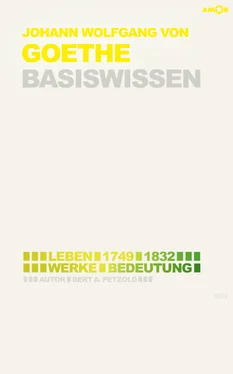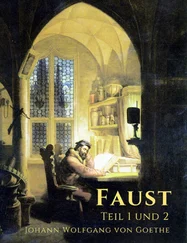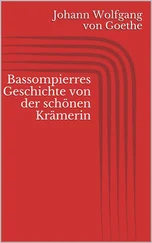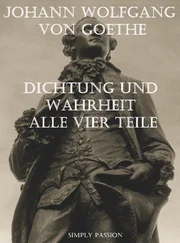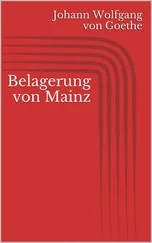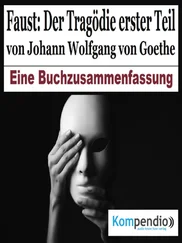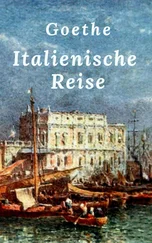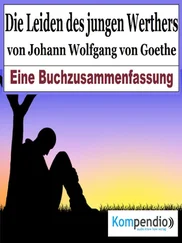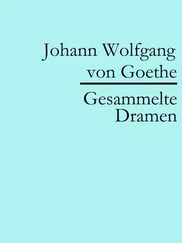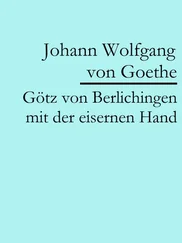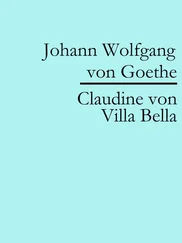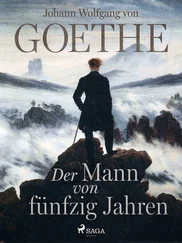Andererseits tat er diese ersten Luftschnapper in äußerst gut situierten Verhältnissen. Sein Vater Johann Caspar stammte aus einer Thüringer Bauern-, Handwerker- und Gastwirtsfamilie, von der er beträchtlich geerbt hatte. Er heiratete 1748 Catharina Elisabeth Textor, ihres Zeichens die Tochter des Frankfurter Stadtschultheißen, dem höchsten Beamten und Vertreter des Kaisers in der Reichsstadt. Großvater Textor nahm übrigens die schwierige Geburt des Enkels zum Anlass, um die Hebammen-Ausbildung zu reformieren und den Berufsstand der Geburtshelferin zu etablieren.
Johann Wolfgang hatte nur eine Schwester, Cornelia, die ein Jahr jünger war als er. Vier weitere Geschwister verstarben, noch bevor sie die Adoleszenz erreicht hatten. Seine Beziehung zur Schwester war dementsprechend eng, sie bewunderte ihn von Kindesbeinen an. Er war bedacht, alles, was er lernte, an die jüngere Schwester weiterzugeben, beide waren einander die engsten Vertrauten. Über die Beziehung reflektierte Goethe selber:
„Und so wie in den ersten Jahren Spiel und Lernen, Wachstum und Bildung den Geschwistern völlig gemein war, sodass sie sich für Zwillinge halten konnten, so blieb auch unter ihnen diese Gemeinschaft, dieses Vertrauen bei Entwicklung physischer und moralischer Kräfte. Jenes Interesse der Jugend, jenes Erstaunen beim Erwachen sinnlicher Triebe, die sich in geistige Formen geistiger Bedürfnisse, die sich in sinnliche Gestalten einkleiden, alle Betrachtungen darüber, die uns eher verdüstern als aufklären, manche Irrungen und Verwirrungen, die daraus entspringen, teilten und bestanden die Geschwister Hand in Hand.“
Die häusliche Umgebung konnte man durchaus als charakteristisch für Stand und Vermögen des Elternhauses bezeichnen. Der bei Goethes Geburt bereits 40-jährige Johann Caspar war höchst bedacht, seinen Kindern alle bildungstechnischen Privilegien zukommen zu lassen. So bekamen die Kinder die ungeteilte Aufmerksamkeit mehrerer Hauslehrer, lernten frühzeitig Latein, Griechisch, Französisch und Italienisch, lasen Klassiker im Original. Schon damals profilierte sich Johann Wolfgang durch sein Sprachtalent. Die Privilegien gingen einher mit einer immensen Erwartungshaltung, die vom Vater ausging und sich in einer routinierten Strenge auf die Kinder niedertrug.
Auf der entgegengesetzten Seite stand die viel jüngere Mutter, Catharina Elisabeth war bei Johann Wolfgangs Geburt gerade einmal 18 Jahre alt. Ihr war die kindliche Welt freilich näher, nachvollziehbarer und vertrauter. Sie ging voll auf in der gemeinsamen Freizeitgestaltung, im abendlichen Vorlesen und war selbst vom Leben nicht zu desillusioniert, um sich Phantasiewelten hingeben zu können. Den Einfluss der Eltern brachte Goethe knapp auf den Punkt: „Vom Vater habe ich die Statur, des Lebens ernstes Führen. Vom Mütterchen die Frohnatur und Lust zu fabulieren.“
Bedeutend war ebenfalls der Einfluss seiner Heimat. Die florierende Handelsstadt war mit 30.000 Einwohnern umtriebig, verwinkelt und geschichtsträchtig. Johann Wolfgang war Stadtkind durch und durch, das Labyrinth der Häuserschluchten verpflegte den hungrigen, jungen Geist mit allerlei Eindrücken. Gegenwärtig prasselten Schmiede, Fischer, Metzger und allerlei Händler auf den Jungen ein, während die alten Kirchen, Türme und Klöster eine gewisse Ehrfurcht vor dem Vergangenen und den Traditionen verlangten. In alledem die Idylle des schön gelegenen Elternhauses, Goethe erinnerte sich an seinen Lieblingsplatz im Obergeschoss:
„Dort war mein liebster, zwar nicht trauriger, aber doch sehnsüchtiger Aufenthalt. Über Gärten hinaus, über Stadtmauern und Wälle, sah man in eine schöne fruchtbare Ebene. Dort lernte ich Sommerszeit gewöhnlich meine Lektionen, wartete die Gewitter ab und konnte mich an der untergehenden Sonne nicht satt genug sehen. Da ich aber zu gleicher Zeit die Nachbarn in ihren Gärten wandeln und ihre Blumen besorgen, die Kinder spielen, die Gesellschaften sich ergötzen sah, so erregte dies frühzeitig in mir ein Gefühl der Einsamkeit und einer daraus entspringenden Sehnsucht, das, dem von der Natur in mich gelegten Ernsten und Ahndungsvollen entsprechend, seinen Einfluss gar bald und in der Folge noch deutlicher zeigte.“
Im menschgemachten Getümmel sehnte sich bereits der Jüngling nach der Natur. Diese Sehnsucht blieb sein Leben lang. In gleicher Manier zeichnete sich bereits zu jungen Jahren eine regelrechte Gier nach Wissen und der Drang, das Wissen zu verarbeiten, bei Johann Wolfgang ab. Aus der Bibliothek des Vaters verschlang er Juristisches, machte sich an französischen Theaterstücken von Racine oder Voltaire zu schaffen und griff immer wieder zur Bibel. Auch wenn er später den kirchlichen Formen des Christentums gänzlich absagte, nannte Goethe die Bibel als frühe Quelle seiner Bildung.
Das frühe Stadtleben etablierte schon damals Goethes berühmte Sensibilität für seine Umwelt. So nahm ihn die Kunde vom schweren Erdbeben in Lissabon am 1. November 1755, das als eine der großen Naturkatastrophen des Jahrhunderts in die Geschichte einging, schwer mit. In „Dichtung und Wahrheit“ ließ Goethe nachklingen, wie sehr er als Knabe davon betroffen war:
„Schneller als die Nachrichten hatten schon Andeutungen dieses Vorfalls sich durch große Landstrecken verbreitet. An vielen Orten waren schwächere Erschütterungen zu verspüren, an manchen Quellen ein ungewöhnliches Innehalten zu bemerken gewesen. Um desto größer war die Wirkung der Nachrichten selbst. Der Knabe, der alles dieses wiederholt vernehmen musste, war nicht wenig betroffen.“
Gleichzeitig war eine bewegte Handelsstadt wie Frankfurt freilich selbst fest eingebunden in die zeitgenössische Geschichte. 1759 wurde Frankfurt von den mit den Österreichern verbundenen Franzosen überrumpelt und besetzt, im Elternhaus nahm der leitende französische Verwaltungsbeamte fast zweieinhalb Jahre die unteren Stockwerke in Beschlag.
Die französische Besatzung brachte ebenfalls eine Schauspieltruppe in die Stadt, Goethe war elf Jahre jung und besuchte die Aufführungen regelmäßig. Gleichzeitig machte Goethe seine ersten poetischen Versuche zu dieser Zeit. Zum Sonntagsempfang war es normal, dass die Kinder Verse vortrugen, Goethe war von der Qualität seiner Verse schnell überzeugt, vor allem weil die anderen in seinen Augen „sehr lahme Dinge vorbrachten“.
3. Goethe wird schwärmerischer Dichter und Student (1765–1771)
Mit 16 Jahren fühlte sich Goethe der Stadt Frankfurt, aber gemäß dem Alter wahrscheinlich auch dem Elternhaus, überdrüssig. Goethe wollte studieren, sein Ziel die Universität Göttingen, wo er unter Christian Gottlob Heyne und Johann David Michaelis die Altertumskunde studieren wollte, um seiner Dichtkunst mehr Substanz zu verleihen. Sein Vater war ebenfalls der Meinung, dass der Sohn, dem bisher jegliches Wissen spielerisch zugefallen war, bereit für ein Studium war. Mit dem Studienfach und -ort hingegen war er nicht d’accord.
Johann Caspar hatte zu seiner Zeit die Universität in Leipzig besucht, Jura studiert und hegte weiterhin einige Kontakte, die er bei Bedarf spielen lassen konnte. Für ihn stand außer Frage, dass der Zögling in die eigenen Fußstapfen zu treten hatte. Goethe erinnert sich, wie der Vater stundenlang über seine Studienzeiten schwadronierte, ließ ihn reden und machte sich „kein Gewissen“ daraus.
Am 27. September 1765 hieß es also: Abschied nehmen von den Frankfurter Freunden. Unter den Kumpanen Johann Jakob Riese, Ludwig Moors und Johann Adam Horn ging nur Horn ebenfalls nach Leipzig und auch erst ein halbes Jahr später.
Goethe erreichte die sächsische Messestadt am 3. Oktober 1765. Leipzig war damals von etwa gleicher Größe und internationaler Umtriebigkeit wie Frankfurt, präsentierte sich aber nicht altertümlich verwinkelt, sondern modern, mit breiten Straßen, Blockquartieren und einheitlichen Fassaden. Studenten hausierten in durchaus komfortablen Zwei-ZimmerQuartieren, die unweit des berühmten „Auerbachs-Keller“ entfernt lagen. Auch Goethe würde in naher Zukunft schon häufig hier verkehren.
Читать дальше