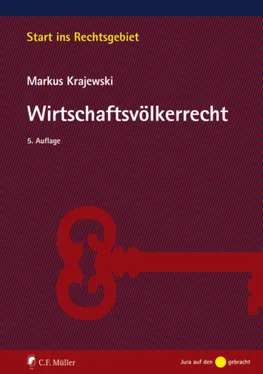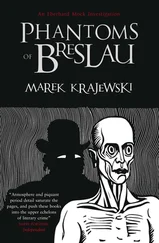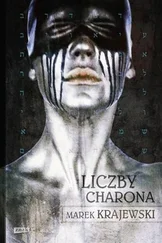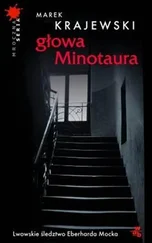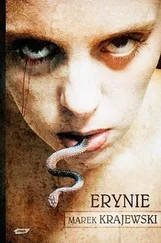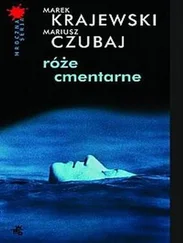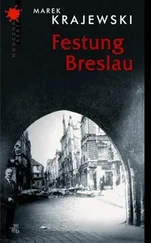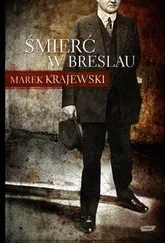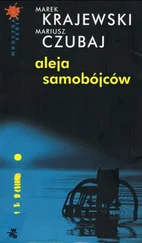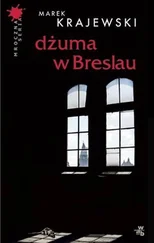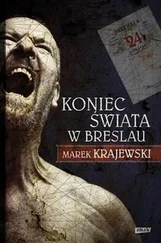Am 15. Juli 2012 trafen die 50 000 T-Shirts in Hamburg ein und wurden in einem Zolllager gelagert. Die G beantragte daraufhin beim BAFA eine Einfuhrgenehmigung, die vom BAFA unter Hinweis auf die Quotenerschöpfung abgelehnt wurde. Gleichzeitig beantragte die G beim zuständigen Zollamt Hamburg-Freihafen die Abfertigung der T-Shirts zum freien Verkehr. Der Antrag wurde mit der Begründung abgelehnt, dass G über keine Einfuhrgenehmigung verfüge.
Erst nachdem sich die EU und die VR China im September 2012 auf eine Aufhebung der Einfuhrbeschränkungen geeinigt haben, werden die T-Shirts freigegeben. Nachdem G die Waren in Empfang genommen hat, stellt sie fest, dass nur weiße und keine farbigen T-Shirts geliefert wurden.
G fragt, gegen wen sie Schadensersatzansprüche geltend machen kann und an welche Gerichte sie sich wenden muss.
Sachverhalt nach BVerfG, EuZW 2005, 767 = NVwZ 2006, 79
1
Der Sachverhalt des Ausgangsfalls betrifft eine typische Konstellation der internationalen Wirtschaftsbeziehungen: Der grenzüberschreitende Austausch von Gütern wird durch verschiedene Ereignisse gestört. Dies wirft eine Reihe von Rechtsfragen auf, deren Antworten in unterschiedlichen Rechtsgebieten zu finden sind. Das Wirtschaftsvölkerrechtist eines dieser Rechtsgebiete. Bevor es in den folgenden Kapiteln im Einzelnen dargestellt wird, soll sein Inhalt und seine Abgrenzung zu anderen Rechtsgebieten erläutert werden.
Teil 1 Grundlagen› I. Wirtschaftsvölkerrecht als Teil des internationalen Wirtschaftsrechts› 1. Elemente des internationalen Wirtschaftsrechts
1. Elemente des internationalen Wirtschaftsrechts
2
Internationale Wirtschaftsbeziehungenumfassen den grenzüberschreitenden Austausch von Gütern (Waren und Dienstleistungen), den grenzüberschreitenden Transfer von Kapital und Zahlungsmitteln sowie den grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Verkehr von Personen (Unternehmen und Privatpersonen). Internationale Wirtschaftsbeziehungen werden von einer Vielzahl unterschiedlicher Rechtsregeln erfasst. Unabhängig von ihrer Zuordnung zum nationalen oder internationalen, privaten oder öffentlichen Recht können alle Rechtsnormen, die die Regelung internationaler Wirtschaftsbeziehungen zum Gegenstand haben, als internationales Wirtschaftsrechtoder Recht der internationalen Wirtschaftbezeichnet werden. Diese Betrachtungsweise des Rechts knüpft an den einheitlichen Vorgang einer internationalen Wirtschaftstransaktion an und betrachtet die Gesamtheit der Regeln, die diesen Vorgang betreffen (können).[1]
3
Trotz des Bezugs auf einen einheitlichen Lebenssachverhalt unterscheiden sich die Regeln des internationalen Wirtschaftsrechts in verschiedener Hinsicht: Sie betreffen teils das Verhältnis der Staaten untereinander bzw. zwischen Staaten und Privatrechtssubjekten (öffentlich-rechtliche Dimension) und teils das Verhältnis von Privatrechtssubjekten untereinander (privatrechtliche Dimension). Zum Teil entstammen sie dem nationalen Recht, zum Teil dem internationalen Recht (Völkerrecht) und zum Teil dem supranationalen Recht (Europarecht). Hinzu treten unverbindliche Standards und internationale Handelsbräuche, die für die internationalen Wirtschaftsbeziehungen von großer Bedeutung sind.
[1]
Kreuter-Kirchhof , in: Graf Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 8. Aufl., 2019, 6. Abschnitt, Rn. 10.
a) Nationales Wirtschaftsrecht
4
Nationales Recht, das sich auf Sachverhalte der internationalen Wirtschaft bezieht, kann von den Staaten grundsätzlich rechtlich autonom, d.h. ohne Kooperation mit anderen Staaten gesetzt werden. Die für das internationale Wirtschaftsrecht typische Durchdringung und Verzahnung von nationalem Recht, Europa- und Völkerrecht führt jedoch dazu, dass das nationale Recht selten tatsächlich autonomgesetzt wird. Zu den Rechtsgebieten des nationalen Rechts, die als Teil des internationalen Wirtschaftsrechts angesehen werden können, gehören in erster Linie das Zoll- und Außenwirtschaftsrecht als öffentlich-rechtliche Materie und das internationale Privatrecht als privatrechtliche Materie.
5
Das Zollrechtbetrifft die Lenkung von Außenhandelsströmen mit fiskalischen Mitteln, weshalb es häufig gemeinsam mit dem Steuerrecht betrachtet wird.[1] Da in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union das Zollrecht auf europäischer Ebene harmonisiert ist (Gemeinsamer Zolltarif und Zollkodex)[2], gehört es für die Bundesrepublik Deutschland nicht zum nationalen Recht im eigentlichen Sinne. Der Vollzug des Zollrechts obliegt aber – wie zumeist im Europarecht – den Behörden der Mitgliedstaaten, d.h. in Deutschland den Hauptzollämtern. Das Verwaltungsverfahren und der gerichtliche Rechtsschutz bestimmen sich nach den allgemeinen Vorschriften der Abgabenordnung (AO) und der Finanzgerichtsordnung (FGO) sowie dem Zollverwaltungsgesetz (ZollVG). Rechtsschutz in Zollsachen gewähren danach in erster Linie die Finanzgerichte. Hält ein Finanzgericht Fragen der Wirksamkeit oder der Auslegung des EU-Rechts für streiterheblich, kann es diese Fragen gem. Art. 267 AEUV dem EuGH vorlegen.[3]
6
Das Außenwirtschaftsrechtist eine Sondermaterie des öffentlichen Wirtschaftsrechts (Wirtschaftsverwaltungsrecht) und umfasst Ein- und Ausfuhrregelungen.[4] Es ist weitgehend im Außenwirtschaftsgesetz(AWG) von 1961 und der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) kodifiziert. Zum Außenwirtschaftsrecht gehört auch die Erteilung von Einfuhr- und Ausfuhrgenehmigungen, die häufig auf europäischen Vorschriften beruhen. Die Durchführung des Außenwirtschaftsrechts obliegt zu großen Teilen dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Verfahrensrecht und Rechtsschutz richten sich nach dem allgemeinen Verwaltungsrecht.
7
Das Internationale Privatrecht(auch Kollisionsrecht) klärt bei Sachverhalten mit Auslandsberührung, welches nationale Recht auf den Sachverhalt Anwendung findet.[5] Es enthält dagegen keine materiell-rechtlichen Regeln.
8
Internationales Privatrecht ist – entgegen seiner Bezeichnung – nationales Recht. Das deutsche internationale Privatrecht wird im Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB)geregelt. Nach Art. 3 Abs. 1 EGBGB findet das internationale Privatrecht auf Sachverhalte „mit Verbindung zum Recht eines ausländischen Staats“ Anwendung. Nach Art. 3 Abs. 2 EGBGB gehen Regelungen in völkerrechtlichen Verträgen, „soweit sie unmittelbar anwendbares innerstaatliches Recht geworden sind, den Vorschriften dieses Gesetzes vor.“ Zu diesen Regeln zählt z.B. das sog. UN-Kaufrecht.[6] Für vertragliche Schuldverhältnisse wird das EGBGB inzwischen durch die einheitlichen Regeln des europäischen Kollisionsrechts (VO 593/2008, sog. Rom I-Verordnung) weitgehend überlagert. Die Vorschriften finden auch Anwendung, wenn das Recht eines Staates außerhalb der EU betroffen ist (Art. 2 Rom I-Verordnung).
9
Nach Art. 3 Abs. 1 Rom I-Verordnung sowie Art. 27 Abs. 1 EGBGB können die Vertragsparteien durch Vereinbarung einer Rechtswahlklauselfrei bestimmen, welches Recht anwendbar sein soll. Haben die Parteien keine Rechtswahl getroffen, sehen die Vorschriften der Rom I-Verordnung und des EGBGB verschiedene Zuordnungen vor. So unterliegen Kaufverträge über bewegliche Sachen gem. Art. 4 Abs. 1 lit. a) Rom I- Verordnung dem Recht des Staates, in dem der Verkäufer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
10
Da jede nationale Rechtsordnung über ein internationales Privatrecht verfügt, kann es vorkommen, dass die jeweiligen nationalen Rechtsnormen für einen Auslandssachverhalt auf unterschiedliche Rechtsordnungen verweisen. Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, bemühen sich die Staaten um eine Vereinheitlichung ihres internationalen Privatrechts. Dies geschieht mit Hilfe von völkerrechtlichen Verträgen.[7]
Читать дальше