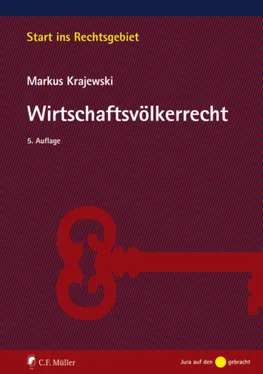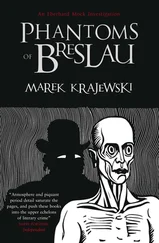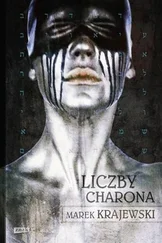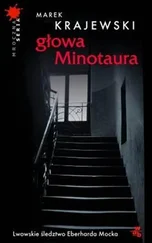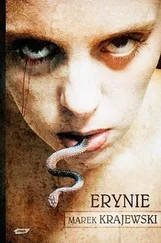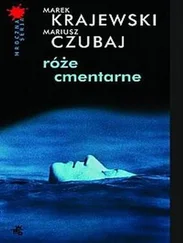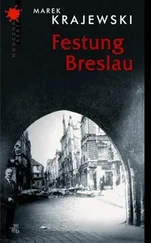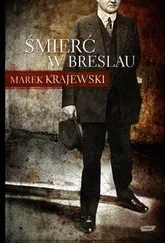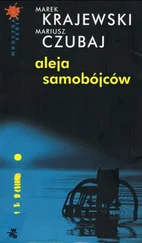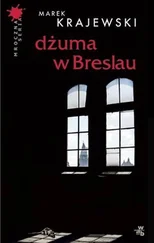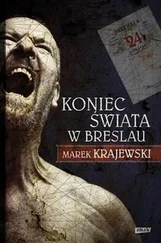c) Das internationale Währungs- und Finanzsystem nach der Wirtschafts- und Finanzkrise 2007–2009
III. Der Internationale Währungsfonds (IWF)
1. Institutionelle Grundlagen
a) Rechtsstellung
b) Bedeutung von Quoten und Sonderziehungsrechten
c) Organe und Entscheidungsfindung
2. Aufgaben des IWF
a) Allgemeine Grundlagen
b) Kreditvergabe
c) Politiküberwachung
3. Verpflichtungen der IWF-Mitglieder
a) Wechselkursregelungen
b) Devisenkontrollen
IV. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ)
1. Institutionelle Grundlagen
a) Rechtsstellung
b) Organe
2. Aufgaben
3. Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht
Teil 6 Entwicklungsvölkerrecht
I. Grundlagen
1. Hintergrund
2. Allgemeine Prinzipien des Entwicklungsvölkerrechts
3. Problemkreise
II. Handel und Entwicklung
1. Sonderregeln für Entwicklungsländer im WTO-Recht
a) Geschichtlicher Hintergrund
b) Besondere und differenzierte Behandlung als Grundsatz des WTO-Rechts
c) Präferenzsysteme und die Enabling Clause
2. Regulierung des Rohstoffhandels
a) Internationale Rohstoffabkommen
b) Transparenzregeln für Rohstoffmärkte
3. EU-AKP-Assoziierungsabkommen
III. Finanzierung und Verschuldung
1. Entwicklungsfinanzierung durch die Weltbank
2. Staatsverschuldung und Zahlungskrisen
a) Hintergrund und Maßnahmen zur Reduzierung der Verschuldungskrise
b) Zahlungsnotstand und Insolvenzverfahren für Staaten
IV. Recht auf Entwicklung als Menschenrecht?
Teil 7 Regionale Wirtschaftsintegration
I. Grundlagen
1. Formen regionaler Integration
2. Proliferation und Wandel regionaler Integration
II. Verhältnis regionaler zu multilateraler Integration
1. Grundsätzliche Perspektiven
2. Regionale Integrationsabkommen und WTO-Recht
III. Beispiele regionaler Integration
1. Nordamerikanische Freihandelsabkommen
2. Integrationsabkommen in Lateinamerika und der Karibik
3. Integrationsabkommen in Asien: ASEAN und RCEP
4. Regionale Wirtschaftsintegration in Afrika
5. Freihandelsabkommen der EU
Stichwortverzeichnis
Hinweise zum Auffinden der Rechtsquellen des Wirtschaftsvölkerrechts
Wie jedes Rechtsgebiet kann auch das Wirtschaftsvölkerrecht nicht ohne die Kenntnis der einschlägigen Normen verstanden werden. Auch wenn wichtige Normen in diesem Buch im Wortlaut zitiert werden, sind die Texte der jeweiligen völkerrechtlichen Verträge unerlässliche Hilfsmittel für das Studium des Wirtschaftsvölkerrechts. Leider gibt es keine Textsammlung, die alle in diesem Buch erörterten Verträge enthält. Folgende Textsammlungen sind auf dem Markt erhältlich:
| – |
Sartorius II, Internationale Verträge, Europarecht (C. H. Beck). Diese Loseblattsammlung, die als Standardtextsammlung für das Völker- und Europarecht gilt, enthält neben allgemeinen völkerrechtlichen Verträgen folgende wirtschaftsvölkerrechtliche Normen: IWF- und Weltbank-Übereinkommen, ICSID- und MIGA-Abkommen, WTO-Übereinkommen, GATT und das WTO-Streitschlichtungsübereinkommen (DSU). |
| – |
WTO, Welthandelsorganisation (Beck-Texte im dtv). Diese Sammlung enthält die wichtigsten WTO-Verträge, aber keine weiteren wirtschaftsvölkerrechtlichen Normen. |
| – |
Völker- und Europarecht, mit WTO-Recht (C. F. Müller). Diese etwas preisgünstigere Alternative zum Sartorius II enthält neben dem allgemeinen Völkerrecht einige wichtige WTO-Verträge (WTO-Übereinkommen, GATT, GATS, TRIPS, DSU und TPRM). Weitere WTO-Verträge und der Mustervertrag für die deutschen Investitionsschutzverträge werden auf den Verlagsseiten im Internet bereitgestellt. |
In Ergänzung zu diesen Sammlungen ist daher auf das Amtsblatt der Europäischen Union für die Verträge, denen die EU beigetreten ist und das Bundesgesetzblatt Teil II für die Verträge, denen die Bundesrepublik Deutschland beigetreten ist, zurückzugreifen. Das Amtsblatt der EU ist unter http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.htmlund das Bundesgesetzblatt II unter http://www1.bgbl.de/im Internet abrufbar. Wirtschaftsvölkerrechtliche Verträge, denen (auch) die Schweiz beigetreten ist, finden sich in der Systematischen Sammlung des Schweizer Bundesrechts, die im Internet unter https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/international.htmlzur Verfügung steht.
Dokumente internationaler Organisationen und Entscheidungen internationaler Schiedsgerichte sind zunehmend ebenfalls im Internet aufzufinden. Neben den allgemeinen Internetadressen von WTO, IWF, Weltbank u.a. sind zu nennen:
| – |
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm(alle Entscheidungen der Panels und des Appellate Body der WTO) |
| – |
http://docsonline.wto.org/(Suchmaske für alle WTO Dokumente) |
| – |
https://icsid.worldbank.org/cases/case-database(Entscheidungen des International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) |
| – |
http://www.sice.oas.org/agreements_e.asp(Sammlung regionaler Integrationsabkommen auf dem amerikanischen Kontinent) |
Inhaltsverzeichnis
I. Wirtschaftsvölkerrecht als Teil des internationalen Wirtschaftsrechts
II. Völkerrechtliche Grundlagen des Wirtschaftsvölkerrechts
III. Theorie der internationalen Wirtschaftsbeziehungen
Teil 1 Grundlagen› I. Wirtschaftsvölkerrecht als Teil des internationalen Wirtschaftsrechts
I. Wirtschaftsvölkerrecht als Teil des internationalen Wirtschaftsrechts
Literatur:
Herdegen, Internationales Wirtschaftsrecht, 12. Aufl., 2020, § 1; Schöbener/Herbst/Perkams , Internationales Wirtschaftsrecht, 2010, § 2; Tietje , Begriff, Geschichte und Grundlagen des Internationalen Wirtschaftssystems und Wirtschaftsrechts, in: ders. (Hrsg.), Internationales Wirtschaftsrecht, 2. Aufl., 2015, § 1; Herrmann/Weiß/Ohler, Welthandelsrecht, 2. Aufl., 2007, Gramlich, Internationales Wirtschaftsrecht, 2004, Kapitel 1; § 4; Tietje, Transnationales Wirtschaftsrecht aus öffentlich-rechtlicher Perspektive, ZvglRWiss 101 (2002), 404; Behrens, Elemente eines Begriffs des Internationalen Wirtschaftsrechts, RabelsZ 50 (1986), 483; Fikentscher, Wirtschaftsrecht I – Weltwirtschaftsrecht und Europäisches Wirtschaftsrecht, 1983, § 4.
Ausgangsfall
Die G GmbH, ein Unternehmen der Textilbranche mit Sitz in Deutschland, produziert Markenbekleidung. Im April 2012 schloss sie mit dem chinesischen Textilhersteller T einen Vertrag über die Lieferung von 50 000 T-Shirts aus Baumwolle in verschiedenen Farben zum Preis von 2,50 € pro T-Shirt. Laut Vertrag war die Ware zwischen dem 10. und 15. Juli 2012 „Cost, Insurance, Freight (CIF)“ nach Hamburg zu liefern.
Am 10. Juni 2012 schlossen die EU und die VR China ein Übereinkommen zur Beschränkung der Einfuhr von Textil- und Bekleidungserzeugnissen aus China in die EU. Auf Grundlage dieses Übereinkommens legte die Europäische Kommission durch eine Verordnung Höchstmengen (Quoten) für die Einfuhr von bestimmten Textilwaren aus China fest. Nach dieser Verordnung war die Einfuhr von Textilwaren in die EU von einer Einfuhrgenehmigung abhängig, die von den Behörden der Mitgliedstaaten nach Zustimmung der Kommission erteilt wurde. In Deutschland wurden die Einfuhrgenehmigungen vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erteilt. Am 10. Juli 2012 teilte die EU-Kommission den Behörden der Mitgliedstaaten mit, dass die festgelegten Quoten erschöpft seien und dass sie keinen weiteren Einfuhrgenehmigungen zustimmen werde.
Читать дальше