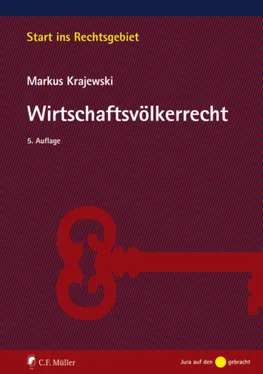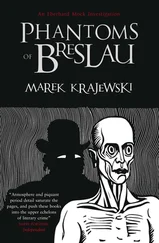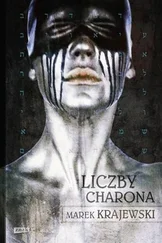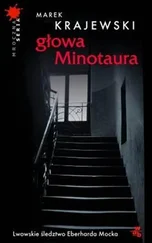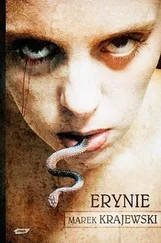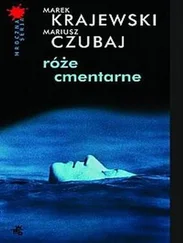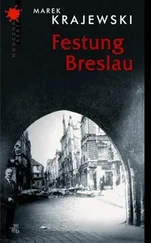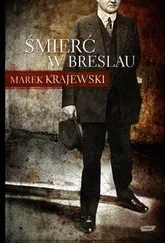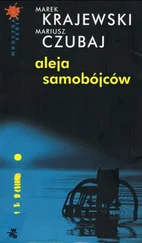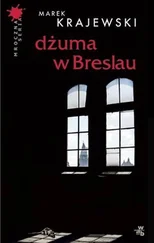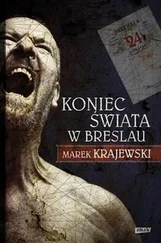1 ...7 8 9 11 12 13 ...29 52
Die Europäische Unionnimmt eine Sonderstellungunter den internationalen Organisationen ein. Aufgrund ihrer umfassenden Kompetenzen hat sie vor allem in den internationalen Handelsbeziehungen die Mitgliedstaaten als eigenständige Akteure fast vollständig verdrängt. Auch in anderen Bereichen des Wirtschaftsvölkerrechts, wie dem Investitionsrecht, Wettbewerbsrecht und beim Abschluss von regionalen Handelsabkommen, lässt sich die Rolle der EU eher mit der eines Staates vergleichen als mit der einer herkömmlichen internationalen Organisation.
53
Die Völkerrechtssubjektivitätder internationalen Organisationen leitet sich von der Völkerrechtssubjektivität der Staaten ab und wird daher auch als derivativ bezeichnet („gekorene Völkerrechtssubjekte“). Sie ist regelmäßig partiell, d.h. sie gilt nur für bestimmte Materien oder Sachgebiete. Zumeist ist sie auch relativ oder partikular, d.h. sie gilt nur gegenüber bestimmten anderen Völkerrechtssubjekten.
54
Die Völkerrechtssubjektivität internationaler Organisationen wird durch den Willen ihrer Gründungsmitgliederbegründet, die Organisation mit Rechten und Pflichten auszustatten. Die Begründung der Rechtspersönlichkeit kann sich ausdrücklichaus dem Gründungsvertrag der internationalen Organisation ergeben, wie z.B. im Fall der WTO.
Art. VIII:1 Übereinkommen zur Gründung der Welthandelsorganisation (WTO)
Die WTO besitzt Rechtspersönlichkeit; von jedem ihrer Mitglieder wird ihr die Rechtsfähigkeit eingeräumt, die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
55
Art. VIII:1 WTO-Übereinkommen begründet nicht nur ausdrücklich die Völkerrechtssubjektivität der WTO, sondern macht auch deutlich, dass die Fähigkeit, Trägerin von Rechten zu sein, der WTO von ihren Mitgliedern eingeräumt wird. Außerdem zeigt Art. VIII:1, dass die Rechtsfähigkeit der WTO partiell ist, da sie auf den Umfang beschränkt ist, der „zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist“.
56
Die Völkerrechtspersönlichkeit internationaler Organisationen kann sich auch implizitaus dem Gründungsvertrag ergeben. Dies hat der Internationale Gerichtshof z.B. für die Charta der Vereinten Nationenangenommen. In seinem Gutachten über die Frage, ob die Vereinten Nationen gegenüber einem Staat Ansprüche wegen der Ermordung eines UN-Bediensteten gelten machen können, bejahte der IGH die Völkerrechtspersönlichkeit der Vereinten Nationen mit einer funktionalen Perspektive. Die Vereinten Nationen könnten ihre Aufgaben nach der UN-Charta nur erfüllen, wenn sie Völkerrechtssubjekt seien.[5]
57
Die Völkerrechtspersönlichkeit einer internationalen Organisation gilt zunächst nur gegenüber ihren Mitgliedern. Gegenüber Nicht-Mitgliedern wird sie erst begründet, wenn diese die Völkerrechtspersönlichkeit der internationalen Organisation mittels einer förmlichen Erklärung oder durch die Begründung von rechtlichen Beziehungen faktisch anerkennen. Hierin zeigt sich, dass die Völkerrechtspersönlichkeit einer internationalen Organisation relativ ist. Die Völkerrechtspersönlichkeit gilt nur gegenüber Mitgliedern und solchen Nicht-Mitgliedern, die diese ausdrücklich anerkannt haben.
[1]
Ausführlich dazu Ruffert/Walter , Institutionalisiertes Völkerrecht, 2. Aufl., 2015.
[2]
Schöbener / Herbst/Perkams, Internationales Wirtschaftsrecht, 2010, §§ 6-8.
[3]
Organisation for Economic Cooperation and Development. Es handelt sich um einen Zusammenschluss von überwiegend europäischen und nordamerikanischen Industrie- und Schwellenländern mit Sitz in Paris.
[4]
Zu regionalen Integrationsorganisationen siehe Teil 7.
[5]
IGH, Reparations for Injuries, Gutachten vom 11.4.1948, ICJ Reports 1949, 174, 179. Siehe auch Dörr, Kompendium völkerrechtlicher Rechtsprechung, 2. Aufl., 2014, Fall 10.
58
Individuen wurde bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts generell keine Völkerrechtssubjektivitätzugebilligt. Soweit das Völkerrecht Rechte und Pflichten für Individuen begründete, galten diese zunächst nur für die Staaten. Rechte und Pflichten, die sich auf Individuen bezogen, mussten zunächst in staatliches Recht umgesetzt werden. Auf völkerrechtlicher Ebene konnten diese Rechte nur von Staaten wahrgenommen werden. Das Individuum trat aus völkerrechtlicher Sicht stets nur als Angehöriger eines Staats in Erscheinung („Mediatisierung des Individuums“).
59
Diese Auffassung ist heute überholt. Zwar können nach wie vor völkerrechtliche Individualrechte von den Staaten im Wege des diplomatischen Schutzes eingefordert werden.[1] Die regional und international verbürgten Menschenrechtekönnen jedoch unmittelbar geltende völkerrechtliche Rechte für Individuen begründen. Dies gilt insbesondere für die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK). In jüngster Zeit werden zunehmend auch Pflichten von Individuen angenommen, z.B. im entstehenden Völkerstrafrecht. Insofern geht man heutedavon aus, dass Individuen jedenfalls eine partielle Völkerrechtssubjektivitätzukommen.
[1]
Dazu unten Rn. 103 f.
d) Transnationale Unternehmen
60
Transnationale oder multinationale Unternehmen, d.h. Unternehmen, die durch Zweigniederlassungen in mehr als einem Staat wirtschaftlich tätig sind, gehören zu den Hauptakteuren der internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Sie sind für einen großen Teil des internationalen Waren- und Dienstleistungshandels, der ausländischen Direktinvestitionen und des internationalen Kapital- und Zahlungsverkehrs verantwortlich. Die wirtschaftliche Macht transnationaler Unternehmen zeigt sich plastisch daran, dass die Jahresumsätze mancher Unternehmen das Bruttoinlandsprodukt zahlreicher Staaten um ein Vielfaches übersteigen. Transnationale Unternehmen beeinflussen auch die Aushandlung völkerrechtlicher Verträge, wie z.B. der Einfluss US-amerikanischer Unternehmen auf die Verhandlungen zum Dienstleistungsabkommen der WTO (GATS) und das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums (TRIPS) zeigt.[1]
61
Trotz ihrer tatsächlichen Bedeutung für die internationalen Wirtschaftsbeziehungen und das Wirtschaftsvölkerrecht ist die rechtliche Qualifizierung von multinationalen Unternehmen aus völkerrechtlicher Sicht, insbesondere die Frage einer Völkerrechtssubjektivität, hochumstritten.[2] Nach überwiegender Auffassung sind multinationale Unternehmen keine Völkerrechtssubjekte,da es (derzeit noch) keine unmittelbar geltenden Völkerrechtsregeln gibt, durch die multinationalen Unternehmen direkte Rechte und Pflichten übertragen werden.
62
Die Frage der Völkerrechtssubjektivität transnationaler Unternehmen ist jedoch nicht pauschal zu beantworten. Vielmehr ist zu prüfen, ob transnationalen Unternehmen im Einzelfalldurch völkerrechtliche Normen Rechte oder Pflichten übertragen wurden. In Investitionsschutzverträgen kann multinationalen Unternehmen z.B. das Recht eingeräumt werden, Streitigkeiten im Rahmen einer Investor-Staat-Streitschlichtung[3] zu lösen. Wenn dieses Recht unabhängig von der Zustimmung des Sitzstaats ausgeübt werden kann, begründet der Vertrag für multinationale Unternehmen eine völkerrechtliche Rechtsposition. In einem solchen Fall ist auch eine partielle Völkerrechtssubjektivität multinationaler Unternehmen anzunehmen.
63
In gleicher Weise ist denkbar, dass durch eine völkerrechtliche Norm Pflichten für transnationale Unternehmen begründet werden.[4] Allerdings sind die Kodizesfür das Verhalten transnationaler Unternehmen, die in internationalen Organisationen bisher entwickelt wurden, stets unverbindliche Richtliniengeblieben. Dies gilt sowohl für die von der ILO 1977 angenommene und 2017 zuletzt geänderte „Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises“[5] als auch für die von der OECD 1976 erlassenen und zuletzt 2011 überarbeiteten „OECD Guidelines for Multinational Enterprises“.[6]
Читать дальше