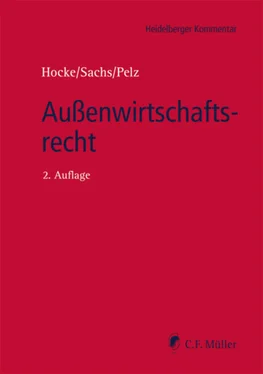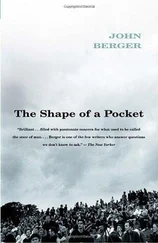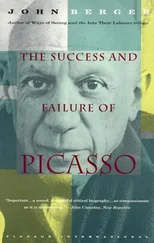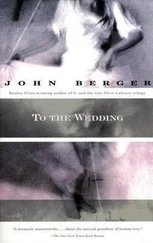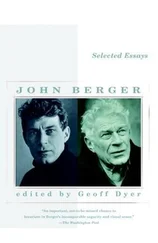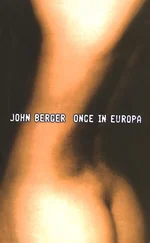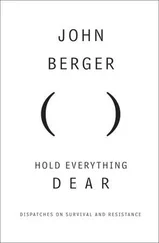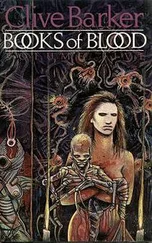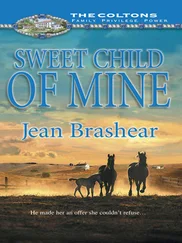2. Das Liberalitätsprinzip
10
Das Freiheits- oder Liberalitätsprinzip[15] ist das Leitprinzip des deutschen Außenwirtschaftsrechts.[16] Das bedeutet, dass der Außenhandel im Zweifel frei ist, und nur in eng umgrenzten Ausnahmefällen eingeschränkt wird.[17] Die Freiheit, sich im Außenhandel zu betätigen, stellt eine einfachgesetzliche Ausprägung eines auch durch die Grundrechte verbrieften Rechts dar. In erster Linie lässt sich diese Freiheit auf die gem Art 12 Abs 1 GG geltende Berufsfreiheit stützen.[18] Wo es um den Eingriff in bestehende Vertragsverhältnisse und dergleichen geht, kann zudem die Eigentumsgarantie gem Art 14 GG maßgeblich sein. Schließlich wird die Freiheit, sich im Außenhandel zu betätigen, subsidiär auch durch Art 2 Abs 1 GG gewährt. Wo es um die Gleichbehandlung zwischen verschiedenen Wirtschaftsteilnehmern geht, ist auch Art 3 Abs 1 GG einschlägig.
11
Vor diesem Hintergrundstellt sich die Frage, ob Abs 1 S 1daneben ein eigenständiger Regelungsgehalt zukommt. Obgleich vielfach verneint,[19] wird man davon ausgehen müssen, dass Abs 1 S 1sowohl personell als auch materiell über den Mindestgewährleistungsgehalt der Grundrechte hinausgeht. Zunächst gilt Abs 1 S 1für alle natürlichen und juristischen Personen, die in seinen Anwendungsbereich fallen, also etwa auch für ausländische juristische Personen, die über Art 19 Abs 3 GG nicht am Grundrechtschutz teilhaben können. Des Weiteren ist bei Art 12 Abs 1 GG in der Regel lediglich der Bereich der Berufsausübung betroffen, der nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus vernünftigen Erwägungen des Gemeinwohls eingeschränkt werden kann.[20] Da das AWG vorgibt, aus welchen Gründen und unter welchen Maßgaben die Außenhandelsfreiheit eingeschränkt werden kann, kommt Abs 1 S 1ein eigenständiger Regelungsgehalt zu.[21]
12
In der Praxishat dies folgende Auswirkungen: Erstens muss sich dieser Grundsatz bei Zweifelsfragen als Auslegungsmaßstabzu einer freiheitlichen Auffassung auswirken. Zurecht ergibt sich hieraus die viel zitierte Auslegungsregel in dubio pro libertate .[22] Eine andere Auffassung vertritt lediglich Simonsen, der argumentiert, dass der Freiheitsanspruch auf rein wirtschaftspolitisch motivierte Beschränkungen zugeschnitten sei und für sicherheitspolitisch motivierte Beschränkungen einen Fremdkörper darstelle.[23] Diese Beschränkung ergibt sich jedoch weder aus der Gesetzesbegründung des historischen Gesetzgebers noch aus dem Wortlaut der Vorschrift, und erst recht nicht vor dem genannten grundrechtsdogmatischen Hintergrund. Nach der Gesetzesbegründung „hat der in S 1 festgelegte Grundsatz der Freiheit unmittelbare rechtliche Bedeutung, in dem er als Auslegungsmaßstab bei allen Zweifelsfragen sich zugunsten einer freiheitlichen Auffassung auswirken muss. Die Betonung des Grundsatzes der Freiheit im Gesetz soll den Leitgedanken der Art 2 Abs 1, Art 12 Abs 1, Art 14 GG, die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung zu gewährleisten, für das Gebiet des Außenwirtschaftsverkehr besonders herausstellen.“[24] Überdies wurde der Auslegungsgrundsatz in dubio pro libertate auch gerichtlich bestätigt.[25]
13
Das Liberalitätsprinzip bedeutet zweitens, dass Ausnahmen nur unter strikter Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzesmöglich sind.[26] Dieser ist sodann in § 8gesetzlich niedergelegt und konkretisiert.[27] Drittens hat es zur Folge, dass auf die Erteilung von Genehmigungen ein Anspruchbesteht, der gerichtlich durchsetzbarist. Dies ist wiederum in § 8niedergelegt. Entsprechend haben die Gerichte in der Vergangenheit sowohl Bescheidungs-[28] als auch Verpflichtungsurteile[29] erlassen. Viertens trägt die Bundesrepublik Deutschland aufgrund des Liberalitätsprinzips zudem die Darlegungs- und Beweislastdafür, dass von ihr veranlasste Beschränkungen rechtmäßig sind.[30]
IV. Einschränkungen durch oder aufgrund des AWG ( Abs 1 S 2)
14
Das Leitprinzip der Außenwirtschaftsfreiheit gilt nicht ohne Ausnahmen. Zu diesem Zweck sieht Abs 1 S 2vor, dass sowohl durch das AWG als auch aufgrund des AWG oder durch Rechtsverordnung aufgrund des AWG Beschränkungen vorgeschrieben werden. Bei dem AWG handelt es sich um ein Rahmengesetz, das die meisten Beschränkungen nicht selbst anordnet. Lediglich in §§ 6und 7enthält es die Rechtsgrundlagen für Einzeleingriffe durch Verwaltungsakt. Im Übrigen sind die Einschränkungen in einer Rechtsverordnung aufgrund des AWG geregelt, nämlich in der AWV.[31] Die Gründe, aus denen Beschränkungen von Rechtsgeschäften und Handlungen bzw Handlungspflichten auferlegt werden, sind in §§ 4und 5niedergelegt. Insbesondere sind dabei die folgenden Rechtsgüter genannt: die wesentlichen Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland; das friedliche Zusammenleben der Völker; die auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland; die öffentliche Ordnung oder Sicherheit; bzw die Gefährdung der Deckung des lebenswichtigen Bedarfs im Inland. Außerdem können EU-Embargomaßnahmen, Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und zwischenstaatliche Vereinbarungen umgesetzt bzw durchgeführt werden. Beschränkungen können insbesondere in Form von Genehmigungserfordernissen oder von Verboten angeordnet werden. Während die AWV in der Regel Genehmigungserfordernisse enthält, enthalten die EU-Embargoverordnungen tendenziell eher Ein- und Ausfuhrverbote.[32]
V. Verhältnis zu anderen Regelungen
15
Abs 2stellt klar, dass andere Regelungen unberührtbleiben. Somit entfaltet eine Genehmigung nach dem Außenwirtschaftsgesetz keine Konzentrationswirkungin dem Sinne, dass nach anderen gesetzlichen Regelungen erforderliche Genehmigungen entbehrlich wären.[33] Als Hintergrund nennt die Gesetzesbegründung die Rechtssystematik.[34] Aufgrund der Vielgestalt der Sachverhalte sollte bzw konnte das AWG in diesem Sinne keinen vollständigen Anspruch haben. Abs 2differenziert nach Vorschriften in anderen nationalen Gesetzen und Rechtsverordnungen (Nr 1) zwischenstaatliche Vereinbarungen mit Gesetzesrang (Nr 2), sowie Sekundärrecht supranationaler Organisationen (Nr 3).
1. Andere nationale Gesetze und Rechtsverordnungen ( Abs 2 Nr 1)
16
Unberührtbleiben erstens Vorschriften in anderen Gesetzen und Rechtsverordnungen. An welche Vorschriften der Gesetzgeber hier dachte, wird in der Gesetzesbegründung klargestellt.[35] Darin sind das Zoll- bzw Verbrauchssteuerrecht ebenso genannt wie das Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisation[36] sowie Gesetze aus dem Gesundheitsbereich. Ferner genannt ist das Kriegswaffenkontrollgesetz (KWKG), das in Art 26 Abs 2 S 2 GG vorgesehen ist.[37] Zumindest für den Bereich des KWKG hätte es sich angeboten, entweder im KWKG oder im AWG eine Konzentrationswirkung vorzusehen, denn hierbei handelt es sich inhaltlich um sachnahe Materien.[38]
17
Beschränkungen außerhalb des AWG enthält auch das Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgüter gegen Abwanderung.[39] Schließlich verweist das Bundesverwaltungsgericht darauf, dass auch das Kreditwesengesetz[40] zu diesen Vorschriften gehört.[41]
2. Zwischenstaatliche Vereinbarungen
18
Auch zwischenstaatliche Vereinbarungen bleiben von den Vorschriften des AWG unberührt. Voraussetzungist allerdings, dass der Bundestag gem Art 59 Abs 2 GG zugestimmt hat. Derartige völkerrechtliche Verträge, die gem Art 59 Abs 2 GG durch ein Zustimmungsgesetz gebilligt wurden, haben nach einhelliger Auffassung Gesetzesrang, stehen also mit dem AWG auf gleicher Stufe.[42] Zu diesen Verträgen gehören etwa die WTO-Verträge,[43] das Abkommen über den internationalen Währungsfonds[44] oder etwa der Atomwaffensperrvertrag, das Chemiewaffenübereinkommen, das Biowaffenübereinkommen oder das Washingtoner Artenschutzübereinkommen.[45] Hierzu gehören auch die Verträge über die Europäische Union,[46] die allerdings dem deutschen Recht im Wege des Anwendungsvorrangs vorgehen.
Читать дальше