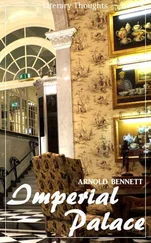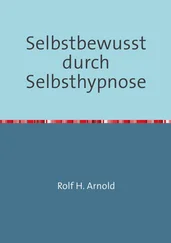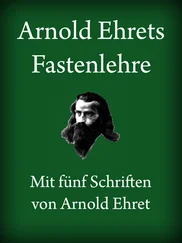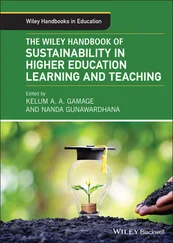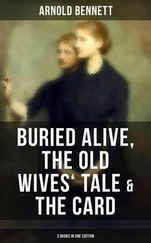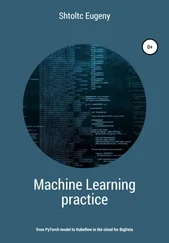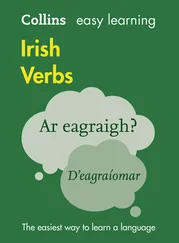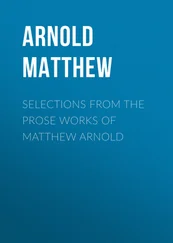Hinweise auf Strategien, Stufen und Faktoren der Produktion, Organisation und Implementierung virtueller Bildungsangebote zur Erzielung und Sicherung ihrer Nachhaltigkeit in Hochschulen, Bildungszentren, Unternehmen, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und Schulbildung (Kap. 12).
Den Rahmen bilden die Kapitel 2 und 12 zum Einsatz von E-Learning: Wie kann überhaupt Bildung mit E-Learning ermöglicht werden? Und: Unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Gestaltungsoptionen lassen sich virtuelle Bildungsangebote nachhaltig entwickeln? Die Grundüberlegungen zu Bildung mit E-Learning bestimmen die konstitutiven Faktoren erfolgreicher, in die Lern- und Arbeitsfelder integrierter Bildungsprozesse und begründen die zentralen Handlungsfelder für die Bildungsangebote. Die resümierenden Ausführungen zur Implementierung greifen diese Gedanken auf und verankern sie mit Empfehlungen zu den einzelnen Handlungsfeldern in einem strategischen Nachhaltigkeitskonzept.
Jedes Kapitel behandelt das jeweilige Handlungsfeld in ähnlicher Weise: Im Sinne einer Akteursperspektive werden Tätigkeitsprofile für das Feld identifiziert und ein Überblick über die Ergebnisse aktueller Forschung und Praxis gegeben. Aus Forschungsergebnissen und vielfältigen Praxisbeispielen wird in der Regel ein positiver Entwurf in Form von Hinweisen, Handlungsschritten oder Leitlinien entwickelt. Schlussfolgerungen und Empfehlungen fassen die zentralen Aussagen am Ende eines jeden Kapitels noch einmal zusammen.
Herausforderung Begriffsvielfalt
Beim Schreiben dieser um die aktuellen Entwicklungen erweiterten Fassung des Handbuches standen wir immer noch vor einem grundsätzlichen Problem: Im Themenbereich E-Learning existiert eine große Begriffsvielfalt, und durch die konsumierende und produzierende Nutzung der Instrumente des Web 2.0 und von mobilen Endgeräten zum individuellen Lernen am jeweiligen Aufenthaltsort sowie durch die Entwicklung von Massive Open Online Courses (MOOCs) sind noch viele weitere Begriffe hinzugekommen. Für viele Teilbereiche hat sich noch kein einheitlicher Sprachgebrauch etabliert. Bereits die oben verwendeten Begriffe E-Learning, virtuelle Bildungsangebote und virtuelle Bildungsräume sind kaum präzise zu definieren. Alternativ könnte auch von telematischen Lehr- und Lernformen gesprochen werden. Denn um Lehr- und Lernformen zu benennen, die Tele kommunikationstechnik und Infor matik nutzen, z. B. über Computer mit Internetanschluss, ist das Adjektiv telematisch präziser als virtuell. In früheren Publikationen haben wir deswegen auch das Adjektiv telematisch dem Adjektiv virtuell vorgezogen (Arnold 2001; Zimmer 1997), jedoch hat es sich nicht durchgesetzt. Inzwischen hat das Adjektiv virtuell, z. B. in Publikationen zum virtuellen Lernen (Schulmeister 2001), die ursprüngliche Konnotation des Nichtrealen verloren. Wir verwenden daher virtuell in den herausgebildeten gängigen Zusammensetzungen, wie z. B. virtuelle Bildungsangebote, die sehr reale Neuerungen darstellen. Dementsprechend klären wir in jedem Kapitel die Begrifflichkeiten und verwenden dann den Begriff, der entweder fachlich am präzisesten ist oder am häufigsten benutzt wird. Denn gerade in einem Handbuch, das allen einen leichten Zugang zum Thema verschaffen soll, wollen wir keine begrifflichen Hürden aufbauen. Wir folgen deshalb meist dem herausgebildeten Sprachgebrauch.
Abgrenzungen: Was das Handbuch nicht bieten kann
Mit der Hervorhebung der didaktischen Perspektive sind auch Abgrenzungen verbunden: Das Handbuch liefert keine technischen Detailinformationen, z. B. zu Lernplattformen, Autorenwerkzeugen oder Produktionsprozessen. Ebenso wenig können für alle möglichen unterschiedlichen Bildungsangebote ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Planung, Produktion und Durchführung gegeben werden. Auch detaillierte Informationen für eine betriebswirtschaftliche Kostenrechnung zu virtuellen Bildungsangeboten sind aufgrund der Vielfalt der möglichen Varianten nicht möglich. In den einzelnen Handlungsfeldern (und damit in den einzelnen Kapiteln des Handbuchs) werden vielmehr die Bedeutung technischer Details sowie die Voraussetzungen, Anforderungen und Handlungsschritte aus didaktischer Perspektive aufgezeigt. Für Kostenkalkulationen werden zentrale Faktoren aufgezeigt, ohne aber präzise Zahlen anzugeben, da diese ohnehin je nach Rahmenbedingungen stark variieren. Für Details zu diesen Aspekten verweisen wir auf weiterführende Literatur, die wir in die einzelnen Kapitel integriert haben. Die Quellen, die wir im Literaturverzeichnis benennen, ermöglichen den Leserinnen und Lesern eine eigene, weiterführende Recherche. Die in den Kapiteln verwendeten Abkürzungen und Fachbegriffe haben wir am Schluss in einem eigenen Verzeichnis zum schnellen Auffinden zusammengestellt.
1)Erwägungen zur besseren Lesbarkeit haben auch unsere Entscheidung zur Verwendung männlicher und weiblicher Bezeichnungen geprägt. Inhaltlich halten wir es für sinnvoll, die Beteiligung beider Geschlechter an Bildungseinrichtungen durch explizite Nennung männlicher wie weiblicher Berufsbezeichnungen etc. sichtbar zu machen (siehe Gender Mainstreaming in Kap. 4.3.4). Um den Lesefluss dennoch zu gewährleisten, haben wir aber häufig geschlechtsneutrale Formen, wie z. B. Lehrende oder Studierende, verwendet und nur gelegentlich beide Geschlechter explizit genannt. Im Literaturverzeichnis werden die Vornamen ausgeschrieben, um auch hier die Beteiligung beider Geschlechter an der Entwicklung von E-Learning hervorzuheben.
2 Bildung mit E-Learning
Bildung mit E-Learning zum Erfolg führen – für alle!
Wie sind erfolgreiche Lehr- und Lernprozesse zum Erwerb fachlicher, ganzheitlicher, verallgemeinerter und expansiver Handlungskompetenzen mit E-Learning zu erreichen? Wie kann E-Learning genutzt werden, um neue Zugänge zu Bildung zu ermöglichen und Inklusion und eine offene Bildung für alle zu unterstützen? Wie ist dafür E-Learning zu gestalten, damit die beabsichtigten individuellen, kooperativen und partizipativen Bildungsprozesse effektiv und effizient zur humanen Bildung des Subjekts unterstützt werden? Dies sind die zentralen Ausgangsfragen und Ziele für die Unterstützung von Kompetenzentwicklung und Bildung mit E-Learning. Denn mit den digitalen Bildungsmedien, den virtuellen Bildungsräumen und der Entwicklung vom Lese- zum Lese-und-Schreib-Internet werden die traditionellen pädagogischen Verhältnisse zwischen Lehrenden und Lernenden, die herausgebildeten Kulturen des Lehrens und Lernens sowie die bisher vor allem durch die Lehrenden bestimmten Lehr- und Lernprozesse grundlegend verändert zu gemeinsam und selbst organisierten Prozessen. Eine weitere Demokratisierung von Bildung für alle Menschen ist daher möglich. Subjektivität und Offenheit der Bildung jedes Menschen in der Gesellschaft zur souveränen Teilhabe an der Aneignung und Gestaltung der Welt sind das Leitprinzip des Lehrens und Lernens (Zimmer 2013).
Um diese Veränderungen begreifen, gestalten und nutzen zu können, ist es notwendig, zunächst die herausgebildeten neuen Begrifflichkeiten zu klären (Kap. 2.1). Ausgehend von den Erfolgen und Defiziten bisheriger virtueller Bildungsangebote (Kap. 2.2) und der generellen Klärung der konstituierenden Faktoren von Bildungsprozessen (Kap. 2.3) können die konstituierenden Faktoren für erfolgreiche virtuelle Lehr- und Lernprozesse (Kap. 2.4) bestimmt werden. Dies ist die Voraussetzung dafür zu klären, in welcher Perspektive die erforderliche Entwicklung der virtuellen Lehr- und Lernkultur zu gestalten ist (Kap. 2.5.1), wie die Potenziale virtueller Bildungsangebote zu nutzen sind (Kap. 2.5.2) und wie die Herausbildung einer neuen Lernkultur zu fördern ist (Kap. 2.5.3). Im Fazit (Kap. 2.6) werden die daraus sich ergebenden neuen Perspektiven für das Lehren und Lernen kurz angesprochen.
Читать дальше