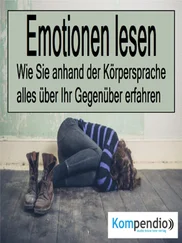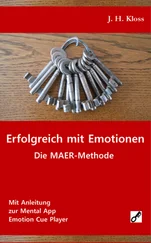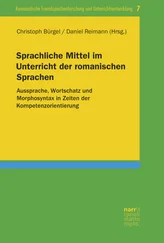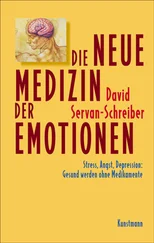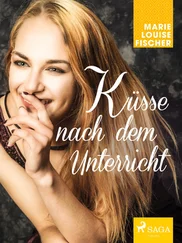Eine weitere strukturelle Eigenschaft von Emotionen ist darin zu sehen, dass sie zum einen als momentane Zustände (Zustands- bzw. state-Komponente) und zum anderen als dispositionelle Reaktionstendenzen (Bereitschafts- bzw. trait-Komponente verstanden werden können (Otto, Euler & Mandl, 2000). Folglich rufen nicht die Ereignisse selbst, sondern die subjektive Interpretation von Ereignissen bei Menschen Emotionen hervor (z. B. Scherer, Schorr & Johnstone, 2001). Damit tritt die Bedeutung von Verarbeitungs- und Reflexionsprozessen ins Blickfeld. Zum Teil sind Emotionen evolutionsbiologisch überlebensnotwendig; man denke nur an die Fluchtreaktion in gefährlichen Situationen. Überwiegend reagieren Menschen aber sehr unterschiedlich in ähnlichen Situationen. Übertragen auf Lehr-Lern-Kontexte heißt das z. B., dass in einer Lerngruppe einmal Freude über den Wissenszuwachs, ein anderes Mal Langeweile oder Ärger entstehen kann. Als eine Erklärung hierfür kann der sogenannte Appraisal-Ansatz (Scherer, Schorr & Johnstone, 2001) herangezogen werden (  Kap. 1.2). Pekrun (2000) hat in der Folge den in der Bildungsforschung häufig herangezogenen ›Kontroll-Wert-Ansatz für Lern- und Leistungsemotionen‹ entwickelt. Kontrollappraisals (im Sinne einer Einschätzung, wieviel Kontrolle man darüber hat, ob Erfolg in einer Situation herbeigeführt werden kann) und Valenzappraisals (im Sinne einer Einschätzung der positiven bzw. negativen Bedeutsamkeit oder des Werts von Erfolg bzw. Misserfolg in der jeweiligen Situation) sind für die Entstehung von Leistungsemotionen relevant. Sowohl Kontroll- als auch Valenzappraisals bestimmen die Qualität und Intensität der erlebten Emotionen (Frenzel, Götz & Pekrun, 2009;
Kap. 1.2). Pekrun (2000) hat in der Folge den in der Bildungsforschung häufig herangezogenen ›Kontroll-Wert-Ansatz für Lern- und Leistungsemotionen‹ entwickelt. Kontrollappraisals (im Sinne einer Einschätzung, wieviel Kontrolle man darüber hat, ob Erfolg in einer Situation herbeigeführt werden kann) und Valenzappraisals (im Sinne einer Einschätzung der positiven bzw. negativen Bedeutsamkeit oder des Werts von Erfolg bzw. Misserfolg in der jeweiligen Situation) sind für die Entstehung von Leistungsemotionen relevant. Sowohl Kontroll- als auch Valenzappraisals bestimmen die Qualität und Intensität der erlebten Emotionen (Frenzel, Götz & Pekrun, 2009;  Kap. 3.3).
Kap. 3.3).
Besonders Emotionen in der Schüler-Lehrer-Interaktion bzw. mit Blick auf die soziale Beziehung werden systematisch untersucht (z. B. Wild, Hofer & Pekrun, 2006). Vermehrt werden auch Emotionen von Lehrkräften fokussiert (Becker, Götz, Morger & Ranellucci, 2014). So kann sich eine Lehrkraft bspw. über störende Verhaltensweisen von Schüler*innen im Unterricht ärgern. Auch auf Seiten der Lehrkräfte spielen Kontroll- und Valenzappraisals eine Rolle (Frenzel, Götz & Pekrun, 2008). Darüber hinaus kommt der Emotionsregulierung von Lehrkräften eine wesentliche Bedeutung zu (Krause, Philipp, Bader & Schüpbach, 2008). Neben der Beeinflussung der Emotionen einer Gesprächspartnerin bzw. eines Gesprächspartners (in der überwiegender Zahl der Fälle einer Schülerin bzw. eines Schülers) durch das eigene Verhalten und gezeigte Emotionen zählen auch die Kontrolle und der Umgang mit den eigenen Gefühlen zum professionellen Handeln einer Lehrkraft (Krause et al., 2008;  Kap. 3.1).
Kap. 3.1).
1.2 Emotionen – (k)ein Thema in der Pädagogik?
Emotionen bzw. Gefühle und ihre Bedeutung im Bildungskontext sind kein neues Thema. Mit Blick auf Erziehung und Bildung wurden Emotionen immer schon berücksichtigt. Bereits in der Antike finden sich beispielsweise bei Platon, Seneca oder Aristoteles entsprechende Hinweise. So unterscheidet Aristoteles drei Teile der menschlichen Seele (vgl. Jakobi, 1981), die für jeweils unterschiedliche Verhaltensweisen des Menschen zuständig sind; und zwar den rationalen, den sensitiven und den vegetativen Seelenteil. Der sensitive Seelenteil wird als Ursache für Triebe, Affekte und Emotionen gesehen. Im Gegensatz zu den Aktivitäten des vegetativen Seelenteils wird die Kontrolle des sensitiven Seelenteils durch den Verstand als möglich und notwendig erachtet. Hieran wird die Bedeutung von Emotionen bzw. Gefühlen mit Blick auf Bildung deutlich (  Kap. 1.3).
Kap. 1.3).
In der klassischen Bildungsliteratur des 18. und frühen 19. Jahrhunderts wurde beispielsweise häufig über Gefühle und ihre Allgegenwärtigkeit im menschlichen Leben geschrieben. So bedurfte es mit Blick auf Bildung und Aufklärung nicht bloß der »richtigen Begriffe«. Ebenso wichtig war es, »reinere Gefühle […] durch alle Adern des Volks« fließen zu lassen, »Menschlichkeit und Sanftmut in unser Herz« zu senken (Schiller 1784, S. 237, S. 244 f.). Wilhelm von Humboldt spricht von der »Bildung des Gemüths« (von Humboldt, 1809, S. 189) als wichtigem Element »allgemeine[r] Menschenbildung« (ebd., S. 188). Als zentrale pädagogisch-anthropologische Neuorientierungen des 18. Jahrhunderts gelten der Blick auf die Vernunftbegabung des Menschen im Sinne Kants sowie der Gedanke der Entwicklungsplastizität und Perfektionierbarkeit des Menschen (z. B. von Rousseau).
Die beiden bekannten geisteswissenschaftlich orientierten Pädagogen Johann Friedrich Herbart (1776–1841) und Friedrich Schleiermacher (1768–1834) argumentierten, dass erzieherische Aufforderungen immer in der Gegenwart des Kindes liegen, aber immer auch auf seine Zukunft gerichtet sein sollen. Insofern können pädagogische Initiativen des Erziehenden mit den unmittelbaren Interessen und Befindlichkeiten des Kindes kollidieren. Dementsprechend stellt Herbart in seinen Vorlesungen der ›pädagogischen Liebe‹ die Autorität des Erziehers qua Aufgabe und Amt zur Seite (Herbart, 1806). Das Erziehungsmittel ›Liebe‹ gehört diesem Verständnis nach zu den vertrauensbildenden Maßnahmen, über die ein*e professionelle*r Erzieher*in zu verfügen habe. So verstanden ist Liebe nicht mehr nur, wie in der Aufklärungspädagogik, Mittel des Erziehungsprozesses, sondern zugleich auch implizit ein Erziehungsziel. Erst die Kombination aus pädagogischer Autorität und Liebe kann nach dieser Argumentation dem pädagogischen Handeln eine dauerhaft feste Basis geben (vgl. Herbart, 1806, S. 49). Die Diskussion um »Liebe als Ziel von Erziehung« gewann in der Folge, insbesondere in der Jugendbewegung und der beginnenden Reformpädagogik nach 1900, eine weitere Bedeutung. Erziehung wurde als Begegnung und Bildungsgemeinschaft zu einem Hauptthema. Beziehungsmerkmale wie Liebe, Vertrauen, Zuwendung, aber auch Eifersucht, Misstrauen und Enttäuschung zwischen Erziehendem und Zögling sowie pädagogische Autorität werden mit dem Gedanken der Bildung als Persönlichkeitsentwicklung verbunden (vgl. Oelkers, 2001).
Für einen der bedeutendsten Pädagogen, nämlich Johann Heinrich Pestalozzi, sind Gefühle des Kindes ernst zu nehmen und gelten als eine notwendige Voraussetzung für das Lernen mit »Kopf, Herz und Hand« (Kraft, 1996; Seichter, 2007, S. 77). Erziehung unterstützt die Entfaltung sittlicher Grundgefühle der Liebe, des Vertrauens und der Dankbarkeit auf Seiten des Kindes. Neben diesen »Herzenskräften« gilt es, auch die intellektuellen (geistigen) und die handwerklichen Kräfte zu entfalten (Pestalozzi, 1801). Der Reformpädagoge Peter Petersen war ebenfalls bestrebt, in seiner Lehr- und Lernanstalt eine emotionale Geborgenheit zu schaffen, indem er sie in eine Lebensgemeinschaftsschule umwandelte. Dementsprechend ist die Jena-Plan-Schule (Petersen, 1927–1949) an der »ganzen Person« des Kindes interessiert, d. h. auch emotionale Faktoren des Lebens und Lernens finden ihre Berücksichtigung. Auch Hermann Nohl (1924, 1925) hat eine der wichtigsten lernförderlichen Emotionen, nämlich die Freude, zum Kriterium jeder gelungenen pädagogischen Leistung erhoben. In der reformpädagogischen Bewegung wurde versucht, durch die emotionale Aufladung der pädagogischen Beziehung Elemente der sich auflösenden gesellschaftlichen Sozialformen zu bewahren und in Form des »pädagogischen Bezugs« zu institutionalisieren. Generell wurden die Dynamiken der Beziehung als wesentliche Bedingungen pädagogischer Prozesse hervorgehoben. So betont Litt beispielsweise die unauflösbare Dialektik von Führen und Wachsenlassen, Behüten und Freigeben, Unterstützen und Schützen, in der Erziehungsverhältnisse und -handlungen stehen (Litt, 1927).
Читать дальше
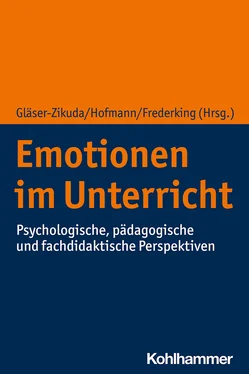
 Kap. 1.2). Pekrun (2000) hat in der Folge den in der Bildungsforschung häufig herangezogenen ›Kontroll-Wert-Ansatz für Lern- und Leistungsemotionen‹ entwickelt. Kontrollappraisals (im Sinne einer Einschätzung, wieviel Kontrolle man darüber hat, ob Erfolg in einer Situation herbeigeführt werden kann) und Valenzappraisals (im Sinne einer Einschätzung der positiven bzw. negativen Bedeutsamkeit oder des Werts von Erfolg bzw. Misserfolg in der jeweiligen Situation) sind für die Entstehung von Leistungsemotionen relevant. Sowohl Kontroll- als auch Valenzappraisals bestimmen die Qualität und Intensität der erlebten Emotionen (Frenzel, Götz & Pekrun, 2009;
Kap. 1.2). Pekrun (2000) hat in der Folge den in der Bildungsforschung häufig herangezogenen ›Kontroll-Wert-Ansatz für Lern- und Leistungsemotionen‹ entwickelt. Kontrollappraisals (im Sinne einer Einschätzung, wieviel Kontrolle man darüber hat, ob Erfolg in einer Situation herbeigeführt werden kann) und Valenzappraisals (im Sinne einer Einschätzung der positiven bzw. negativen Bedeutsamkeit oder des Werts von Erfolg bzw. Misserfolg in der jeweiligen Situation) sind für die Entstehung von Leistungsemotionen relevant. Sowohl Kontroll- als auch Valenzappraisals bestimmen die Qualität und Intensität der erlebten Emotionen (Frenzel, Götz & Pekrun, 2009;