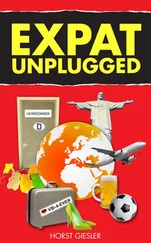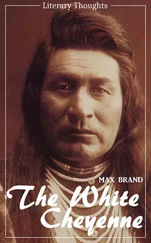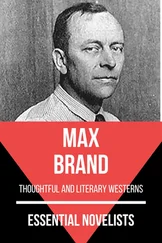Ich dachte, er würde gleich losbohren, aber Asis sagte, es handle sich nur um eine kurze kostenfreie Voruntersuchung.
Nach Aussage des Zahnarztes mussten die Wurzelkanäle erneut behandelt werden, der Zahnstumpf präpariert und darauf eine Krone angepasst werden. Für diese bot er mir zwei Varianten an: die hier übliche Halbmetallkrone für fünfzehn Euro; oder die stabilere, ansehnlichere, aber weitaus teurere Vollkeramikkrone für 200 Euro. Wir teilten dem Zahnarzt mit, über sein Angebot nachzudenken, und verließen die Praxis.
Im düsteren Treppenhaus hätten die Reaktionen von Asis und Saber zu meiner kaum unterschiedlicher sein können. Gerade das erste Angebot für fünfzehn Euro erschien mir beängstigend günstig, Asis und Saber hingegen prangerten den Preis von 200 Euro für die Vollkeramikkrone als maßlos überteuert an. Nicht leugnen konnte man jedenfalls die außergewöhnlich hohe Preisdifferenz zwischen beiden Varianten, weshalb wir uns darauf einigten, noch weitere Zahnärzte zu Rate zu ziehen.
Im Laufe des Nachmittags stellte sich nach und nach heraus, dass der erste Zahnarzt im Vergleich zu den anderen tatsächlich deutlich teurer war, allerdings befanden sich deren Praxen in einem noch schlechteren Zustand. Oft arbeiteten sie ganz ohne Zahnarzthelfer, die Räumlichkeiten waren meist spärlich und wirkten improvisiert. Schlussendlich und nach Abwägung aller Angebote entschied ich mich für die teurere Variante des ersten Zahnarztes.
Gleichzeitig drängte sich die Frage auf, woher ich das viele Geld nehmen sollte. Um all meine Ersparnisse – zu diesem Zeitpunkt wären sie wohl knapp an die 200 Euro rangekommen – für die Zahnbehandlung auszugeben und ohne Geldreserven weiterzureisen, dafür hatte ich im Nahen Osten und in einem Land wie Syrien zu große Bedenken.
Ein anderer Umstand bot jedoch bereits die Lösung an. Mein Reisepass war nur noch bis Ende August gültig. Ich benötigte demnach zeitnah einen neuen Pass. Den hatte ich auch kurz vor der Reise beantragt, und er lag schon zu Hause bei meiner Mama bereit, um mir zugeschickt zu werden.
Allerdings war das mit dem Schicken so eine Sache. Offiziell dürfen Pässe oder Ausweise nicht per Post versendet werden. Also lag die Idee nahe, mir zusammen mit meinem neuen Pass das Geld für die Zahnbehandlung schicken zu lassen. So günstig wie im Moment würde die Situation wohl nicht mehr so schnell werden – ich hatte ein mehr oder weniger festes Zuhause und darüber hinaus genügend Zeit, um auf ein Päckchen warten zu können.
Um all das zu organisieren, rief ich das erste Mal während meiner Reise zu Hause an. Ich benutzte ein öffentliches Münztelefon auf der gegenüberliegenden Straßenseite unseres Wohnblocks – alt und mitgenommen sah es aus, und dementsprechend schlecht war die Verbindung. Der Straßenlärm im Hintergrund tat sein Übriges. Bei meinem ersten Versuch ging nur der Anrufbeantworter ran. Erst ein paar Stunden später hatte ich mehr Glück.
Man kann sich vorstellen, wie eine Mutter in so einem Moment reagiert. Es ist schwer zu sagen, ob ihre Überraschung oder ihre Freude überwog, jedenfalls fielen die Münzen viel zu schnell durch den Apparat. Nach knappen zwei Minuten mussten wir unser Gespräch beenden.
Die Zeit bei Asis verging wie im Flug. Er kümmerte sich sagenhaft um mich – Tag für Tag wurde ich bekocht, und er ließ es mir an nichts fehlen. Einmal übertrieb er es ein bisschen und wusch in meiner Abwesenheit meine gesamte Wäsche.
Bald nahm ich, nachdem ich mich mit dem Verlust meines Tagebuchs abgefunden hatte, meine Aufzeichnungen wieder in Angriff. Ab sofort wollte ich digital weiterschreiben. Das hatte den großen Vorteil, dass ich in Zukunft die Texte als E-Mail an mich selbst verschicken konnte und nicht mehr Gefahr lief, sie erneut zu verlieren.
Die musikalische Arbeit mit Saber verlief äußerst zäh und etwas unbefriedigend. Dabei konnten sich die Ergebnisse unserer Probenarbeit durchaus hören lassen. Größtes Hindernis waren schlicht und ergreifend die Differenzen in unserem Musikgeschmack. Er stand auf französische Chansons: Je herzzerreißender sie waren, desto besser. Meine musikalische Toleranz wurde ernsthaft auf die Probe gestellt.
Weitere Schwierigkeiten brachte die katastrophale Probenmoral der beiden anderen mit sich. Dass feste Uhrzeiten ausgemacht werden, hatte ich ja gar nicht erwartet, aber dass sie sich nicht mal an ganze Tage hielten, daran konnte ich mich nicht gewöhnen. So kam es vor, dass ich, nachdem wir uns für einen Nachmittag verabredet hatten, oft stundenlang wartete und selbst am späten Abend immer noch keiner von beiden da war.
Saber plante, uns bei einem Musikwettbewerb anzumelden, der in ein paar Wochen in Damaskus stattfinden sollte. Dieses Ziel tat uns gut, unsere Probenarbeit bekam mehr Ernsthaftigkeit, und die Proben wurden disziplinierter.
Der andere Gitarrist war ein junger sympathischer Iraker, der sein Instrument beherrschte. Er hatte sich auf Flamenco spezialisiert. Konnte ich ihn überreden, ein Solostück vorzuspielen, blickte ich gebannt zu, wie seine Finger elegant übers Griffbrett sausten.
Nur wenige hundert Meter von Asis’ Wohnung entfernt lag das Christenviertel Bab Tuma. Es war ebenfalls Teil der alten Stadt, doch in jeglicher Hinsicht »westlicher« orientiert als das übrige Damaskus. Die Geschäfte blieben freitags geöffnet und schlossen stattdessen am Sonntag, Frauen ohne Kopftuch waren schon annähernd in der Überzahl, statt Moscheen gab es Kirchen, und man konnte in einigen Läden sogar Schweinefleisch und Alkohol kaufen.
Dort, gegenüber einer armenischen Kirche, fand ich den perfekten Platz. Es kamen viele Passanten vorbei, und die Anwohner freundeten sich offensichtlich schnell mit meiner Musik an.
Bevor ich mich ausschließlich auf den Standort in Bab Tuma beschränken wollte, probierte ich – eher interessehalber – noch einige andere Gegenden aus. Es war beeindruckend, wie unterschiedlich die Reaktionen der Passanten in den verschiedenen Vierteln ein und derselben Stadt sein konnten: An einem Feiertag spielte ich im Suq al-Hamidiya, dem großen Markt. Wir hatten den 17. April, den Nationalfeiertag zur Ausrufung der Syrischen Arabischen Republik im Jahre 1946, welche die 35-jährige Besetzung durch die Franzosen beendete. Alle Geschäfte hatten geschlossen. Ich platzierte mich im tunnelförmigen Hauptarm des Marktes. Kurz überlegte ich noch, ob es doch gescheiter gewesen wäre, auf die Ratschläge von Wasim und Asis zu hören und lieber nicht hier zu spielen – aber meine Neugier war größer.
Obwohl an dem Feiertag vergleichsweise wenige Menschen unterwegs waren, standen bereits nach dem ersten Stück die Menschen dicht an dicht um mich herum. Nicht wie sonst zehn, zwanzig oder vielleicht mal vierzig, nein – es waren Hunderte. Im ersten Moment war ich mit mir und der Situation mehr als zufrieden und spielte nach Mrs. Robinson gleich noch einen Kracher: Bye, bye Love , Everly Brothers. Doch dann wurde es zu viel des Guten. Das Publikum hatte nicht die geringsten Berührungsängste, die erste Reihe stand wenige Handbreit vor mir und kam stetig näher. Dass meine Mütze vor mir lag, war in dem Tumult vollkommen untergegangen. Die Menge klatschte, tanzte und sang mit oder sah mir nur verwundert und ungläubig zu. Immer wieder schrien mir einzelne Zuhörer etwas Arabisches zu. Als die ersten so eng bei mir standen, dass ich kaum noch spielen konnte, kürzte ich das Stück ab, um dem ekstatischen Treiben ein Ende zu bereiten. Ich verschaffte mir mehr Platz und versuchte, mit einem langsamen Lied wieder Herr der Lage zu werden – doch weit gefehlt. Die Menge wollte jetzt natürlich noch mehr Stimmungsmacher hören, und während ich ständig aufgefordert wurde, dieses oder jenes zu spielen, schnappte ich kurzerhand meine Mütze und meine Gitarrentasche, sagte, ich müsse ganz, ganz dringend wohin, und flüchtete, so schnell ich konnte.
Читать дальше