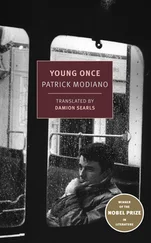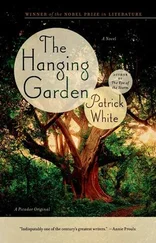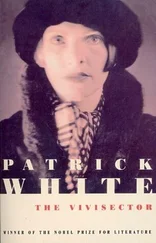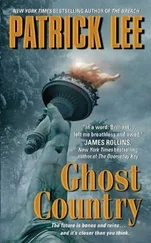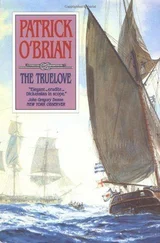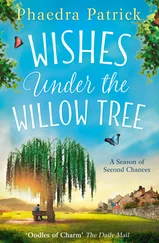FREITAG, 14. FEBRUAR 2020
Es ist Valentinstag. Alle Zeitungen und Fernsehwerbungen sind voll von Blumen, Schokolade und Liebenden, die sich küssen und umarmen. Für mich hat der Valentinstag heuer einen Strauß voller Sorgen, Angst und auch Panik parat. Langsam verankern sich in mir die Gedanken daran, was in den nächsten Monaten auf mich zukommen wird. Wobei es nach dem Aufwachen immer ein paar Stunden dauert. Ist das wirklich alles passiert? Habe ich das nur geträumt? Diese Fragen stellen sich mir nur kurz, denn das riesige Pflaster auf meinem Hals, an jener Stelle, an der man mir einen der bösen Lymphknoten entfernt hat, gibt mir recht schnell eine klare Antwort. Das Gefühl in mir ändert sich fast stündlich und kommt und geht in Wellen. Abwechselnd denke ich: »Ich schaffe das schon. Es hätte mich noch viel schlimmer erwischen können«, und: »Ich habe keine Kraft für das alles und es wäre besser, einfach vor ein Auto zu laufen und sich das Ganze zu ersparen.«
Fast minütlich melden sich Freunde und Familie bei mir. Alle von ihnen haben natürlich das Wort »Hodgkin« gegoogelt. Ich merke, dass ihnen die Informationen, die sie bei Dr. Google gelesen haben, Zuversicht und Beruhigung geben. Ich habe mir das Recherchieren im Internet dazu ab sofort verboten. Ich kenne mich. Statt die vielen positiven Infos und guten Krankheitsverläufe zu lesen, würde ich mir das Schlimmste herauspicken und in meinem Hirn wie ein Postit festkleben. Deshalb lass ich es lieber. Ich habe heute aus dem Bauch heraus allerdings zwei Entscheidungen getroffen.
Erstens: Ich möchte meine Genesung nicht zu Hause absolvieren. Ich habe die letzten Monate dort zu oft zu schlecht geschlafen, mir zu viele Sorgen gemacht und nicht zuletzt auch die Diagnose sitzend an unserem gläsernen Esstisch erfahren. Ich muss da raus, brauche einen Tapetenwechsel. Eine Stunde von Wien entfernt haben meine Eltern seit zwanzig Jahren ein kleines Haus mit großem Garten. Viele schöne, unbeschwerte Stunden habe ich als Kind dort verbracht. Ostern ist nach wie vor ein Fixtermin, an dem sich die ganze Familie in Pitten trifft. Der Gedanke an diesen Ort, den Garten, die gute Luft und die Natur lässt in mir seit langem so etwas wie ein Wohlgefühl aufkommen. Hier möchte ich mich erholen, Kraft tanken und Freunde und Familie empfangen.
Die zweite Entscheidung setze ich gemeinsam mit Alexander gleich in die Tat um: Ich lasse mir die Haare abrasieren. Ich eitler Kerl, der täglich 15 Minuten vor dem Spiegel verbringt, um seine Frisur mit Haarwachs in die richtige Form zu bringen. Ich kann meinen Entschluss selbst nicht glauben. Aber es ist Intuition. Ich weiß, mir werden die Haare ausfallen, doch statt darauf zu warten möchte ich zumindest in diesem Punkt das Heft – beziehungsweise den Rasierer – selbst in der Hand haben. In unserem Badezimmer greift Alexander zum Bartschneider und legt los. Mit dem surrenden Geräusch im Hintergrund sehe ich nach und nach, wie meine pechschwarzen Haarsträhnen auf den Boden fallen. Ich sitze mit dem Rücken zum Spiegel und habe Angst vor dem Ergebnis. Leider sind unsere Bartschneider nicht besonders scharf, deshalb müht sich mein Aushilfsfriseur redlich damit ab, wirklich alle Haare zu erwischen. Beim richtigen Friseur wollte ich das nicht machen lassen, dieses Ritual schien mir dafür zu privat.
Nach etwa zwanzig Minuten ist meine »neue Frisur« fertig. Voller Aufregung in den Knochen schaue ich in den Spiegel und bin überrascht. So schlimm schaut es gar nicht aus. Gar nicht so krank, wie ich es mir ausgemalt habe. Mein Bart, den ich seit meinem 18. Lebensjahr trage, ist zu diesem Zeitpunkt noch da. Weil ich aber weiß, dass auch dieser ausfallen wird, greife diesmal ich zum Rasierer und mache kurzen Prozess. Mit viel Schaum und Wasser rasiere ich mir nach und nach mein Markenzeichen ab. Ich schaue in den Spiegel und blicke prüfend in mein »neues Gesicht«. Jünger schaut es aus, sehr ungewohnt, aber zum Glück nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich mache ein Selfie von mir und schicke es mit #newstyle in unsere WhatsApp-Familiengruppe. Binnen Minuten poppen die Antworten meiner Eltern und Brüder auf und alle sind sich einig: Ich schaue aus wie die junge Version meines Vaters. Da hätte mir wahrlich Schlimmeres passieren können.
Der kleine Koffer ist gepackt. Normalerweise verwende ich ihn für kurze Städtetrips oder Wellness-Wochenenden, die wir gerne machen. Diesmal ist es leider alles andere als ein Urlaub mit Sauna, Dampfbad und Massage, für den ich Trainingsanzug, Waschzeug und meinen Laptop einpacke. Heute wird es ernst. Um 8 Uhr haben mich die Ärzte auf die Abteilung für Onkologie des Kaiser-Franz-Josef-Spitals bestellt. 3. Medizinische Abteilung, Station D. Die Nacht war recht kurz, vor lauter Aufregung konnte ich wenig schlafen. Auch das Frühstück schmeckt mir nicht so richtig.
Kurz vor halb acht machen Alexander und ich uns auf den Weg. Hunderte Male bin ich diese Strecke schon gefahren. In die Richtung, in die wir heute abbiegen, allerdings noch nie. Als mit einem Druck auf den automatischen Öffner die Türe zur Station aufgeht, wiederholen sich die Bilder, die ich schon wenige Tage zuvor gesehen hatte. Hauptsächlich ältere, krank aussehende Menschen, die an einen Tropf angehängt durch den zwar modern gebauten, aber eher geschmacklosen Gang wandeln oder zusammengekrümmt in einem Bett liegen. Die äußerst sympathische und energisch wirkende Stationsschwester begleitet Alexander und mich zum »Tagesraum«, ein Abschnitt mitten am Gang mit einigen Tischen und Stühlen und einer kleinen Kaffeebar, an der es auch Obst gibt. Neben uns sitzen einige ältere Herren, ebenfalls mit gepackten Taschen. Die meisten von ihnen dürfen heute nach Hause gehen, erfahre ich durch ihre Gespräche, die sie in ziemlich hoher Lautstärke führen. Der Patient neben uns, ein Mann um die sechzig mit schütterem Haar, sorgt bei uns zumindest kurzzeitig für einen Lacher. Denn plötzlich legt er die kleine Boulevardzeitung, die er eben noch gelesen hatte, zur Seite und beginnt, sich mitten auf der onkologischen Station die Nägel zu schneiden. Seine abgezwickten Nägel wischt er mit dem Handrücken einfach auf den Boden. Alexander setzt schon an, sich darüber lauthals zu echauffieren, doch ich beruhige ihn und wir nehmen es mit Humor.
Nach zweistündigem Warten ist mein Zimmer fertig. Ein Einzelzimmer mit kleinem Tisch, zwei Sesseln, einem Bett und sogar einem kleinen Balkon. Die Sonderklassenversicherung, die ich jahrelang eingezahlt habe, hat sich ausgezahlt. Auch, wenn ich sie lieber für einen etwas »angenehmeren« Spitalsaufenthalt in Anspruch genommen hätte. Als wir meine Sachen auspacken und uns einrichten, wird mir alles plötzlich viel bewusster. Ich bin wirklich im Krankenhaus, ich habe wirklich Krebs und morgen beginnt eine kräftezehrende und anstrengende Therapie. Sowohl der Chefarzt der Onkologie, der mich seit meinem ersten Besuch hier betreut hat, als auch der Stationsarzt klären mich noch einmal über die möglichen Nebenwirkungen auf. Die Haare werden mir ausfallen, meine Haut wird empfindlich auf Sonne reagieren, meine Schleimhaut im Mund anfällig für Infektionen und mein Sperma unfruchtbar. Ein Rundum-Sorgenpaket, das mit der Chemotherapie frei Haus mitgeliefert wird.
Auch meine Heilungschancen sind wieder Thema. Sie liegen bei neunzig Prozent. Kein schlechter Schnitt eigentlich, aber wenn einen diese Möglichkeit, zu den übrigen zehn Prozent zu gehören, plötzlich selbst betrifft, fühlt sich das schon ganz anders an. Auch wenn ich weiß, dass es auch bei viel harmloseren Krankheiten eine ähnlich hohe Wahrscheinlichkeit zu sterben gibt, die Angst davor ist in mir nach wie vor groß.
Doch bevor der Kampf gegen die bösen Zellen beginnen kann, muss ich noch einen kleinen Eingriff über mich ergehen lassen. Ein sogenannter »Port-a-Cath« wird mir eingesetzt. Ein kleines, grau-weißes rundes Teil, das mir in der Brust unter die Haut eingepflanzt wird und durch das die heilenden, giftigen Flüssigkeiten in den nächsten Monaten direkt in meine Venen geschossen werden können, ohne dafür ständig in die Armbeuge stechen zu müssen. Da würden die Venen nämlich über kurz oder lang irgendwann den Geist aufgeben, hat man mir erklärt.
Читать дальше