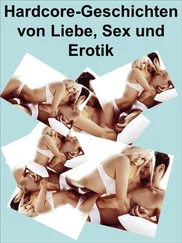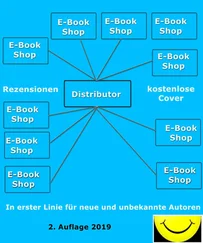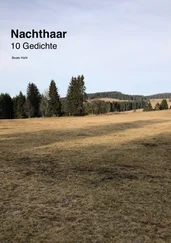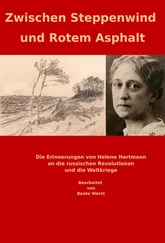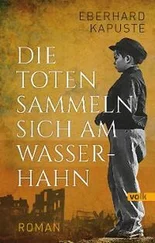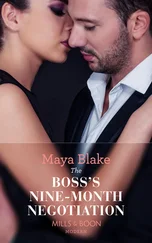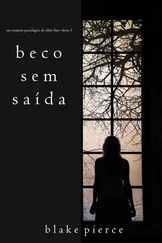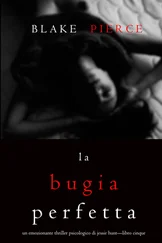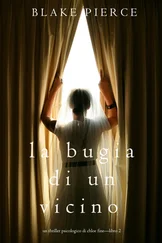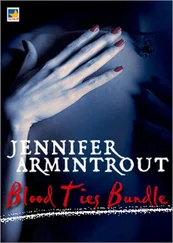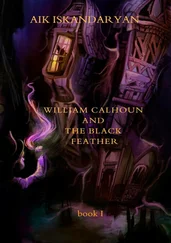Sammeln gehört zu unserer Lebenswelt und ist ein weit verbreitetes Phänomen. Sammeln kann man synonym auch als «zusammenbringen», «vereinigen» oder «anhäufen» bezeichnen. Verstreute Dinge werden an einem Ort zusammengetragen. Sammeln ist damit ein Prozess der Bewegung aufeinander zu, wobei zu unterscheiden ist, ob ein bloßes, subjektloses Geschehen vorliegt oder eine intentionale, also gewollte Handlung eines Subjekts.
Beispiele für Sammlungen ohne aktiven (menschlichen) Sammler: das Regenwasser, das sich in einer Tonne sammelt, der Staub, der sich auf einem Regal sammelt, die Vögel, die sich vor dem gemeinsamen Flug in den Süden versammeln. Im Englischen wird diese Art des Sammelns mit gathering wiedergegeben und so von der anderen Form des Sammelns – collecting – auch sprachlich abgegrenzt (Sommer 2018).
Das Sammeln, das im Englischen mit collecting ausgedrückt wird, bezeichnet eine aktive, auf ein Ziel fokussierte Handlung eines Subjekts (Sammler oder Sammlerin), bei der ausgewählte Objekte mit einer vorher festgelegten Intention zusammengetragen werden. Sammeln ist hier das Zusammenbringen von gleichen Dingen einer übergeordneten Kategorie, wie Gartenzwerge, Teekannen oder Münzen. Jede Sammlung braucht ein Begriffsetikett als Klammer, damit aus einem Sammelsuriumeine Sammlung wird. In einer Themensammlung sind solche Objekte vereint, die einem Oberbegriff zugeordnet werden können, sich dann aber wieder voneinander unterscheiden (ebd.). So gibt es in der Streichholzschachtelsammlung Zündhölzer verschiedener Firmen aus unterschiedlichen Zeitepochen. Es gibt aber auch andere Sammelkategorien, die immer genau von dem handelnden Subjekt zu begrenzen sind wie «alles von Pokémon». Es gibt auch einschränkende Sammlungsinteressen wie «Gemälde aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus Italien» oder « Briefmarken aus deutschen Kolonien bis 1918».
Manfred Sommer (2018) weist darauf hin, dass das Sammeln im Sinne von collecting entweder ökonomisch oder ästhetisch ausgerichtet sein kann. Ökonomisches Sammeln ist beispielsweise das Sammeln von Pilzen oder Beeren für den anschließenden Verzehr oder das Sammeln von Holz zur Verbrennung im Ofen. Beim ökonomischen Sammeln ist die Dauer der Sammlung begrenzt, da die Intention auf den Verbrauch und damit auf das Wieder-Verschwinden der Dinge ausgerichtet ist (ebd.). Hier geht es primär um eine Vorratshaltung: Dinge werden aufbewahrt, bis sie in ihrer Funktion eingesetzt werden (Schmidt 2016).
1Sammelsurium oder Sammlung?

2Dauermarkenserie der deutschen Kolonien

Das ästhetische Sammeln hingegen ist auf das Bewahren und das Erhalten von Gegenständen ausgerichtet. Deshalb bezeichnet Sommer (2018) den ästhetisch ausgerichteten Homo collector auch als konservativ, weil er die Dinge weiter bestehen lassen möchte, auch wenn die Funktion dieser Gegenstände in der gegenwärtigen Alltagswelt längst unbedeutend geworden ist (z. B. Nachttöpfe oder Transistorradios).
Erst der Sammler oder die Sammlerin macht aus einem ungeordneten Sammelsurium eine strukturierte Sammlung. Für ein Sammeln im Sinne von collecting sind also zwei Komponenten notwendig: sammelbare Gegenstände und ein sammelnder Mensch.
Die Mehrzahl der Menschen in deutschsprachigen Ländern gehen oder gingen wenigstens zeitweilig in einer Lebensphase einem Sammelhobby nach (Bausinger 2007) – aktuell geben 23 von 82 Millionen Deutschen an, dieser Freizeitbeschäftigung nachzugehen, also 28 Prozent der Bevölkerung (Kleine/Jolmes 2014, S. I).
Viele Menschen bezeichnen sich selbst auch als Sammler oder Sammlerin und bekennen sich damit zu ihrem Hobby und Interesse. Es hat sich heute im europäischen Kulturkreis gesellschaftlich fest etabliert, dass Menschen ausgewählte Dinge sammeln. Alles was sammelbar ist, wird auch gesammelt.
Auch wenn es keine gesicherten Zahlen gibt, wird in der Literatur darauf verwiesen, dass mehr Männer sammeln als Frauen: Angeblich soll bei Männern durch den Besitz einer Sammlung ein stärkeres Macht- und Selbstwertgefühl entstehen als bei Frauen (Dörner 2010).
Sammler und Sammlerinnen pflegen ein aktives Verhältnis zur Gegenstandswelt und tragen die Dinge, die sich in ihre thematisch begrenzten Sammlungen einfügen lassen, an einem Ort zusammen (Wilde 2015). Sie bewahren mitunter dabei die Gegenstände vor ihrer Bedeutungslosigkeit, erschaffen und retten Kulturschätze. Dieses Erhaltungsstreben ist ein wichtiger Motor von Sammelnden.
Durch das Einfügen von Objekten in eine Sammlung werden die Dinge ihrem ursprünglichen Kontext, Nutzungsbereich und oft auch ihrer Funktion entzogen, und stattdessen werden neue Zusammenhänge zwischen den Dingen einer Sammlung geschaffen und neue Erkenntnisse möglich. Es findet so eine Neubewertung der Gegenstände statt.
Die Aufnahme eines Gegenstands in eine Sammlung bewahrt vor dem Vergessen, Verschwinden oder Wegwerfen und führt die Dinge in eine zweite, zumeist passive Verwendung ihres Daseins, jenseits der ersten, ursprünglichen und aktiven Funktion (Bausinger 2007; Schmidt 2016). Ein Beispiel verdeutlicht diesen Funktionswechsel: Während ein Nussknacker in seiner ersten Funktion in einem Haushalt Menschen konkret hilft, Nüsse zum Essen zu öffnen, ist diese Funktion für den Sammler und die Sammlerin unerheblich – wer braucht schon 100 Nussknacker in einem Haushalt zum Öffnen von Nüssen?
Es ist aber nicht zu vergessen, dass es auch Sammelgegenstände gibt, die ausschließlich für Sammlungen hergestellt werden. Sie sind nur für die Sammlung bedeutsam und haben darüber hinaus keinen Nutzungswert. Hier wird also die erste Stufe ausgelassen, und die Dinge werden gleich als passive Artefakte einer Sammlung zugeführt (z. B. Panini-Bilder).
Der Wunsch, eine komplette Sammlung zu haben, ist die Triebfeder der Sammelnden. Oft ein paradoxer Aspekt, weil die Sammlerinnen und Sammler wissen, dass (so gut wie nie) Vollständigkeit erreicht werden kann, da es eine Begrenztheit und damit ein Ende der Sammlung zumeist nicht gibt (Schulz 2009). Die Sammelgebiete sind in der Regel so zugeschnitten, dass die Sammlung unbegrenzt fortgeführt werden kann: Kuckucksuhren, Pillendosen oder Kugelschreiber – es gibt nach dem letzten Sammelobjekt immer noch ein weiteres.
Sammler und Sammlerinnen geben sich oft ihrer Sammlung hin, verbringen viel Zeit damit. Sie sind Expertin, Fachmann, Kennerin und Spezialist für ihr Sammelgebiet. Wenn Einzelpersonen sammeln, dann ist das immer auch ein Ausdruck von Privatheit und findet (zunächst) unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt (Wilde 2015). Circa 80 Prozent der Sammelnden nennen Freude als Motiv für ihr Sammeln (Kleine/Jolmes 2014, S. 19): Sammeln wird von ihnen als Bereicherung des Alltagslebens empfunden, und die Zeit mit der Sammlung betrachten Sammelnde als die schönsten Stunden (Duncker 2010).
Sammler und Sammlerinnen geben den Dingen Sinn und Ordnung, und die Objekte bieten den Sammlern und Sammlerinnen wiederum Orientierung und Halt (Wilde 2015). Man kann hier von einer Win-win-Situation sprechen.
«Nur ein Sammler versteht einen
Sammler. Leute, die mit Sammeln nichts
am Hut haben, die sagen:
Was für ein Spinner. Wie kann man nur?
Was macht der da?»
(Füllfederhalter-Sammler Jens
Schulz, zitiert in Wilde 2015, S. 11)
WARUM SAMMELT DER MENSCH?
Читать дальше